
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Stelzen ( Motacillidae) kennzeichnen sich durch äußerst schlank gebauten Leib, dünnen, geraden, gestreckt pfriemenförmigen, auf der Firste kantigen, vor der Spitze des Oberkiefers mit seichtem Ausschnitte versehenen Schnabel, mittellange Flügel, langen, schmalfedrigen, ausnahmsweise gegabelten Schwanz, ziemlich hohe, schlankläufige und langzehige, mit großen, an der Hinterzehe oft sporenartig verlängerten Krallen bewehrte Füße und buntes, nach dem Geschlechte einigermaßen verschiedenes Gefieder.
Die Stelzen im engeren Sinne ( Motacillinae) gehören fast ausschließlich der Alten Welt an, verbreiten sich hier aber über alle Gürtel der Breite und Höhe. Wasserreiche Gegenden sind ihre Wohnsitze. Einzelne Arten entfernen sich nur während ihrer Reisen von dem Wasser, andere treiben sich, Nahrung suchend, auch auf trockenen Stellen umher, kehren aber immer wieder zum Wasser zurück. Die nordischen Arten sind Zugvögel, die südlichen Strichvögel, einzelne entschiedene Standvögel. Sie erscheinen im Norden frühzeitig im Jahre und verweilen hier bis in den Spätherbst, wandern jedoch weit nach Süden hinab. Ihre Bewegungen sind zierlich und anmutig. Sie gehen gewöhnlich schrittweise, bedachtsam, nicken bei jedem Schritt mit dem Kopfe und halten dabei den langen Schwanz wagerecht oder ein wenig erhoben, bewegen ihn aber beständig auf und nieder. Ihr rascher und geschickter Flug besteht aus großen Bogen, die dadurch entstehen, daß sie ihre Flügel wechselseitig heftig bewegen und stark zusammenziehen. Ihre Stimme ist nicht gerade klangvoll, ihr Gesang einfach, aber ansprechend. Die Nahrung besteht aus allerhand Kerbtieren oder deren Larven und niederem Wassergetier. Das Nest, ein schlechter Bau aus feinen Reischen, Würzelchen, Gras- und Strohhalmen, Moos, dürren Blättern und dergleichen, der im Innern mit Wolle und ähnlichen weichen Stoffen ausgelegt wird, steht in Höhlen und Vertiefungen, regelmäßig nahe am Wasser; die Eier sind zartschalig und auf lichtem oder graulichem Grunde fein gefleckt.
Die meisten Stelzen wissen durch ihre Anmut und Zutunlichkeit auch das roheste Gemüt für sich zu gewinnen, haben deshalb wenig Feinde unter den Menschen, wohl aber viele unter den Raubtieren, vermehren sich jedoch stark und gleichen dadurch alle ihren Bestand treffende Verluste glücklich wieder aus. Im Käfig hält man sie selten; wer sie aber zu Zimmergenossen erhebt, wird durch ihre Anmut und Zierlichkeit in hohem Grade gefesselt.
Gewissermaßen das Urbild der Familie ist die Bachstelze, Stein- oder Wasserstelze, Wippstert oder Nonne ( Motacilla alba), Vertreterin der Sippe der Stelzen ( Motacilla). Ihre Oberteile sind grau, Hinterhals und Nacken sammetschwarz, Kehle, Gurgel und Oberbrust schwarz, Stirn, Zügel, Backen, Halsseiten und die Unterteile weiß, die Schwingen schwärzlich, weißgrau gesäumt, wegen der weiß zugespitzten Deckfedern zweimal licht gebändert, die mittelsten Steuerfedern schwarz, die übrigen weiß. Das Weibchen ähnelt dem Männchen; doch ist sein schwarzer Kehlfleck gewöhnlich nicht so groß. Das Herbstkleid beider Geschlechter unterscheidet sich von der Frühlingstracht hauptsächlich durch die weiße Kehle, die mit einem hufeisenförmigen, schwarzen Bande eingefaßt ist. Die Jungen sind auf der Oberseite schmutzig aschgrau, auf der Unterseite, mit Ausnahme des dunkeln Kehlbandes, grau oder schmutzigweiß. Das Auge ist dunkelbraun, Schnabel und Füße sind schwarz. Die Länge beträgt zweihundert, die Breite zweihundertachtzig, die Fittichlänge fünfundachtzig, die Schwanzlänge achtundneunzig Millimeter. In Großbritannien tritt neben der Bachstelze die Trauerstelze ( Motacilla lugubris) auf. Sie unterscheidet sich bloß dadurch, daß im Frühlingskleide auch Mantel, Bürzel und Schultern schwarz sind. Wir betrachten sie als Abart.
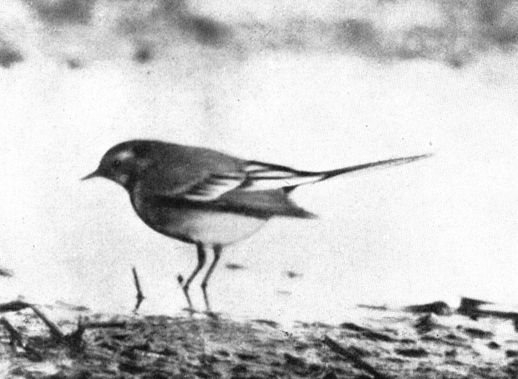
Trauerstelze ( Moticilla lugubris)
Die Stelze bewohnt ganz Europa, auch Island, West- und Mittelasien sowie Grönland, und wandert im Winter bis ins Innere Afrikas, obwohl sie einzeln schon in Südeuropa, sogar in Deutschland, Herberge nimmt. Bei uns zulande erscheint sie bereits Anfang März, bei günstiger Witterung oft schon in den letzten Tagen des Februar, und verläßt uns erst im Oktober, zuweilen noch später wieder. Sie meidet den Hochwald und das Gebirge über die Holzgrenze, haust sonst aber buchstäblich allerorten, befreundet sich mit dem Menschen, siedelt sich gern in der Nähe seiner Wohnung an, nimmt mit Urbarmachung des Bodens an Menge zu, bequemt sich allen Verhältnissen an und ist daher auch in großen Städten eine regelmäßige Erscheinung.
Beweglich, unruhig und munter im höchsten Grade, ist sie vom frühen Morgen bis zum späten Abend ununterbrochen in Tätigkeit. Nur wenn sie singt, sitzt sie wirklich unbeweglich, aufgerichtet und den Schwanz hängend, auf einer und derselben Stelle; sonst läuft sie beständig hin und her, und wenn nicht, bewegt sie wenigstens den Schwanz. Sie geht rasch und geschickt, schrittweise, hält dabei den Leib und den Schwanz wagerecht und zieht den Hals etwas ein, fliegt leicht und schnell, in langen, steigenden und fallenden Bogen, die zusammengesetzt eine weite Schlangenlinie bilden, meist niedrig und in kurzen Strecken über dem Wasser oder dem Boden, oft aber auch in einem Zuge weit dahin, stürzt sich, wenn sie sich niedersetzen will, jählings herunter und breitet erst kurz über dem Boden den Schwanz aus, um die Wucht des Falles zu mildern. Ihr Lockton ist ein deutliches »Ziwih«, das zuweilen in »Zisis« oder »Ziuwis« verlängert wird, der Laut der Zärtlichkeit ein leises »Quiriri«, der Gesang, der im Sitzen, im Laufen oder Fliegen vorgetragen und sehr oft wiederholt wird, zwar einfach, aber doch nicht unangenehm. Sie liebt die Gesellschaft ihresgleichen, aber auch mit ihren Gesellschaftern sich zu necken, spielend umherzujagen und selbst ernster zu raufen. Andern Vögeln gegenüber zeigt sie wenig Zuneigung, eher Feindseligkeit, bindet oft mit Finken, Ammern und Lerchen an und befehdet Raubvögel. »Wenn die Stelzen einen solchen erblicken«, sagt mein Vater, »verfolgen sie ihn lange mit starkem Geschrei, warnen dadurch alle andern Vögel und nötigen auf solche Weise manchen Sperber, von seiner Jagd abzustehen. Ich habe hierbei oft ihren Mut und ihre Gewandtheit bewundert und bin fest überzeugt, daß ihnen nur die schnellsten Edelfalken etwas anhaben können. Wenn ein Schwarm dieser Vögel einen Raubvogel in die Flucht geschlagen hat, dann ertönt ein lautes Freudengeschrei, und mit diesem zerstreuen sie sich wieder. Auch gegen den Uhu sind sie feindselig; sie fliegen auf der Krähenhütte um ihn herum und schreien stark; doch zerstreuen sie sich bald, weil der Uhu nicht auffliegt.«
Kerbtiere aller Art, deren Larven und Puppen sucht die Bachstelze an den Ufern der Gewässer, vom Schlamme, von Steinen, Miststätten, Hausdächern und andern Plätzen ab, stürzt sich blitzschnell auf die erspähte Beute und ergreift sie mit unfehlbarer Sicherheit. Dem Ackermann folgt sie und liest hinter ihm die zu Tage gebrachten Kerfe auf; bei den Viehherden stellt sie sich regelmäßig ein, bei Schafhürden verweilt sie oft tagelang. »Wenn sie an Bächen oder sonstwo auf der Erde herumläuft, richtet sie ihre Augen nach allen Seiten. Kommt ein Kerbtier vorbeigestrichen, dann fliegt sie sogleich in die Höhe, verfolgt es und schnappt es fast immer weg.«
Bald nach Ankunft im Frühjahre erwählt sich jedes Paar sein Gebiet, niemals ohne Kampf und Streit mit andern derselben Art; denn jedes unbeweibte Männchen sucht dem gepaarten die Gattin abspenstig zu machen. Beide Nebenbuhler fliegen mit starkem Geschrei hintereinander her, fassen zeitweilig festen Fuß auf dem Boden, stellen sich kampfgerüstet einander gegenüber und fahren nun wie erboste Hähne ingrimmig aufeinander los. Einer der Zweikämpfer muß weichen; dann sucht der Sieger seine Freude über den Besitz »des neu erkämpften Weibes« an den Tag zu legen. In ungemein zierlicher und anmutiger Weise umgeht er das Weibchen, breitet abwechselnd die Flügel und den Schwanz und bewegt erstere wiederholt in eigentümlich zitternder Weise. Auf dieses Liebesspiel folgt regelmäßig die Paarung. Das Nest steht an den allerverschiedensten Plätzen: in Felsritzen, Mauerspalten, Erdlöchern, unter Baumgewurzel, auf Dachbalken, in Hausgiebeln, Holzklaftern, Reisighaufen, Baumhöhlungen, auf Weidenköpfen, sogar in Booten usw. Grobe Würzelchen, Reiser, Grasstengel, dürre Blätter, Moos, Holzstückchen, Grasstöcke, Strohhalme usw. bilden den Unterbau, zartere Halme, lange Grasblätter und seine Würzelchen die zweite Lage, Wollklümpchen, Kälber- und Pferdehaare, Werg- und Flachsfasern, Fichtenflechten und andre weiche Stoffe die innere Ausfütterung. Das Gelege der ersten Brut besteht aus sechs bis acht, das der zweiten aus vier bis sechs neunzehn Millimeter langen, fünfzehn Millimeter dicken Eiern, die auf grau- oder bläulichweißem Grunde mit dunkel- oder hellaschgrauen, deutlichen oder verwaschenen Punkten und Strichelchen dicht, aber fein gezeichnet sind. Das Weibchen brütet allein; beide Eltern aber nehmen an der Erziehung der Jungen teil, verlassen sie nie und reisen sogar auf Fahrzeugen, auf denen sie ihr Nest erbauten, weit durch das Land oder hin und her. Das erste Gelege ist im April, das zweite im Juni vollzählig. Die Jungen wachsen rasch heran und werden dann von den Eltern verlassen; die der ersten Brut vereinigen sich jedoch später mit ihren nachgeborenen Geschwistern und den Alten zu Gesellschaften, die nunmehr bis zur Abreise in mehr oder weniger innigem Verbande leben. Im Herbst ziehen die Familien allabendlich den Rohrteichen zu und suchen hier zwischen Schwalben und Staren ein Plätzchen zum Schlafen. Später vereinigen sich alle Familien der Umgegend zu mehr oder minder zahlreichen Schwärmen, die an Stromufern bis zu Tausenden anwachsen können. Diese so gesellten Heere brechen gemeinschaftlich zur Wanderung auf, streichen während des Tages von einer Viehtrift oder einem frisch gepflügten Acker zum andern, immer in der Reiserichtung weiter, bis die Dunkelheit einbricht, erheben sich sodann und fliegen unter lautem Rufen südwestlich dahin.
Zierlicher und anmutiger noch als die Bachstelze ist die Gebirgsstelze ( Motacilla sulfurea), ein reizender Vogel. Beim Männchen ist im Frühjahre die Oberseite aschgrau, die Unterseite schwefelgelb, die Kehle schwarz, von dem Grau der Oberseite durch einen weißen Streifen geschieden; ein anderer gleichfarbiger Streifen zieht sich über das Auge, zwei lichtgraue, wenig bemerkbare Binden laufen über die Flügel. Im Herbst sind die Farben matter und die Kehlfedern weißlich. Sehr alte Weibchen ähneln den Männchen. Die Jungen sind auf der Oberseite schmutzig aschgrau, auf der Unterseite gelbgrau; die Kehle ist grauweiß, mit schwarzgrauen Punkten eingefaßt. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß hornfarben. Die Länge beträgt zweihundertundzehn, die Breite zweihundertfünfundfünfzig, die Fittichlänge fünfundachtzig, die Schwanzlänge einhundertundfünf Millimeter. Das Verbreitungsgebiet der Gebirgsstelze umfaßt ganz Europa von Südschweden an, den größten Teil Asiens und einige Gebirge Nord-, Ost- und Westafrikas, insbesondere den Atlas, das Hochland Abessiniens und die Hochländer der Westküste. Im nördlichen Europa gehört sie zu den Seltenheiten; von Mitteldeutschland nach Süden hin findet sie sich fast überall im Gebirge, bei uns zulande schon an jedem klaren Bach der Vorberge, einzeln selbst an solchen der Ebene, im Süden erst im höheren Gebirge.

Gebirgsstelze ( Moticilla sulphurca)
Man kann kaum einen netteren Vogel sehen als die zierliche, anmutige Gebirgsstelze. Sie geht gleichsam geschürzt längs dem Wasser dahin oder an seichten Stellen in dasselbe hinein, hütet sich sorgfältig, irgendeinen Teil ihres Leibes zu beschmutzen, und wiegt sich beim Gehen wie eine Tänzerin. »Sie läuft«, sagt mein Vater, »mit der größten Schnelligkeit nicht nur an den Ufern, sondern auch in seichten Wässern, wenn es ihr nicht bis an die Fersen geht, in Schleusen, auf den Dächern und auf nassen Wiesen herum, wobei sie den Körper und Schwanz wagerecht, letzteren oft auch etwas aufrecht hält, um ihn sorgfältig vor Nässe zu bewahren. Sitzt sie aber auf einem Baume, Wasserbette, Steine oder sonst auf einem erhöhten Gegenstande, so richtet sie ihren Leib hoch auf und läßt ihren Schwanz schief herabhängen. Ihr Flug ist ziemlich schnell und leicht, absatzweise bogig, er geht oft lange Strecken in einem fort. Ich erinnere mich, daß sie Viertel- oder halbe Wegstunden weit in einem Zuge an einem Bache hinflog, ohne sich niederzulassen. Sie tut dies besonders im Winter, weil sie in der rauhen Jahreszeit ihre Nahrung in einem größeren Gebiete zusammensuchen muß. In der warmen Jahreszeit fliegt sie, wenn sie aufgescheucht wird, selten weit. Sie ist sehr zutraulich, nistet bei den Häusern, oft in ihren Mauern, und läßt einen Menschen, der sich nicht um sie bekümmert, nahe an sich vorübergehen, ohne zu entfliehen. Bemerkt sie aber, daß man ihr nachstellt, wird sie so scheu, daß sie sich durchaus nicht schußgerecht ankommen läßt, wenn sie nicht hinterschlichen wird. Ihr Lockton, den sie hauptsächlich im Fluge, seltener aber im Sitzen hören läßt, hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem der Bachstelze, so daß man beide Arten genau kennen muß, wenn man sie genügend unterscheiden will. Er klingt fast wie ›Ziwi‹, es ist aber unmöglich, ihn mit Buchstaben genau zu bezeichnen.«
Auch die Gebirgsstelze brütet zeitig im Frühjahr, das erste Mal schon im April, das zweite Mal spätestens im Juli. Bei der Paarung setzt sich das Männchen auf einen Zweig oder einen Dachfirst, hoch oder tief, auf ein Wehr oder einen Stein usw. und gibt einen trillerartigen Ton von sich, der fast wie »Törrli« klingt und besonders in den ersten Morgenstunden gehört wird. Fliegt es auf, dann flattert es mit den Flügeln, setzt sich aber bald wieder nieder. Es hat gewisse Plätze, gewisse Bäume, Häuser und Wehre, auf denen es im März und im Anfang des April alle Morgen sitzt und seine einfachen Töne hören läßt. Im Frühjahr vernimmt man auch, jedoch selten, einen recht angenehmen Gesang, der mit dem der Bachstelze einige Ähnlichkeit hat, aber hübscher ist. Das Nest steht in Felsen-, Mauer- und Erdlöchern, unter überhängenden Ufern, in Mühlbetten, im Gewurzel usw., regelmäßig nahe am Wasser, richtet sich hinsichtlich seiner Größe nach dem Standorte und ist dementsprechend bald größer, bald kleiner, aber auch bald dichter, bald lockerer, bald mehr, bald weniger gut gebaut. Die äußere Lage besteht aus Würzelchen, Borsten, Pferdehaaren und Wolle. Die vier bis sechs Eier sind achtzehn Millimeter lang und dreizehn Millimeter dick, auf grauschmutzigem oder bläulichweißem Grunde mit gelben oder aschgrauen Flecken und Strichelchen gezeichnet, gewässert und geadert. Das Weibchen brütet allein; doch kommt es ausnahmsweise vor, daß das Männchen es ablöst. Der Bruteifer der Mutter ist so groß, daß es sich mit der Hand ergreifen läßt. Die Jungen werden von beiden Eltern reichlich mit Nahrung versehen, sehr geliebt und nach dem Ausfliegen noch eine Zeitlang geführt und geleitet.
Gefangene Gebirgsstelzen übertreffen alle Verwandten an Anmut und Lieblichkeit, zieren jedes größere Bauer im höchsten Grade und dauern bei einigermaßen entsprechender Pflege recht gut aus.
Vom Nordosten Europas her hat sich eine der schönsten, wenn nicht die schönste aller Stelzen, die Sporenstelze ( Motacilla citreola) wiederholt nach Westeuropa und so auch nach Deutschland verflogen. Sie ist merklich kleiner, namentlich kürzer, als die Gebirgsstelze; ihre Länge beträgt achtzehn, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Kopf und ganze Unterseite, ausschließlich der weißen Unterschwanzdecken, sind lebhaft zitrongelb, Nacken und Vorderrücken schwarz, allmählich in das Schiefergraue der übrigen Oberseite übergehend.
Die Sporenstelze ist ein Kind der Tundra, lebt in Europa aber nur in dem nordöstlichsten Winkel, im unteren Petschoragebiet. Von hier aus erstreckt sich ihr Verbreitungsgebiet durch ganz Nordasien, soweit die Tundra reicht; den Winter scheint sie in dem südlichen Steppengebiete Asiens zu verbringen; doch fehlen hierüber Beobachtungen. Auf ihrem Brutgebiet erscheint sie mit den Schafstelzen in der zweiten Hälfte des April und verweilt bis zu Ende des August im Lande. In Ostasien soll sie in großen Scharen wandern; in Westsibirien begegneten wir nur kleinen Flügen, die auf der Reise begriffen waren, später aber in der Tundra der Samojedenhalbinsel vielen brütenden Paaren. Diese bewohnen ganz bestimmte Örtlichkeiten der Tundra: auf moorig-schlammigem Grunde wachsende, bis zur Undurchdringlichkeit verfilzte Wollweidendickichte, zwischen denen Wassergräben verlaufen oder Wasserbecken und ebenso von üppig aufschießenden Gräsern übergrünte Stellen sich befinden. Hier wird man den schönen Vogel nie vermissen, während man sonst tagelang die Tundra durchwandern kann, ohne einem einzigen Paare zu begegnen. Wie in Gestalt und Färbung, ist die Sporenstelze auch im Sein und Wesen ein Mittelglied zwischen Gebirgs- und Schafstelze, steht der letzteren aber näher als der ersteren.
Die mehrfach erwähnte Schafstelze, Kuh-, Rinder-, Wiesen- und Triftstelze ( Motacilla flava), hat einen kurzen Schwanz und einen sporenartigen Nagel an der Hinterzehe. Ihre Länge beträgt durchschnittlich siebzehn, die Breite fünfundzwanzig, die Fittichlänge acht, die Schwanzlänge sieben Millimeter. Oberkopf, Zügel, Ohrgegend, Nacken und Hinterhals, einen über den Augen fortlaufenden, bis auf die Schläfen reichenden schmalen weißen Strich ausgenommen, sind aschgrau, die übrigen Oberteile olivengrün, die oberen Schwanzdecken dunkler, die Kopf- und Halsseiten sowie die übrigen Unterteile, mit Ausnahme des weißlichen Kinnes, schwefelgelb, die Schwingen braunschwarz, die Schwanzfedern schwarz, die beiden äußersten weiß. Der Augenring ist braunschwarz, der Schnabel wie die Füße schwarz. Die Schafstelze tritt in verschiedenen ständigen Formen auf, die von einzelnen Naturforschern als Arten, von andern nur als Spielarten betrachtet werden. Sehen wir von solcher Trennung ab, so haben wir Europa, Mittelasien und Nordwestamerika als Brutgebiet, Südasien, Mittel- und Südafrika als Winterherberge anzunehmen.
Im ganzen Norden sind die Schafstelzen Sommervögel, die viel später als die Bachstelzen, frühestens im Anfange, meist erst gegen Ende des April und selbst in den ersten Tagen des Mai einwandern und im August, spätestens im September, ihre Winterreise antreten. Während des Zuges gewahrt man sie auch in Gegenden, in denen sie nicht brüten, da jede größere Viehherde sie anzieht und oft während des ganzen Tages festhält. Ihre Brutplätze sind, abgesehen von der Tundra, dem Wohngebiete von Hunderttausenden dieser Sumpffreunde, feuchte Gegenden oder zeitweilig überschwemmte Niederungen. »Da, wo Schafstelzen brüten«, sagt Naumann, »findet man während des Sommers keinen Raps- oder Rübsenacker, kein Erbsen-, Bohnen- oder Wickenstück von einiger Bedeutung, kein Kleefeld, keine frei gelegene, fette Wiese und keine baumleere, grasreiche Sumpfstrecke, wo nicht wenigstens einige dieser Vögel hausen. Einzelne Brüche bewohnen sie in unglaublicher Menge. In den Marschländern, wo sie, außer dem üppigsten Getreide und den fetten Feldfrüchten, Wasser, Sümpfe, Rohr und Wiesen zusammen finden, wo dazwischen auch Vieh weidet, haben sie alles, was sie wünschen mögen, und sind daher dort äußerst gemein.«
Sie sind nicht so anmutig wie die Gebirgsstelzen, aber unzweifelhaft anmutiger als die Bachstelzen. Ihre Bewegungen ähneln denen der Bachstelze mehr als denen der Gebirgsstelze. Sie sind gewandt im Laufen, besonders geschickt aber im Fliegen. Wenn sie kurze Räume überfliegen wollen, erscheint ihr Flug fast hüpfend, wogegen sie auf der Wanderung außerordentlich schnell dahinstreichen. Nicht selten erhalten sie sich flatternd oder rüttelnd längere Zeit in der Luft über einer und derselben Stelle, und häufig stürzen sie sich aus bedeutenden Höhen mit angezogenen Flügeln fast senkrecht zum Boden herab. Ihre Lockstimme ist ein pfeifender Laut, der wie »Bsiüb« oder wie »Bilib«, sonst aber auch leise wie »Sib sib« klingt; der Warnungston ist ein scharfes »Sri«, der Paarungslaut ein gezogenes »Zirr«. Der Gesang ähnelt dem der Bachstelze, ist aber noch ärmer.
So gesellig im allgemeinen, so zanksüchtig zeigen sie sich an ihren Brutplätzen. Hier beginnen sie Streit mit fast allen kleineren Vögeln, die sie dort gewahr werden. Das Nest steht auf dem Boden, zwischen Gras, Getreide oder Sumpfpflanzen, meist in einer kleinen Vertiefung, zuweilen auch unter Gewurzel. Feine Wurzeln, Halme, Blätter, trockene Grasblätter und grünes Erdmoos bilden ein lockeres, kunstloses Gewebe, Hälmchen, Distelflocken, Wolle, einzelne Pferdehaare und Federn die innere Ausfütterung. Die vier bis sechs zartschaligen Eier sind durchschnittlich achtzehn Millimeter lang, dreizehn Millimeter dick und aus schmutzigweißem oder gelblichem, rötlichem und graulichem Grunde mit gelblichen, grauen oder braungrauen, auch rostfarbenen und violettfarbigen Punkten, Strichelchen und wolkigen Flecken gezeichnet. Das Männchen wirbt brünstig um die Gunst seiner Gattin, indem es sich aufbläht und mit gesträubtem Gefieder und sehr ausgebreitetem, herabgebogenem Schwanze zitternd vor ihr herumflattert. Jedes Pärchen nistet nur einmal im Jahre, und zwar zu Ende Mai oder im Anfang des Juni. Das Weibchen brütet allein und zeitigt die Jungen in dreizehn Tagen. Beide Eltern sind so besorgt um ihre Brut, daß sie dieselbe dem Kundigen durch ihr ängstliches Geschrei und ihre außergewöhnliche Kühnheit verraten. Die Jungen verbergen sich anfangs geschickt im Grase, werden aber bald ebenso flüchtig wie die Alten. Nunmehr treiben sie sich bis zur Abreise gemeinschaftlich umher; dann tritt eines schönen Herbsttages alt und jung die Winterreise an.
Jetzt sieht oder hört man die Schafstelzen allerorten, durch Viehherden angezogen, auch im Gebirge. Die Reise scheint sehr rasch zurückgelegt zu werden. Nach meinen Beobachtungen erscheinen die Schafstelzen auch in Afrika zu derselben Zeit, die wir in Deutschland als die ihres Zuges kennengelernt haben, und ich fand sie hier noch häufig im Anfange des Maimonats, fast an denselben Tagen, an denen ich ihnen später in Norwegen begegnete. Viele überwintern schon in Ägypten; die große Mehrzahl aber fliegt bis in das Innere Afrikas. Hier sieht man während der Wintermonate jede Rinder-, Schaf- oder Ziegenherde, ja jedes Kamel, jedes Pferd, jedes Maultier oder jeden Esel von den niedlichen Vögeln umgeben, und auf den Weideplätzen wimmelt es zuweilen von ihnen. Sie wandern mit den werdenden Rindern in die Steppe hinaus und zu den Tränkplätzen zurück, fliegen neben ihren vierfüßigen Freunden dahin, wo sie nicht laufen können, und laufen mit den Rindern um die Wette, wo der Boden dies gestattet. Rasch setzt sich auch wohl eins der Männchen auf einem benachbarten Busche nieder und singt dabei sein einfaches Liedchen; hierauf eilt es wieder dem übrigen Zuge nach, der, einem Bienenschwarme vergleichbar, die Herde umschwebt.
*
Die Pieper ( Anthinae), die die zweite Unterfamilie bilden, sind als Übergangsglied von den Sängern zu den Lerchen anzusehen und wurden früher geradezu den letzteren zugezählt. Ihre Kennzeichen sind schlanker Leib, dünner, gerader, an der Wurzel schmaler, pfriemenförmiger Schnabel, mit eingezogenem Rande und einem seichten Einschnitte vor der sehr wenig abwärts gesenkten Spitze des Oberschnabels, schlankläufige Füße mit schwachen Zehen, aber großen Nägeln, deren eine, die hinterste, wie bei den Lerchen sporenartig verlängert, mittelmäßig lange Flügel, mittellanger Schwanz, glatt anliegendes, erd- oder grasfarbiges, nach Geschlecht und Alter kaum, nach der Jahreszeit einigermaßen verschiedenes Gefieder. Die Unterfamilie ist über die ganze Erde verbreitet. Alle Pieper bringen den größten Teil ihres Lebens auf dem Boden zu und lassen sich nur zeitweilig auf Bäumen nieder. Sie sind bewegliche, muntere, hurtige Vögel, die schrittweise rasch umherlaufen und dabei sanft mit dem Schwanze wippen, wenn es gilt, größere Strecken zu durchmessen, gut, schnell, leicht und bogig, wenn sie die Lust zum Singen in die Höhe treibt, flatternd und schwebend fliegen, eine piepende Lockstimme und einen einfachen, aber angenehmen Gesang vernehmen lassen, Kerbtiere, namentlich Käfer, Motten, Fliegen, Hafte, Schnaken, Blattläuse, auch Spinnen, Würmer und kleine Wassertierchen, sogar feine Sämereien fressen, sie immer vom Boden ablesen und nur ausnahmsweise einer vorüberfliegenden Beute im Fluge nachjagen. Die Nester werden auf dem Boden angelegt, der Hauptsache nach aus dürren Grashalmen und Graswurzeln, die mit andern Pflanzenstoffen locker verbunden und innen mit Wolle und Haaren ausgefüttert werden. Die Eier zeigen auf düsterfarbigem Grunde eine sanfte, verfließende Zeichnung, die aus Punkten, Flecken und Strichelchen zusammengesetzt ist. Das Weibchen scheint allein zu brüten; beide Geschlechter aber lieben ihre Brut im hohen Grade. Die meisten nisten mehr als einmal im Jahre.
Wohl die bekannteste Art der Familie ist der Wiesenpieper ( Anthus pratensis). Die Federn der Oberseite sind olivenbraun, schwach olivengrün überflogen, durch dunkelbraune verwaschene Schaftflecke gezeichnet, die des Bürzels lebhafter und mehr einfarbig, ein Streifen über den Augen, Backen und Unterteile zart rostgelblich, seitlich etwas dunkler und hier, wie auf Kropf und Brust, mit breiten, braunschwarzen Schaftstrichen geziert, ein Strich unter dem Auge und ein bis auf die Halsseiten reichender Bartstreifen schwarz, die Schwingen und Schwanzfedern dunkel olivenbraun. Der Augenring ist tiefbraun, der Oberschenkel hornbraun, der untere hellbraun, der Fuß bräunlich. Die Länge beträgt fünfzehn, die Breite vierundzwanzig, die Fittichlänge sieben, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.

Wiesenpieper ( Anthus pratensis)
Man hat den Wiesenpieper in der ganzen Nordhälfte Europas sowie im größten Teile Nordasiens als Brutvogel gefunden und während des Winters in Südeuropa, Südwestasien und Nordafrika beobachtet. Bei uns erscheint er mit der Schneeschmelze, gewöhnlich schon zu Anfang des März, spätestens um die Mitte des April, und verweilt bis zum November, selbst bis zum Dezember. Er wandert in großen Scharen, nicht selten mit den Feldlerchen, und reist ebensowohl bei Tage wie in der Nacht. Als halber Sumpfvogel bewohnt er in der Heimat wie in der Winterherberge wasserreiche Gegenden, am liebsten feuchte, sumpfige Örtlichkeiten; nur unterwegs sieht man ihn dann und wann auch auf trockenerem Gelände. Die Tundra erscheint in seinen Augen als Paradies.
Er ist äußerst lebhaft und während des ganzen Tages in Bewegung, läuft, soviel als möglich zwischen Gras und Ried versteckt, ungemein hurtig umher, erhebt sich gewandten Fluges in die Luft, stößt seinen Lockton aus und streicht nun rasch geradeaus, einem ähnlichen Orte zu, läßt sich aber selten auf Baumzweigen nieder und hält sich hier nie lange auf. Der Flug geschieht in kurzen Absätzen und erscheint dadurch zuckend oder hüpfend, auch anstrengend, obgleich dies nicht der Fall ist. Der Lockton, ein heiseres, feines »Ißt«, wird oft rasch nacheinander ausgestoßen und klingt dann schwirrend; der Ausdruck der Zärtlichkeit lautet sanft wie »Dwitt« oder »Zeritt«. Der Gesang besteht aus verschiedenen zusammenhängenden Strophen: »Wittge wittge, wittge witt, zick zick, jück jück« und »Türrr«, miteinander verbunden, aber etwas verschieden betont, sind die Grundlaute. Das Männchen singt, wie alle Pieper, fast nur im Fluge, indem es vom Boden oder von der Spitze eines niedern Strauches in schiefer Richtung flatternd sich aufschwingt, ziemlich hoch in die Luft steigt, hier einige Augenblicke schwebend oder rüttelnd verweilt und nun mit hochgehaltenen Flügeln singend herabschwebt oder mit angezogenen Fittichen schnell herabfällt. Man vernimmt das Lied vom Morgen bis zum Abend und von Mitte April bis gegen Juli hin fast ununterbrochen.
Gegen seinesgleichen zeigt sich der Wiesenpieper höchst gesellig und friedfertig; mit andern neben ihm wohnenden Vögeln, Schafstelzen, Schilf- und Seggenrohrsängern, Rohrammern und dergleichen neckt er sich gern herum. In der Brutzeit behauptet jedes Pärchen seinen Stand, und es kommt auch wohl zwischen zwei benachbarten Männchen zu Kampf und Streit; im ganzen aber liebt unser Vogel selbst um diese Zeit geselliges Zusammenleben. Das Nest steht zwischen Seggenschilf, Binsen oder Gras auf dem Boden, meist in einer kleinen Vertiefung, immer so versteckt, daß es schwer zu finden ist. Eine Menge dürrer Stengel, Würzelchen und Halme, zwischen die zuweilen etwas grünes Erdmoos eingewebt wird, bilden die Außenwandungen; die tiefe, zierlich gebildete Mulde ist mit seinen Halmen und Pferdehaaren ausgelegt. Fünf bis sechs achtzehn Millimeter lange, vierzehn Millimeter dicke Eier, die auf graulichweißem oder schmutzigrötlichem Grunde überall dicht mit graubraunen oder gelbbraunen Punkten, Schmitzen oder Kritzeln bezeichnet sind, bilden das Gelege und werden in dreizehn Tagen gezeitigt. Die Jungen verlassen das Nest, noch ehe sie ordentlich fliegen können, verstehen es aber so meisterhaft, zwischen den niedern Pflanzen sich zu verstecken, daß sie doch vor den meisten Feinden gesichert sind. Bei Annäherung eines solchen gebärden sich die Alten sehr ängstlich und setzen sich rücksichtslos jeder Gefahr aus. Wenn alles gut geht, ist die erste Brut Anfang Mai, die zweite Ende Juli flügge; doch findet man auch bis in den August hinein Junge, die eben das Nest verlassen haben.
In einem großen Käfig hält sich der Wiesenpieper recht gut, wird sehr zahm und singt ziemlich eifrig. Im Zimmer darf man ihn nicht umherlaufen lassen, weil sich bald Haare, Fäden oder Schmutz an seine Füße hängen und diesen gefährliche Krankheiten zuziehen.
Der Baumpieper, Holz-, Garten-, Busch-, Weiden- oder Waldpieper ( Anthus arboreus), ähnelt dem Wiesenpieper sehr, ist jedoch etwas größer, sein Schnabel stärker, der Lauf kräftiger und der Nagel der Innenzehe kürzer und gekrümmter. Waldungen Europas und Sibiriens beherbergen den Baumpieper im Sommer, die Steppenwälder Afrikas und die des unteren Himalaja im Winter; baumarme Landstriche besucht er nur während seines Zuges. Blößen im Walde, lichte Gehaue, frische Schläge und andere wenig bewachsene Stellen des Waldes, auch solche, die alljährlich überschwemmt werden, bilden sein Brutgebiet. In Mitteldeutschland ist er häufig, und sein Bestand nimmt von Jahr zu Jahr, hier und da zum Nachteile der Heidelerche, erheblich zu. In seinem Wesen erinnert er vielfach an seinen Verwandten, hält sich jedoch nicht so viel am Boden auf wie dieser, flüchtet bei Gefahr vielmehr stets den Bäumen zu und läuft auch, was jener niemals tut, auf den Ästen schrittweise dahin. Minder gesellig als der Wiesenpieper, lebt er meist einsam und bloß im Herbste familienweise, zeigt wenig Anhänglichkeit gegen die Gesellschaft und wird im Frühjahr geradezu ungesellig. Der Lockton ist ein schwer wiederzugebender Laut, der ungefähr wie »Srit« klingt, der Ausdruck der Zärtlichkeit ein leises »Sib sib sib«, der Gesang besser als jeder andere Piepergesang, kräftig und lieblich, dem Schlage eines Kanarienvogels nicht unähnlich, ausgezeichnet durch Fülle und Klarheit des Tones, Abwechselung und Mannigfaltigkeit der Weise. Trillerartige, laut pfeifende, schnell aufeinanderfolgende Strophen, die sich zu einem lieblichen Ganzen gestalten und gewöhnlich mit einem sanft ersterbenden »Zia zia zia« schließen, setzen ihn zusammen. Das Männchen singt sehr fleißig, setzt sich dazu zunächst auf einen hervorragenden Zweig oder auf die Spitze eines Baumes, steigt sodann in schiefer Richtung flatternd in die Luft empor und schwebt, noch ehe das Lied zu Ende gekommen, sanft wieder auf dieselbe Stelle oder auf den nächsten Baumwipfel nieder und gibt hier die letzten Töne zu hören.

Baumpieper ( Anthus arborcus)
Das Nest, das, immer sorgfältig verborgen, auf dem Boden, in einer kleinen Grube unter Gebüsch oder tief im Grase und Heidekraut steht, ist schlecht gebaut und nur im Innern einigermaßen sorgfältig ausgelegt. Die vier bis fünf zwanzig Millimeter langen, fünfzehn Millimeter dicken, in Gestalt, Färbung und Zeichnung vielfach abändernden Eier sind auf rötlichem, graulichem oder bläulichweißem Grunde mit dunkleren Punkten, Strichen, Kritzeln gezeichnet, geadert, gemarmelt und gefleckt. Das Weibchen sitzt sehr fest auf den Eiern; die Jungen werden von beiden Eltern zärtlich geliebt und verlassen das Nest ebenfalls, noch ehe sie flugfähig sind.
Gefangene Baumpieper halten sich leicht, werden überaus zahm und erfreuen durch die Zierlichkeit ihrer Bewegungen nicht minder als durch ihren trefflichen Gesang, den sie, auch wenn sie jung dem Neste entnommen wurden, genau ebenso vortragen wie in der Freiheit.
Der Wasserpieper, auch Wasser-, Sumpf- oder Moorlerche genannt ( Anthus aquaticus), ist auf der Oberseite dunkel olivengrau, mit vertuschten, schwarzgrauen Längsflecken gezeichnet, auf der Unterseite schmutzig- oder grauweiß, fleischrötlich verwaschen, an den Brustseiten dunkel olivenbraun gefleckt; hinter dem Auge verläuft ein hellgrauer Streifen; über die Flügel ziehen sich zwei lichtgraue Binden; die beiden äußersten Federn des braunschwarzen Schwanzes sind außen, am Ende auch innen weiß, welche Färbung sich bei dem folgenden Paare auf einen Spitzenschaftfleck verringert. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel hornschwarz, an der Spitze des Unterschnabels gelblich, der Fuß dunkelbraun. Die Länge beträgt achtzehn, die Breite dreißig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.
Das Verbreitungsgebiet des Wasserpiepers erstreckt sich über Mittel- und Südeuropa, West- und Ostasien bis China; die Winterreise führt ihn nach Kleinasien, Palästina und Nordafrika.
In Skandinavien, Dänemark und Großbritannien vertritt ihn der durch etwas dunklere, grünlich olivenbraun überhauchte Oberseite, minder lebhaft fleischrötliche Unterseite und bräunlich getrübten Endfleck der äußeren Schwanzfeder unterschiedene Felspieper, Strand- oder Uferpieper ( Anthus obscurus); in Nordamerika ersetzt ihn der auch auf Helgoland vorgekommene Braunpieper ( Anthus ludovicianus), der an der dunkel olivenbraunen Ober- und stark gefleckten Unterseite sowie den fast bis an die Wurzel weißen Schwanzfedern kenntlich ist.
Während andere Pieperarten die Ebene entschieden bevorzugen und Berggegenden nur hier und da bewohnen, gehört der Wasserpieper ausschließlich dem Gebirge an. Er bevölkert in namhafter Anzahl den Gürtel des Knieholzes der Alpen, Karpathen, des Schwarzwaldes, Harzes und des Riesengebirges und kommt bloß während seines Zuges in die Ebenen herab. In der Schweiz gehört er zu den gemeinsten Alpenvögeln; das Riesengebirge bewohnt er zu Tausenden. Hier erscheint er bereits mit der Schneeschmelze, zunächst in der Nähe der Bauden, und rückt allmählich weiter nach oben, so daß er in der letzten Hälfte des April auf seinen Brutplätzen anlangt. Ganz ähnlich ist es in der Schweiz.
»Der Wasserpieper«, sagt Gloger, dessen Lebensschilderung des Vogels ich nach eingehenden eigenen Beobachtungen als die vorzüglichste erklären muß, »findet sich weit oben auf den rauhen Hochgebirgen, wo schon die Baumwälder aufhören und fast nur noch Knieholz wächst, oft auch noch höher; ja, er steigt in der Schweiz sogar noch weit darüber hinaus, auf ganz unbewachsene Felsen und wasserreiche Alpen, wo kalte Bäche unter den Gletschern und aus den schmelzenden Schneemassen hervorrinnen.« Hier nimmt er seine aus allerlei Kerbtieren, Gewürm und seinen Algen bestehende Nahrung vom Boden auf.
»Er sitzt außer der Fortpflanzungszeit selten, während derselben sehr gern auf verkrüppelten Fichtenbäumchen und Kiefergesträuchen, weniger gern auf Felsstücken und Klippen. Jeder schon sitzende räumt einem andern, den er soeben erst herankommen sieht, stets unweigerlich seinen Platz ein. Bis zum Eintritt der strengen Jahreszeit sieht man die Wasserpieper vereinzelt; sie bleiben auch stets ungemein scheu. Bei ihrer Brut dagegen setzen sie ihre sonstige Schüchternheit völlig beiseite; sie fliegen und springen höchst besorgt um ihren Feind herum, schreien nach Kräften heftig ›Spieb spieb‹, in höchster Angst ›Gehlick glick‹, schlagen zugleich den Schwanz hoch auf und nieder und sträuben traurig ihr Gefieder. Sonst rufen sie ›Zgipp zgipp‹. Ihr Gesang, der bis zu Ende des Juli vernommen wird, ist recht angenehm, obschon er dem des Baumpiepers nachsteht. Eine seiner Strophen ähnelt dem Schwirren einiger Heimchenarten. Das Lied wird mit stets zunehmend beschleunigtem und zuletzt in äußerst schnellem Gange vorgetragen, während eines rasch aufsteigenden Fluges begonnen, unter behaglichem Schwimmen und schnellem, schiefem Niedersinken mit ruhig ausgebreiteten Flügeln eine Zeitlang fortgesetzt, aber erst im Sitzen auf einer Strauchspitze, einem Steinblock, Felsen oder auf dem Boden geendigt. Sehr selten, nur wenn trübe Wolken den ganzen Gesichtskreis in trüben Nebel verhüllen, singt der Wasserpieper im Sitzen. Während der ersten Nachmittagsstunden gibt keiner einen Laut von sich.
Sein Nest legt er viel freier und weniger verborgen an als andere Pieper. Es steht in weiten Felsenspalten, zwischen Steinen, unter hohen Rasenrändern, den großen alten Wurzeln und Ästen der Knieholzsträucher und in anderm alten Gestrüppe, so daß es oberhalb eine natürliche Decke gegen Schnee und Regen hat. Die vier bis sieben dreiundzwanzig Millimeter langen, sechzehn Millimeter dicken Eier haben auf bläulicher oder schmutzigweißer Grundfarbe in Dunkelbraun, Graubraun, Schwarzbraun und Graulich, meist sehr dicht, die Zeichnung der Piepereier, sehen zum Teil auch manchen Haussperlingseiern täuschend ähnlich.« Im Mittelgebirge legt das Paar bei guter Witterung zweimal, und zwar Anfang Mai und Ende Juni, im Hochgebirge nur einmal, und zwar Mitte Mai.
Unser Brachpieper, die Brach- oder Feldstelze ( Anthus campestris), ist oberseits lichtgelblichgrau, durch wenig deutliche, dunkle, spärlich stehende Flecke, unterseits trüb gelblichweiß, am Kropfe durch einige dunkle Schaftstriche gezeichnet; über das Auge zieht sich ein lichtgelblicher Streifen; die Flügel sind zweimal gelblichweiß gebändert. Bei den Jungen ist die Oberseite dunkler, jede Feder gelblich gerandet und die Unterseite am Kropfe stark gefleckt. Die Länge beträgt einhundertundachtzig, die Breite zweihundertundachtzig, die Fittichlänge dreiundachtzig, die Schwanzlänge sechsundsechzig Millimeter.
Das Verbreitungsgebiet des Brachpiepers umfaßt, mit Ausnahme der nördlichsten Tundra und Großbritanniens, ganz Europa, Mittel- und Südasien und Nordafrika, einschließlich der Kanaren. Er zieht unfruchtbare, dürre, steinige, wüstenhafte Gegenden allen andern vor und findet sich deshalb im Süden Europas viel häufiger als im Norden. In Deutschland ist er hier und da nicht selten, in andern Gauen eine sehr vereinzelte Erscheinung; in fruchtbaren Strichen fehlt er gänzlich. Er geht nur bis Südschweden hinauf, dafür aber um so weiter nach Süden hinab. Er erscheint aus seiner Winterherberge zurückkehrend in Deutschland um die Mitte des April und rüstet sich bereits im August wieder zum Wegzuge. Etwa im Mai treffen die Nachzügler ein, und im September sind die letzten verschwunden. Vor dem Wegzug schart er sich in Gesellschaften und Flüge, die bei schönem Wetter bei Tage, bei windigem des Nachts ziehen.
In seinen Bewegungen erinnert der Brachpieper ebensosehr an die Lerchen wie an die Bachstelzen. Er läuft in fast wagerechter Haltung, oft mit dem Schwanze wippend, möglichst gedeckt über den Boden dahin, erscheint von Zeit zu Zeit auf einem erhöhten Gegenstande, rastet einige Augenblicke, hält in etwas aufgerichteter Haltung Umschau und setzt sodann seinen Lauf fort, fliegt, die Schwingen abwechselnd rasch bewegend und wieder zusammenfaltend, in stark gebogener Schlangenlinie dahin, schwebt vor dem Niedersetzen gewöhnlich, stürzt sich aber auch mit angezogenen Schwingen fast senkrecht aus hoher Luft herab. Bei uns zulande ist er regelmäßig auffallend, im Süden hier und da im Gegenteil wenig scheu, unter allen Umständen aber vorsichtig. An Stimmbegabung steht er den andern Piepern nach. »Dillem« oder »Dlemm« ist der Lockton, »Kritlin, zirlui« und »Ziür« der Ausdruck der Zärtlichkeit, zugleich aber auch der wesentliche Bestandteil des außerordentlich einfachen, im Klange entfernt an die häufigsten Töne der Feldlerche erinnernden Gesanges. Die Nahrung besteht in allerlei Kleingetier, auch wohl in feinen Sämereien.
Während der Brutzeit behauptet und bewacht jedes Paar eifersüchtig ein ziemlich großes Gebiet. Das Männchen zeigt sich jetzt sehr gern frei, setzt sich auf einen hohen Stein, Felsenabsatz, auf Mauern, Sandhügel usw. oder auf einen Busch, selbst auf die unteren Äste der Bäume, steigt in schräger Richtung in die Luft empor, beginnt in einer Höhe von dreißig bis fünfzig Metern zu zittern und zu schwanken, fliegt unregelmäßig hin und her und stößt dabei sehr häufig wiederholt sein »Zirlui zirlui« aus. Das Nest, ein großer Bau, der äußerlich aus Moos, Queggenwurzeln und dürrem Laub besteht und innen mit Grashalmen und Würzelchen, auch wohl mit einzelnen Haaren ausgelegt wird, steht auf Schlägen, zwischen Gras und Heidekraut, auf Wiesen, in Erdvertiefungen usw. und ist wie alle Piepernester außerordentlich schwer zu finden. Die Erbauer vermeiden es sorgfältig, es irgendwie zu verraten, treiben sich z. B., sobald sie sich beobachtet sehen, nie in seiner Nähe umher. Das Gelege enthält vier bis sechs zweiundzwanzig Millimeter lange, fünfzehn Millimeter dicke Eier, die auf trübweißem Grunde über und über, am stumpfen Ende gewöhnlich dichter, mit matt rötlichbraunen Punkten, Strichelchen und kleinen Flecken bedeckt sind. Das Weibchen brütet allein, und das Männchen unterhält es inzwischen durch Flugkünste mancherlei Art und fleißiges Singen. Naht man sich langsam dem Neste, so läuft das brütende Weibchen ein ziemliches Stück weg, ehe es sich erhebt, läßt sich jedoch zuweilen auch überraschen und fliegt erst dann ab, wenn man schon unmittelbar vor dem Neste steht. Beide Eltern gebärden sich sehr ängstlich, wenn sie für ihre Brut Gefahr fürchten. Nur wenn die Eier geraubt werden, brütet das Paar zweimal im Jahre. Wenn alles gut geht, findet man Ende Mai die Eier und im Juli die flüggen Jungen.
Um in Südwestafrika Herberge zu nehmen, durchwandert den Nordrand unseres Vaterlandes ein dem Brachpieper verwandter Vogel, der Sporenpieper ( Anthus richardi). Er ist der größte aller in Deutschland vorkommenden Pieper und an dem sehr langen, fast geraden Nagel der Hinterzehe leicht vom Brachpieper zu unterscheiden. Die Länge beträgt zwanzig, die Breite einunddreißig, die Fittichlänge zehn, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Die Oberteile sind dunkelbraun. Die Heimat des Sporenpiepers ist das Steppengebiet Ostasiens, einschließlich Nordchinas. Von hier aus wandert der Vogel allwinterlich nach Süden und erscheint dann in Südchina und in ganz Indien, woselbst er massenhaft gefangen und unter dem Namen Ortolan auf dem Markte von Kalkutta verkauft wird. Derselbe Vogel wandert jedoch auch in westlicher Richtung und berührt hierbei vielleicht alle zu Deutschland gehörigen Nordseeinseln, Dänemark, Südschweden, Großbritannien, Holland, Westfrankreich, Spanien, Portugal und Nordwestafrika. Gätkes sorgfältige Beaufsichtigung der kleinen Insel Helgoland, einer vielbesuchten Herberge am Wege der Zugvögel, hat uns belehrt, daß die Reisen dieses Piepers viel regelmäßiger geschehen, als bisher angenommen wurde. Hinsichtlich der Lebensweise scheint sich der Sporenpieper wenig von seinen deutschen Verwandten zu unterscheiden.
*
Die Lerchen ( Alaudidae) sind kräftig gebaute Sperlingsvögel mit großem Kopfe, kurzem oder mittellangem Schnabel von verschiedener Stärke, ziemlich niedrigen Füßen und mittellangen Zehen, deren hinterste oft einen spornartigen Nagel trägt, langen und sehr breiten Flügeln, nicht besonders langem oder kurzem, meist gerade abgeschnittenem Schwanze und erdfarbenem Gefieder, das nach dem Geschlechte wenig, nach dem Alter sehr verschieden ist.
Obwohl in allen Erdteilen vertreten, gehören die Lerchen doch vorzugsweise der Alten Welt an. Freie Gegenden, das bebaute Feld ebensowohl wie das Unland, die Wüste wie die Steppe bilden ihre Wohnsitze. In den asiatischen Steppen sind sie es, die der oft einförmigen Gegend Sang und Klang verleihen. Ein Paar der einen Art wohnt dicht neben dem andern, und gemeinschaftlicher Gesang füllt im Frühling zu jeder Tageszeit das Ohr des Reisenden. Eine von ihnen sieht man stets am Himmel schweben, sei es auch nur, daß der vorüberfliegende Wagen oder der vorbeieilende Reiter sie aufgescheucht und zu kurzem Sangesfluge begeisterte. Alle im Norden wohnenden Lerchen sind Zug- oder wenigstens Wander-, die im Süden lebenden Stand- oder Strichvögel. Ihre Reisen sind nicht sehr ausgedehnt, und der Aufenthalt in der Fremde währt immer nur kurze Zeit. Sie gehören zu den ersten Vögeln, die der Frühling bringt, und verweilen bis zum Spätherbst bei uns.
Unter allen Sperlingsvögeln sind sie die besten Läufer; aber auch ihr Flug ist durch vielfachen Wechsel ausgezeichnet. Wenn sie Eile haben, fliegen sie in großen Bogenlinien rasch dahin; beim Singen hingegen erheben sie sich flatternd gerade empor oder drehen sich in großen Schraubenlinien zum Himmel auf, senken sich von dort aus erst langsam schwebend hernieder und stürzen zuletzt plötzlich mit ganz eingezogenen Flügeln wie ein lebloser Gegenstand zum Boden herab. Sie sind lebhaft, selten ruhig, vielmehr immer in Bewegung, in gewissem Sinne rastlos. Mit andern ihrer Art leben sie, solange die Liebe nicht ins Spiel kommt, höchst friedfertig, während der Paarungszeit hingegen in fortwährendem Streit. Um fremde Vögel bekümmern sie sich wenig, obwohl einzelne Arten den Schwärmen der Finken und Ammern sich beimischen; stärkere Tiere fürchten sie sehr, den Menschen nur dann nicht, wenn sie sich durch längere Schonung von ihrer Sicherheit vollständig überzeugt haben. Die meisten von ihnen sind gute, einige ganz ausgezeichnete Sänger. Das Lied, das sie vortragen, ist arm an Strophen, aber ungemein reich an Abwechselung; wenige Töne werden hundertfältig verschmolzen und so zu einem immer neuen Ganzen gestaltet. Alle Arten besitzen die Gabe, fremde Gesänge nachzuahmen: in der Steppe singen alle dort wohnenden Lerchen im wesentlichen ein und dasselbe Lied; denn jede lernt und empfängt von der andern.
Die Nahrung besteht aus Kerbtieren und Pflanzenstoffen. Während des Sommers nähren sie sich von Käfern, kleinen Schmetterlingen, Heuschrecken, Spinnen und deren Larven; im Herbste und Winter fressen sie Getreidekörner und Pflanzensämereien, im Frühling genießen sie Kerbtiere und junge Pflanzenstoffe, namentlich die Schößlinge des Getreides. Sie verschlucken die Körner unenthülst und verschlingen deshalb Sand und kleine Kiesel, die die Zerkleinerung der Nahrung befördern. Zum Trunke dient ihnen der Tau auf den Blättern; sie können das Wasser aber auf lange Zeit gänzlich entbehren, baden sich auch nicht in ihm, sondern nehmen Staubbäder.
Das liederlich, aber stets aus der Bodendecke gleichgefärbten Halmen und Grasblättern erbaute, daher trefflich verborgene Nest steht in einer von ihnen selbst ausgescharrten Vertiefung des Bodens; das Gelege enthält vier bis sechs, bei der zweiten Brut drei bis fünf gefleckte Eier.
Allerlei Raubtiere, Säugetiere, Vögel und Kriechtiere, nicht minder auch die Menschen, treten den Lerchen feindlich gegenüber; sie vermehren sich aber so stark, daß alle ihren Bestand treffenden Verluste sich ausgleichen, nehmen auch mit der gesteigerten Bodenwirtschaft stetig zu.
Die Feldlerche ( Alauda arvensis) kennzeichnet sich durch verhältnismäßig schlanken Leibesbau, schwach kegelförmigen, ziemlich kurzen Schnabel, mittellange, spitzige Flügel, einen mittellangen, ausgeschnittenen Schwanz und zarte Füße mit ziemlich kurzen Zehen. Die Länge beträgt achtzehn, die Breite zweiunddreißig, die Fittichlänge zehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Die Federn der Oberteile sind erdbraun, die Unterteile fahlweiß, die Schwingen und die Schwanzfedern braunschwarz. Ganz Europa und ganz Mittelasien, ersteres vom nördlichen Norwegen, und Nordrußland, letzteres von der südlichen Waldgrenze an bis zu den Randgebirgen, sind die Heimat der Feldlerche, die im Winter bis Nordafrika und Südindien wandert. In den Steppen Osteuropas und Nordasiens gesellt sich ihr die etwas größere Spiegellerche ( Alauda sibirica) zu.
Uns gilt die Feldlerche als Frühlingsbote; denn sie erscheint zur Zeit der Schneeschmelze, bisweilen schon Anfang Februar, hat zu Ende dieses Monats meist bereits ihre Wohnplätze eingenommen, verweilt auf ihnen während des ganzen Sommers und tritt erst im Spätherbste ihre Winterreise an, die sie bis Südeuropa, höchstens bis nach Nordafrika führt. Sie ist ein unsteter Vogel, der selten lange an einem und demselben Ort verweilt, vielmehr beständig hin- und herläuft, hin- und wiederfliegt, sich mit andern ihrer Art streitet und zankt und dazwischen lockt und singt. Sie geht gut, bei langsamem Gange nickend, bei raschem Laufe fast wie ein Strandläufer, fliegt ausgezeichnet, je nach dem Zwecke, den sie zu erfüllen trachtet, sehr verschiedenartig, bei eiligem Fluge mit bald angezogenen, bald wieder schwirrend bewegten Schwingen in weiten Bogenlinien dahin, im Singen endlich in der allbekannten langsamen, oft schwebenden Weise mit gleichmäßigen Flügelschlägen, die sie höher und höher heben. Auf dem Boden zeigt sie sich gern frei, stellt sich deshalb auf Erdschollen, kleine Hügelchen oder Steine, zuweilen auch auf die Spitzen eines Strauches, Baumes oder Pfahles, und behauptet solche Lieblingsplätze mit zäher Beharrlichkeit. Der Lockton ist ein angenehmes »Gerr« oder »Gerrell«, dem ein hellpfeifendes »Trit« oder »Tie« zugefügt wird. Bei dem Neste vernimmt man ein helles »Titri«, im Ärger ein schnarrendes »Scherrerererr«. Ihren allbekannten Gesang, der Feld und Wiese der Ebene und des Hügellandes, selbst nicht allzu nasse Sümpfe, in herzerhebender Weise belebt, beginnt die Lerche unmittelbar nach ihrer Ankunft und setzt ihn so lange fort, als sie brütet. Vom frühesten Morgengrauen an bis zur Abenddämmerung singt sie, ein um das andere Mal vom Boden sich erhebend, mit fast zitterndem Flattern allmählich höher und höher aufsteigend, dem Auge zuweilen beinahe entschwindend, ohne Unterbrechung, ausdauernder als jeder andere Vogel, beschreibt dabei weite Schraubenlinien, kehrt allmählich zur Aufgangsstelle zurück, senkt sich mehr und mehr, stürzt mit angezogenen Flügeln wie ein fallender Stein in die Tiefe, breitet hart vor dem Boden die Schwingen und läßt sich wiederum in der Nähe ihres Nestes nieder. Der Gesang besteht zwar nur aus wenigen hellen, reinen, starken Tönen, aber unendlich vielen Strophen, die bald trillernd und wirbelnd, bald hell pfeifend erklingen, von den verschiedenen Sängern aber in mannigfach abändernder Weise vorgetragen, von einzelnen Meistern auch durch nachgeahmte Teile aus andern Vogelliedern wesentlich bereichert werden. Selbst die Weibchen zwitschern, und schon die jungen, erst vor wenigen Wochen dem Neste entflogenen Männchen erproben ihre Kehle.
Mit andern ihrer Art lebt die Feldlerche nur während der Zugzeit und in der Winterherberge im Frieden. Solange die Liebe in ihm mächtig ist, streitet das Männchen eines Paares mit jedem andern, dessen es ansichtig wird, oft sehr hartnäckig. Beide Streiter packen und zausen sich; gar nicht selten aber schlägt sich noch ein drittes Männchen ins Spiel, und dann wirbeln alle drei vereint aus der Höhe zum Boden hernieder. Der Streit erreicht hier zunächst sein Ende, beginnt aber in der nächsten Minute von neuem wieder. Zuweilen gehen zwei Gegner auch zu Fuße aufeinander los und nehmen dabei ähnliche Stellungen an wie kämpfende Haushähne; dabei wird wacker gefochten, freilich ohne wesentlichen Schaden für irgendeinen der Streiter. Der Besiegte muß fliehen, der Sieger kehrt frohlockend zu seinem Weibchen zurück, das, wie Naumann sagt, gar nicht selten »an den Prügeleien des Männchens« teilnimmt. Infolge dieser Zänkereien ist das Brutgeschäft ausgedehnter als notwendig wäre; denn während man bei uns auf den Hektar, kaum zwei Lerchenpaare zählt, leben in der Steppe auf gleich großem Raume dreimal so viel, jedoch stets verschiedenartige Lerchenpaare, deren Männchen zwar ebenfalls untereinander hadern, aber doch verhältnismäßig friedlich nebeneinander hausen.
Das Nest findet man oft schon Anfang März, gewöhnlich auf Getreidefeldern und Wiesen, jedoch auch in Brüchen auf erhöhten Inselchen, die mit Gras oder Seggen bewachsen, sonst aber ganz eng von Wasser umgeben sind. Die kleine Vertiefung, in der das Nest steht, wird im Notfalle von beiden Lerchen selbst ausgescharrt oder wenigstens erweitert und gerundet; dann baut sie das Weibchen unter Mithilfe des Männchens dürftig mit alten Stoppeln, Grasbüscheln, zarten Wurzeln und Hälmchen aus und bekleidet die Nestmulde vielleicht noch mit einigen Pferdehaaren. Das Gelege besteht aus fünf bis sechs Eiern, die zweiundzwanzig Millimeter lang, fünfzehn Millimeter dick und auf grüngelblichem oder rötlichweißem Grunde mit vielen Punkten und Flecken von graulichbrauner oder grauer Farbe sehr ungleichartig gezeichnet sind. Beide Geschlechter brüten abwechselnd und zeitigen die Eier binnen fünfzehn Tagen. Die Jungen entschlüpfen, wenn sie laufen können, dem Neste. Sobald sie selbständig geworden sind, schreiten die Alten zur zweiten, und wenn der Sommer gut ist, zur dritten Brut.
Alle kleinen vierfüßigen Räuber, von der Hauskatze oder dem Fuchse an bis zum Wiesel und der Spitz- und Wühlmaus herab, und ebenso Weihen, Raben, Trappen und Störche gefährden die Lerchenbrut, Baumfalk, Merlin und Sperber auch die alten Vögel. Die Feldlerche nimmt mit der gesteigerten Bodenwirtschaft an Menge zu, nicht aber ab.
Unsere liebliche Heidelerche ( Alauda arborea) ist die kleinste in Deutschland brütende Art ihrer Familie. Ihre Länge beträgt einhundertdreiundfünfzig bis einhundertachtundfünfzig, ihre Breite durchschnittlich zweihundertneunzig, ihre Fittichlänge neunzig, ihre Schwanzlänge vierundfünfzig Millimeter. Oberteile und Flügel sind rostfahlbraun, die rostweißlichen, seitlich bräunlichen Unterteile auf Kropf und Brust mit schmalen, scharfen, auf den Leibesseiten mit undeutlichen Schaftstrichen, die Kehlfedern mit dunklen Punktflecken geziert, Zügel und Schläfenstrich rostweißlich, die Schwingen braunschwarz, die mittleren beiden Schwanzfedern braun, breit rostbraun gerandet, die übrigen schwarz mit weißer Spitze, welche Färbung auf der äußersten ins Blaßbräunliche übergeht und sich verbreitert. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel hornbraun, unterseits rot, der Fuß lichter hornbraun.
Ganz Europa vom mittleren Schweden an und Westasien beherbergen diesen liebenswürdigen Vogel. Aber er beschränkt seinen Aufenthalt mehr als andere Lerchen; denn er gehört den ödesten Heide- und Waldgegenden an. »In den fruchtbaren Feldern weiter Ebenen«, sagt mein Vater, der sie besser als jeder andere geschildert hat, »in den üppigen Laubgehölzen oder in den hochstämmigen Nadelwäldern sucht man die Heidelerche vergebens. Lehden, grasarme Schläge und Bergebenen bis hoch hinaus, wo wenig andere Vögel hausen, sind ihre Wohnplätze. Nach der Brutzeit kommt sie mit ihren Jungen auf die gemähten Wiesen, und auf dem Zuge besucht sie die Brach- und Stoppelfelder der ebenen Gegenden; denn sie macht auf der Wanderung kleine Tagereisen, weil sie Zeit haben muß, die ihr spärlich zugemessene, in kleinen Käfern und winzigen Sämereien bestehende Nahrung aufzusuchen. Sobald der Schnee auf den Bergen geschmolzen ist, in der letzten Hälfte des Februar, kehrt sie von ihrer Wanderung, die gewöhnlich schon in Südeuropa endet, aber auch bis Afrika sich erstreckt, zurück in unser Vaterland und nimmt ihren alten Wohnplatz wieder ein.
In ihrem Betragen ist sie ein allerliebstes Tierchen, rasch und gewandt in ihren Bewegungen; da, wo sie geschont wird, zahm und zutraulich, wo sie Verfolgung erfährt oder auch nur fürchtet, vorsichtig und scheu. Sie läuft hurtig mit kleinen Schritten, etwas emporgerichteter Brust und kleiner Holle, und nimmt sich dabei sehr gut aus. Kommt ein Sperber oder Baumfalk in ihre Nähe, so drückt sie sich, d. h. legt sich platt auf den Boden und gewöhnlich so geschickt in eine kleine Vertiefung, daß sie äußerst schwer zu sehen ist und gewöhnlich der ihr drohenden Gefahr entgeht. Sie setzt sich aber nicht nur, wie ihre Verwandten, fast immer auf den Boden, sondern auch auf die Wipfel und freistehenden Äste der Bäume: daher ihr Name ›Baumlerche‹. Im Frühjahre lebt sie paarweise; weil es aber mehr Männchen als Weibchen gibt, so fehlt es nicht an heftigen Kämpfen, in denen der Eindringling gewöhnlich in die Flucht geschlagen wird. Bei der Paarung zeigt das Männchen seine ganze Liebenswürdigkeit. Es läuft nahe um sein Weibchen herum, hebt den ausgebreiteten Schwanz etwas in die Höhe, richtet die Holle hoch empor, und macht allerliebste Verbeugungen, um ihm seine Ergebung und Zärtlichkeit zu bezeugen.
Ihr zierliches Nest findet man nach der Beschaffenheit der Frühlingswitterung früher oder später, zuweilen schon in den letzten Tagen des März, unter einem Fichten- oder Wacholderbusche oder im Grase. Es ist in einer gescharrten, von Zweigen nicht überdeckten Vertiefung aus zarten, dürren Grashalmen und Grasblättern gebaut, tiefer als eine Halbkugel und inwendig sehr glatt und schön ausgelegt. Das Gelege zählt vier bis fünf, selten drei zwanzig Millimeter lange, fünfzehn Millimeter dicke, weißliche, mit grau- und hellbraunen Punkten und Fleckchen dicht bestreute Eier, die das vom Männchen mit Nahrung versorgte Weibchen allein, aber mit größter Hingebung ausbrütet. Nach der ersten Brut führen beide Eltern ihre Jungen nur kurze Zeit; denn sie machen bald zu einer zweiten Brut Anstalt. Nach dieser vereinigen sie sich mit allen ihren Kindern in eine kleine Gesellschaft und wandern entweder familienweise oder in Flügen, die aus zwei oder mehreren Familien bestehen, die sich zusammengefunden haben. Sie verlassen uns in der letzten Hälfte des Oktober oder Anfang November.
Das Herrlichste an der Heidelerche ist ihr vortrefflicher Gesang. Man ist auf einer Fußreise begriffen und befindet sich in einer öden Gegend, in der vielleicht nicht einmal eine Aussicht in eine schöne Ferne für den Anblick der ärmlichen Pflanzenwelt entschädigen kann. Alles Tierleben scheint gänzlich erstorben. Da erhebt sich die liebliche Heidelerche, läßt zuerst ihren sanften Lockton ›Lullu‹ hören, steigt in die Höhe und schwebt, laut flötend und trillernd, halbe Stunden lang unter den Wolken umher, oder setzt sich auf einen Baum, um dort ihr angenehmes Lied zu Ende zu führen. Noch lieblicher aber klingt dieser Gesang des Nachts. Wenn ich in den stillen Mitternachtsstunden ihren ärmlichen Wohnplatz durchschritt, in weiter Ferne eine Ohreule heulen oder einen Ziegenmelker schnurren, oder einen nah vorüberfliegenden Käfer schwirren hörte und mich so recht einsam in der öden Gegend fühlte, war ich jederzeit hocherfreut, wenn eine Heidelerche emporstieg und ihren schönen Triller erschallen ließ. Ich blieb lange stehen und lauschte auf diese gleichsam vom Himmel kommenden Töne. Gestärkt setzte ich dann meinen Wanderstab weiter. Ich weiß recht gut, daß die Heidelerche zu singen anfing, weil ein innerer Drang sie dazu trieb und sie ihr Weibchen durch ihren Gesang unterhalten und erfreuen wollte; allein es schien mir, als sei sie emporgestiegen, um mir, ihrem alten Freunde, ihre Aufmerksamkeit zu beweisen und ihm die Einsamkeit zu versüßen.«
Die Heidelerche kann sich hinsichtlich ihres Gesanges mit der Nachtigall nicht messen, und dennoch ersetzt sie diese. Das Lied der Nachtigall erklingt nur während zweier Monate, die Heidelerche aber singt von Anfang März bis zum August und nach der Mauser noch in der letzten Hälfte des September und in der ersten des Oktober, und sie singt in den öden, armen Gegenden, im Gebirge, wo außer ihr nur wenige andere gute Sänger wohnen, da, wo sie lebt, kaum ein einziger! Sie ist der Liebling aller Gebirgsbewohner, der Stolz der Stubenvögelliebhaber, die Freude des während der ganzen Woche an die Stube gefesselten, in ihr gefangen gehaltenen Handwerkers; sie verdient reichlich alle Liebe, die ihr wird, allen Ruhm, der sie umstrahlt. Leider nimmt sie nicht an Zahl zu wie Feld- und Haubenlerche, vielmehr in beklagenswerter Weise ab, ohne daß man dafür einen durchschlagenden Grund anzugeben wüßte.
*
Die Haubenlerche, Schopf- und Hauslerche ( Galerita cristata), vertritt eine ihr gleichnamige Sippe ( Galerita), deren Merkmale u. a. in dem gedrungenen Bau des Leibes und der Holle oder Haube auf dem Kopfe begründet sind. Über die Färbung des Gefieders läßt sich schwer Bestimmtes sagen; denn die Haubenlerche ändert sehr ab. Die bei uns in Deutschland wohnenden Lerchen dieser Art sind oberseits auf rötlich lehmbraunem Grunde dunkelbraun, die Unterteile isabellweißlich, auf Brust und Seiten ins Rötliche ziehend, auf Kropf und Brust mit breiten, verwaschenen dunklen Schaftflecken geziert, die Schwingen dunkelbraun, die schwarzbraunen Schwanzfedern außen und am Ende schmal gesäumt, die beiden äußersten an der ganzen Außenfahne roströtlich. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel hornbräunlich, die Wurzelhälfte des Unterschnabels und der Fuß horngelblich. Die Länge beträgt einhundertachtzig, die Breite dreihundertdreißig, die Fittichlänge fünfundneunzig, die Schwanzlänge fünfundsechzig Millimeter. Unsere Haubenlerche bewohnt, mit Ausnahme des hohen Nordens, fast ganz Europa und einen beträchtlichen Teil Afrikas, tritt im Süden häufiger auf als im Norden, verbreitet sich aber auch in Deutschland, den Hochstraßen folgend, von Jahr zu Jahr weiter und nistet sich allmählich da ein, wo sie früher fehlte. In Deutschland bevorzugt sie die Nähe des Menschen, kommt in das Innere der Dörfer und Städte und wird zum Bettler von Scheuer und Küche.

Haubenlerche ( Galerita criststa)
Außer der Begattungszeit ist die Haubenlerche ein stiller Vogel, der sich nur durch seine Allgegenwart bemerkbar macht, im übrigen aber höchst anspruchslos erscheint. Von der Feldlerche unterscheidet sie sich leicht durch ihre gedrungene Gestalt und die spitzige Haube, die sie fast immer aufgerichtet trägt. Im Sitzen und Laufen, auch im Fluge ähnelt sie den übrigen Verwandten sehr. Ihre Stimme ist ein leises »Hoid hoid«, dem ein helles angenehmes »Qui qui« zu folgen pflegt. Der Gesang zeichnet sich durch Abwechslung aus und hat seine Vorzüge, obwohl er weder mit dem der Feldlerche, noch vollends mit dem der Heidelerche verglichen werden kann.
Die Nahrung ist gemischter Art. Im Herbste, im Winter und im Frühling begnügt sie sich mit Gesäme aller Art; im Frühjahr pflückt sie zarte Grasspitzen und andere grüne Kräuter ab.
Das Nest wird auf Feldern, trockenen Wiesen, in Weinbergen, Gärten und an ähnlichen Orten, oft sehr nahe bei bewohnten Gebäuden, in viel besuchten öffentlichen Gärten, selbst auf Bahnhöfen, angelegt, steht aber immer verborgen und ist schwer zu finden. In seiner Bauart unterscheidet es sich wenig von andern Lerchennestern; die vier bis sechs, seltener drei Eier, deren Längsdurchmesser zweiundzwanzig und deren Querdurchmesser fünfzehn Millimeter beträgt, sind auf gelbem oder rötlichweißem Grunde mit sehr vielen aschgrauen und gelbbraunen kleinen Punkten und Flecken über und über bestreut. An einem von ihm gepflegten Haubenlerchenpaare hat Liebe Beobachtungen gesammelt, die die Fortpflanzungsgeschichte dieser und vielleicht aller Lerchen in unerwarteter Weise aufklären. Das Weibchen brütet allein, sitzt aber, wenn die Witterung nicht zu kalt ist, tagsüber wenig auf den Eiern, sondern verläßt sie etwa alle halbe Stunden, um sich zu putzen und um Nahrung zu suchen, da es vom Männchen nicht gefüttert wird. Am dreizehnten Tage schlüpfen die Jungen aus und werden, obgleich sie nur spärlich mit Flaum bedeckt sind und die violettschwärzliche Haut allenthalben durchschimmert, doch wenig gehudert. Nur des nachts oder bei rauhem Wetter sitzt die Alte fest auf dem Nest. Das Männchen beteiligt sich bloß mittelbar bei der Fütterung, indem es Kerbtiere zusammensucht, mit dem Schnabel zubereitet und sodann dem Weibchen vorlegt, damit dieses sie verfüttere. Am neunten Tage laufen die Jungen aus dem Neste und kehren nicht wieder dahin zurück. Ihr Gang ist zuerst ein unbeholfenes Hüpfen, und erst vom zwölften Tage ab lernen sie nach Art ihrer Eltern laufen. Des Nachts verstecken sie sich in einer Bodenvertiefung, werden hier aber von der Alten nicht gehudert, sondern vom Männchen mit einigen Halmen und dürren Blättern zugedeckt. Auch jetzt füttert der Vater nur selten selbst und begnügt sich damit, der Mutter die für die Jungen bestimmte Atzung vorzulegen. Er beteiligt sich aber anderweitig bei der Fütterung. Wenn nämlich die Mutter mit vollem Schnabel ankommt und vergeblich nach den Jungen sucht, ruft er sie mit lauter Stimme, worauf jene leise, aber deutlich genug, um von der Mutter gehört zu werden, antworten. Am vierzehnten Tage nach dem Ausschlüpfen versuchen die Jungen ihre Schwingen, und am sechzehnten Tage können sie schon über ziemlich weite Strecken hinweg fliegen. Sobald sie selbständig geworden sind, schreiten die Eltern zur zweiten und beziehentlich dritten Brut.
Die Haubenlerche genießt insofern ein glücklicheres Los, als sie nicht in so großer Menge wie die Feldlerche für die Küche gefangen und außerdem kaum verfolgt wird. Ihre Feinde sind dieselben, die auch andern Erdvögeln nachstellen. Im Käfige hält man sie selten.
*
Von dem uns geläufigen Gepräge weichen die Stelzenlerchen ( Alaemon) wesentlich ab. Hierher gehört die Wüstenläuferlerche ( Alaemon desertorum). Sie ist oberseits isabellrötlich und unterseits weiß. Die Länge beträgt zweiundzwanzig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge neun Zentimeter. Das Verbreitungsgebiet der Läuferlerche, die wiederholt auch in Südeuropa erlegt wurde, umfaßt ganz Nordostafrika und Westasien, Palästina, Persien und Sindh. Sie ist in allen Wüsten Nordostafrikas nicht gerade selten; in der Steppe habe ich sie jedoch nie bemerkt. Ich fand sie höchstens in kleinen Familien zu vier bis sechs Stück, niemals in Flügen, gewöhnlich in Paaren. Von diesen wohnt eines dicht neben dem andern, und wie es scheint, besuchen sich die Nachbarn oft gegenseitig in aller Freundschaft.
In ihrem Betragen ist die Wüstenläuferlerche ein wirkliches Mittelglied zwischen ihren engeren Verwandten und den Rennvögeln. Sie läuft absatzweise, ungemein rasch, viel mehr strandläufer- als lerchenartig, fast ganz wie der Wüstenrennvogel, fliegt leicht, viel schwebend und sehr oft schnurgerade, nicht langsam steigend wie andere Lerchen, sondern mit jähen Flügelschlägen rasch in die Höhe, schwebt einige Augenblicke lang auf einer und derselben Stelle und läßt sich plötzlich mit zusammengelegten Flügeln wieder zum Boden oder auch wohl auf einen Busch herabfallen, springt von diesem sodann auf den Boden hernieder und läuft nun eilfertig weiter. Dieses Spiel wiederholt sie unter Umständen mehrmals kurz hintereinander. Die Paare halten außerordentlich treu zusammen, rennen stets dicht nebeneinander dahin und erheben sich fast gleichzeitig. Vor dem Menschen scheut sich die Wüstenläuferlerche nicht im geringsten. Den Jäger läßt sie nahe an sich herankommen; Verfolgung aber macht sie bald außerordentlich scheu. Ihre Stimme ist ein traurig-klagendes Pfeifen, ihr Gesang eigentlich nichts anderes als eine mehrfache Wiederholung des Lockrufes, an die sich ein Triller reiht. Das Ei hat einen Längsdurchmesser von fünfundzwanzig, einen Querdurchmesser von achtzehn Millimeter und ähnelt dem gewisser Spielarten unseres Raubwürgers. Bemerkt mag noch sein, daß dieser Vogel, ebenso wie andere der Wüste angehörige, Wasser gänzlich entbehren zu können scheint, da man ihn oft viele Kilometer von demselben entfernt auf den verbranntesten Stellen der dürrsten Wüsten antrifft. Im Magen der von mir erlegten Läuferlerche fand ich nur Kerbtiere; demungeachtet will ich nicht behaupten, daß der Vogel Sämereien verschmähe.
*
Ein herrlicher und deshalb hochgeschätzter Sänger Südeuropas, die Kalanderlerche ( Melanocorypha calandra), ist der Vertreter der Sippe der Ammerlerchen ( Melanocorypha). Ihre Länge beträgt bis einundzwanzig, die Breite bis vierundvierzig, die Fittichlänge dreizehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Die Federn der Oberteile sind fahlbräunlich, Kehle Kopf und Brust zart rostgelblich, letztere mit feinen dunklen Schaftstrichen geziert, die übrigen Unterteile weiß. Südeuropa, insbesondere die Umgebung des Mittelmeeres, ist die Heimat der Kalanderlerche.
In ihrem Betragen unterscheidet sie sich nicht wesentlich von unserer Feldlerche. Bestimmt zu unterscheiden ist sie von unserer und allen andern mir bekannten Lerchen an ihrem aufrechten Gang und den zwar etwas langsamen, aber ungemein kräftigen Bewegungen ihrer sehr breiten Flügel, die in Verbindung mit dem sie unterseits säumenden lichteren Erdrande ihrem Flugbilde ein so bezeichnendes Gepräge aufdrücken, daß man sie nie verkennen kann. Ebenso kennzeichnet sie sich durch ihren herrlichen Gesang. Wer sie zum ersten Male singen hört, bleibt überrascht stehen, um ihr sodann mit Entzücken zu lauschen. Ihr Lied zeichnet sich vor allen mir bekannten Lerchengesängen durch einen wunderbaren Reichtum und ebenso große Fülle und Kraft aus. In der Steppe vereinigt, verschmilzt, vertönt sie aller dort lebenden Gesänge in dem ihrigen, gibt sie veredelt wieder und beherrscht hierdurch wie durch ihre gewaltige Stimme den wunderbaren Lerchengesang, der hier während der Frühlingszeit ununterbrochen vom Himmel herabströmt. Nicht alle erringen sich vollen Ruhm, denn nicht alle verwenden ihre unerschöpflichen Stimmittel in einer unserem Ohre wohltuenden Weise; einzelne aber sind geradezu unvergleichliche Meister in ihrer Kunst, die man gehört, im Freien gehört haben muß, um ihre Bedeutung gebührend zu würdigen.
Um die auch in Spanien hochbeliebte Sängerin zu fangen, geht man hier des Nachts auf geeignete Feldstücke; einige der Fänger tragen Herdenglocken, andere Blendlaternen, die übrigen Handnetze. Die Lerchen werden durch den Lichtschimmer geblendet, durch den Klang der Herdenglocken aber irregeführt und zu der Meinung verleitet, daß ihnen eine Rinder- oder Schafherde nahe. Sie warten die Ankunft der Fänger ruhig ab, drücken sich auf den Boden nieder und werden dann entweder mit den Netzen überdeckt oder sogar mit der Hand gegriffen. Mein Bruder hat derartigem Fange beigewohnt.
*
Die Wüste hat ebenfalls ihre Lerchen, diese aber sind ebenso gefärbt, wie der Sand selber. Zur Sippe der Sandlerchen ( Ammomanes) gehört die Wüstenlerche ( Ammomanes deserti). Sie ist oberseits graulich zimtbräunlich, auf dem Bürzel roströtlich, unterseits isabellweißlich. Die Länge beträgt einhundertsechzig, die Breite zweihundertdreißig, die Fittichlänge fünfundzwanzig, die Schwanzlänge fünfundsechzig Millimeter. Das Verbreitungsgebiet der Wüstenlerche umfaßt den größten Teil Nord- und Nordostafrikas, Westasien und Mittelindien; als Besuchsvogel erscheint sie zuweilen, immer aber sehr selten in Südeuropa, wird von Erhard jedoch unter den Sommervögeln der Kykladen aufgezählt.
Ich habe die Wüstenlerche während meines Aufenthalts in Afrika in ganz Ägypten und Nubien überall in der Wüste angetroffen. Sie meidet das bebaute Land und findet sich erst da, wo der dürre Sand der belebenden Kraft des Wassers zu spotten scheint. Im Sande verschwindet sie dem Auge ihrer Feinde, im Sande findet sie ihre Nahrung; der Wüste gehört sie vollständig und ausschließlich an. Ihren Ruf vernimmt man schon in Oberägypten, sobald man den Fuß über den letzten Damm setzt, der die dem Strome enthobenen fruchtbaren Fluten vor dem nach ihnen verlangenden Sande schützt; sie ist es, der man zwischen den großartigen Zeichen vergangener Zeiten des Pharaonenlandes begegnet; sie ist es, die in den hehren Räumen der Tempel wie ein aus alter Zeit zurückgelassener, verwandelter Priester der Isis waltet; sie ist es aber auch, die im Zelte des braunen Nomaden förmlich als Hausvogel auftritt. Sie ist ein liebenswürdiges, aber ein stilles, ernstes Tierchen. Der Lauf ist äußerst rasch, der Flug behend und gewandt, obwohl etwas flatternd. Der gewöhnliche Lockruf hat etwas so Schwermütiges, daß man über diesem Eindrucke fast den ihm eigenen Wohllaut vergißt. Sie tritt, wo sie vorkommt, häufig auf, lebt gewöhnlich paarweise, mit andern ihrer Art friedlich zusammen, seltener zu Flügen geschart. Einige hundert Geviertmeter Sandfläche, ein paar Steine darauf und ein wenig dürftiges Riedgras zwischen ihnen genügen ihr, und vergeblich fragt man sich, wie solcher, dem menschlichen Auge vollkommen tot erscheinender Wohnsitz dem Vogel Heimat sein, wie er ihn ernähren könne. Und doch muß dies der Fall sein, denn jedes Paar hängt treu an dem einmal erwählten Wohnorte. Wenn man diesen mehrere Tage nacheinander besucht, wird man diese Lerche fast immer an derselben Stelle, ja auf demselben Steine finden.
In den ersten Monaten des Jahres schreitet die Wüstenlerche zur Fortpflanzung. Ihr Nest steht entweder wohlverborgen unter einem überhängenden Steine, in einer Vertiefung oder in einem Grasbusche, ist recht zierlich gebaut und enthält im Frühlinge drei bis vier zweiundzwanzig Millimeter lange, sechzehn Millimeter dicke Eier, die auf gelblichem Grunde, zumal gegen das dicke Ende hin, braun und rot gefleckt sind. Das Männchen bekundet seine Liebe durch einen leisen, hübschen, jedoch ziemlich armen Gesang, aus dem der erwähnte schwermütige Lockton am häufigsten wiedertönt. Nach dem Singen umgeht es sein Weibchen mit etwas von dem Körper abgehaltenen Flügeln; dann fliegen beide zusammen gewöhnlich auf den höchsten Punkt ihres Wohnortes, auf einen der Steine z. B., und das Männchen beginnt von neuem zu singen.
Die Wüstenlerche scheut den Menschen nicht. Mit innigem Vergnügen bin ich ganz nahe an sie herangegangen, und mit wahren Entzücken habe ich gesehen, wie sie vertrauensvoll in das Zelt eines Wanderhirten kam, der sich an einem Brunnen der Bahiuda zeitweilig aufhielt. Dem Araber fällt es nicht ein, dem traulichen Vogel feindselig entgegenzutreten, und auch der Europäer gewinnt ihn bald so lieb, daß er sich förmlich scheut, ihn zu erlegen.
*
Eine der anmutigsten aller Arten der Familie ist die Alpenlerche, Küsten- oder Hornlerche ( Phileremus alpestris), Vertreter der Sippe der Hornlerchen ( Phileremus). Ihre besonderen Merkmale sind zwei kleine Federohren an den Seiten des Hinterkopfes und die eigenartig bunte Zeichnung. Ihre Länge beträgt siebzehn, die Breite zweiunddreißig, die Fittichlänge elf, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Stirne, Augenstreifen, Kinn und Kehle sind blaßgelb, eine Querbinde auf dem Hinterkopfe, Zügel und Ohrgegend sowie ein breiter halbmondförmiger Kropfschild schwarz, Oberkopf, Hinterhals und Oberflügeldecken zartweinrötlich, die übrigen Oberteile erdbraun, durch dunkle Schaftflecke gezeichnet, die Unterteile weiß, seitlich weinrötlich, die Schwingen braun, die Schwanzfedern, mit Ausnahme der beiden dunkelbraunen, fahlbraun gesäumten Mittelfedern, schwarz, die beiden äußersten außen weiß. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel bläulichgrau, der Fuß hornbraun. Beim Weibchen ist das Gelb im Gesichte und auf der Kehle blasser, die schwarze Querbinde auf dem Kopfe nicht vorhanden.
Die Alpenlerche trägt ihren Namen nicht von den Schweizer, sondern von den Nordischen Alpen. Sie ist ein Kind der Tundra und gegenwärtig in diesem Gebiete überall Brutvogel, demgemäß ebensowohl in der Neuen wie in der Alten Welt zu Hause. In Finnmarken oder Norwegisch Lappland lebt sie, nach meinen Beobachtungen, keineswegs auf den höheren Gebirgen, sondern von der Seeküste an bis zu höchstens anderthalb hundert Meter unbedingter Höhe aufwärts, findet sich hier aber nur auf steinigem Grunde, in menschenleersten Einöden ebensowohl wie in unmittelbarer Nähe von den Wohnungen. Wenige Schritte hinter dem Hause des Kaufmanns und Naturforschers Nordvy traf ich ein nistendes Pärchen an, das um die Mitte des Juli bereits zum zweiten Male Junge erzeugt hatte. Der kundige Vogelfreund sagte mir, daß diese schöne Lerche noch während seiner Knabenjahre zu den seltensten Erscheinungen gehört habe, allgemach aber eingewandert sei und jetzt als Sommervogel überall vorkomme. Zu Ende des Oktober verläßt sie die Tundra Lapplands, um die Mitte des September ihre nordsibirischen Brutstätten; hier kehrt sie schwerlich vor Anfang Mai, dort in der Mitte des April zurück. Zu Ende dieses Monats haben die in Finnmarken hausenden Paare das Nest bereits gebaut und gewöhnlich auch schon Eier. Gelegentlich ihrer Winterreise besucht sie gegenwärtig regelmäßig Deutschland, namentlich die Ostseeküste, und es scheint, daß dies, seitdem sie sich in Finnmarken angesiedelt, viel öfter geschieht, als es früher der Fall war. Nach mündlichem Berichte des jüngeren Schilling gehört sie jetzt auf Rügen und den benachbarten Inseln, namentlich auf Hiddensöe, zu den Erscheinungen, die jeder Winter bringt; nach Versicherung kundiger Freunde wandert sie alljährlich durch Ost- und Westpreußen; ebenso hat sie Gätke sehr häufig auf Helgoland in Scharen von sechzig, achtzig bis hundert Stück beobachtet. Wie weit sie im Winter nach Süden oder Südwesten hin vordringt, bedarf noch der Feststellung. Radde fand sie um diese Zeit auf den Hochsteppen Dauriens, im Gouvernement Cherson und in Bessarabien; Barthélemy-Lapommeraye erwähnt, daß sie einige Male in der Provence, Salvadori, daß sie wiederholt in Italien vorgekommen ist.
In ihrem Wesen und Betragen hat die Alpenlerche so große Ähnlichkeit mit der Feldlerche, daß ich keinen wesentlichen Unterschied wahrnehmen konnte. Doch sah ich jene niemals singend in die Luft steigen, vielmehr entweder von Steinen oder Baumzweigen herab ihr einfaches, aber ansprechendes Liedchen vortragen; laut Collett steigt jedoch auch sie und singt dabei ganz anders als im Sitzen. Die Nahrung besteht aus Pflanzenstoffen, zumal Sämereien, und Kerbtieren, namentlich aus den in allen Tundren so überaus häufigen Mücken und deren Larven, mit denen auch die Jungen aufgefüttert werden.
Das verhältnismäßig kunstreiche Nest wird zwar ebenfalls in einer Vertiefung des Bodens angelegt, innen aber mit feinen Halmen und selbst mit Pflanzenwolle und zarten Samenhülsen sehr nett ausgelegt. Das Gelege enthält vier bis fünf Eier, die etwa zweiundzwanzig Millimeter lang, siebzehn Millimeter dick und auf gelblichem Grunde mit außerordentlich feinen Strichelchen von etwas dunklerer Farbe, am dicken Ende oft kranzartig, gezeichnet sind. Einige Eier zeigen auch wohl schiefergraue Schalenflecke oder dunkelbraune Haarzüge. Das Nest ist schwer aufzufinden, weil die Tundra sehr gute Versteckplätze bietet. Ob nur die Weibchen oder abwechselnd beide Geschlechter brüten, weiß ich nicht, wohl aber, daß die Alpenlerche Störungen nicht verträgt, vielmehr infolge deren Nest und Eier verläßt.
Gefangene Alpenlerchen sind anmutig in einem kleinen Raume, viel anmutiger noch in dem Gesellschaftsbauer, vertragen sich mit andern Vögeln nicht nur vortrefflich, sondern scheinen sogar an deren Gesellschaft Freude zu haben, dauern auch lange Jahre aus.
Unserem Edelfinken zuliebe benennen wir eine viele Hunderte Arten umfassende, mit alleiniger Ausnahme Australiens über alle Erdteile verbreitete Familie, die der Finken ( Fringillidae). Ihr Schnabel ist kegelförmig, verschieden dick, an der Wurzel mit einem mehr oder minder deutlichen Wulste umgeben, der Oberschnabel oft ein wenig länger als der untere und mit schwachem Haken über diesen herabgebogen, ausnahmsweise auch mit letzterem gekreuzt, an den Schneiden bis zum Mundwinkel eingezogen, der Fuß mäßig lang, meist ziemlich kurzzehig und durchgehends mit schwachen Nägeln bewehrt, der Lauf hinten mit ungeteilten Schienen bekleidet, der Handteil des Fittichs stets mit neun Schwingen besetzt, der Flügel übrigens verschieden lang, der Schwanz immer kurz, höchstens mittellang, das Gefieder, mit wenigen Ausnahmen, dicht anliegend, nach Geschlecht und Alter in der Färbung meist erheblich, zuweilen auch gar nicht verschieden.
Innerhalb der angegebenen Grenzen bewohnen die Finken alle Gürtel der Breite und Höhe, alle Örtlichkeiten von der Küste des Meeres an bis zu den höchsten Spitzen der Berge hinauf, einsame Inseln nicht minder als volksbelebte Städte, die Wüste wie den Wald, nacktes Gestein wie alle denkbaren Pflanzenbestände. Viele von den nordischen Arten sind Zugvögel, die im Süden des gemäßigten Gürtels und in den Gleicherländern lebenden ausnahmslos Standvögel; aber auch viele von denen, die im Sommer auf eisigen Gefilden ihre Nahrung finden und nisten, verlassen dieselben nicht, so streng der Winter sein möge. Die wandernden Arten stellen sich mit der Schneeschmelze ein und meiden die Heimat erst, wenn der Winter in sie einzieht.
Alle Finken sind sehr geschickte Läufer oder richtiger Hüpfer, gute Flieger und größtenteils angenehme, einzelne von ihnen sogar vortreffliche Sänger, ihre Sinne wohlentwickelt und sie daher vortrefflich befähigt, die verschiedensten Örtlichkeiten auszunutzen. Meist gesellig, leben viele unter sich doch nur im Herbste und Winter friedfertig zusammen, wogegen auf den Brutplätzen erbitterter Streit nie endet. Solcher hat immer nur in Eifersucht seinen Grund; denn Futterneid, obwohl auch ihnen nicht fremd, erregt sie nicht in besonderem Grade. Sämereien der verschiedensten Pflanzen und im Hochsommer Kerbtiere bilden ihre Nahrung, letztere auch vorzugsweise die Atzung der Jungen; an beiden aber fehlt es selten, und wenn es wirklich der Fall ist, einigt die gemeinsame Not. Fast alle Arten bauen sorgsam hergestellte, dickwandige, außen und innen zierlich gestaltete, sauber ausgekleidete Nester aus verschiedenen pflanzlichen und tierischen Stoffen, brüten zweimal, einzelne auch dreimal im Jahre, legen fünf bis acht auf lichterem Grunde dunkler gefleckte und gestrichelte Eier, ziehen demnach eine zahlreiche Nachkommenschaft heran und gleichen somit die vielen Verluste aus, die allerlei Raubtiere ihrem Bestand zufügen. Ihrer Anspruchslosigkeit und leichten Zähmbarkeit halber eignen sie sich mehr als die meisten Angehörigen ihrer Ordnung zu Käfigvögeln. Von altersher sind sie Haus- und Stubengenossen des Menschen, und einzelne von ihnen werden, wenigstens hier und da, noch mehr als die Nachtigall geschätzt, verehrt, ja förmlich vergöttert. Eine Art ist sogar zum förmlichen Haustiere Der Kanarienvogel. Herausgeber. geworden, hat sich als solches die ganze Erde erobert und belebt durch seinen angenehmen Gesang das einsamste Blockhaus auf frisch gerodeter Waldstelle wie das Dachstübchen des Arbeiters. Mehr als ein Fink gehört in Deutschland zum Hause, zur Familie, läßt diese ihre Armut vergessen und erheitert den arbeitsmüden Mann durch den belebenden, frischen Klang, den sein Lied in die Werkstatt bringt.
Die erste hierhergehörige Unterfamilie bilden die Ammern ( Emberizinae), eine an Sippen reiche, sehr übereinstimmende Gruppe. Die Ammern gehören ihrer Hauptmenge nach der Nordhälfte der Erde an und leben größtenteils in niederem Buschwerk oder Röhrichte. Als Verbindungsglieder zwischen Lerchen und Finken dürfen die Sporenammern ( Plectotrophanes) angesehen werden. Ihre Merkmale liegen in den kräftigen Gehfüßen, deren Hinterzehe einen ihr an Länge gleichen Sporn trägt. Bei den Sporenammern ( Plectrophanes lapponicus) sind Kopf, Kinn und Kehle schwarz, die übrigen Oberteile rostbraun durch schwarze Schaftflecke gezeichnet, Halsseiten und Unterteile weiß. Die Länge beträgt sechzehn, die Breite siebenundzwanzig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.
Die Sporenammer ist ein Kind der Tundra, ihr Verbreitungsgebiet daher über den Norden beider Welten ausgedehnt. Von hier aus wandert sie im Winter so weit nach Süden hinab, als sie unbedingt muß, erscheint schon in Deutschland nur ausnahmsweise, weiter südlich höchstens als verflogener Irrling, und kehrt, sobald sie irgend kann, wieder in ihre rauhe Heimat zurück. Hier ist sie allerorten überaus häufig, macht auch zwischen der Tiefe und Höhe kaum einen Unterschied, vorausgesetzt, daß die Zwergbirke eine filzige Bodendecke bildet, wie sie sie liebt.
Die verwandte Schneeammer ( Plectophanes nivalis), ist im Sommer schneeweiß, auf Mantel, Schultern, Handschwingen und den mittelsten vier Schwanzfedern aber schwarz, im Winter dagegen auf Ober- und Hinterkopf sowie in der Ohrgegend rostzimmetbraun. Ungefähr dieselben Länder, die die Sporenammer beherbergen, sind auch die Heimat der Schneeammer. Ihr Verbreitungsgebiet ist umfassender, ihr Brutgebiet dagegen beschränkter als das der genannten. Sie bewohnt die Hochtundra, nach Norden hin, soweit sie, und wenn auch nur für einige Wochen, schneefrei wird, immer aber die nächste Nachbarschaft des ewigen Schnees. Ihre Winterreise führt sie bis Süddeutschland, zuweilen noch weiter südlich, in Asien bis Südsibirien und Mittelchina, in Amerika bis in die mittleren Vereinigten Staaten. Gebirgshalden und felsige Berge bilden ihre Wohnsitze. Hier verlebt sie ihr kurzes Sommerleben, hier liebt und brütet sie. Das Nest wird stets in Felsspalten oder unter großen Steinen angelegt, besteht äußerlich aus Grashalmen, Moos und Erdflechten und ist inwendig mit Federn und Dunen ausgefüttert, der Eingang, wenn tunlich, nicht größer, als daß die Eltern bequem aus- und einschlüpfen können. Das Gelege besteht aus fünf bis sechs Eiern von durchschnittlich zweiundzwanzig Millimeter Länge und sechzehn Millimeter Dicke, die vielfach abändern, gewöhnlich aber auf bläulichweißem Grunde mit dunkel rostbraunen, gegen das dicke Ende hin kranzartig sich häufenden Flecken, Punkten und Streifen gezeichnet sind. Schon Ende April läßt das Männchen, auf der Spitze eines Steines sitzend, seinen kurzen, aber hell tönenden und angenehmen Gesang hören. Bald nach der Brutzeit schlagen sich die Paare mit ihren Jungen in große Flüge, die noch eine Zeitlang in der Heimat verweilen, dann aber ihre Winterreise antreten. An der Brutstelle ernähren sie sich fast ausschließlich von Kerbtieren, zumal Mücken; während des Winters müssen sie sich mit Gesäme begnügen.
Wenig andere Vögel reisen in so ungeheuren Gesellschaften wie die Schneeammern. Auch Deutschland besuchen sie fast allwinterlich, aber nur selten in solchen Massen wie den hohen Norden. In Rußland nennt man sie »Schneeflocken«, und dieser Ausdruck ist für sie bezeichnend; denn in der Tat Wirbeln sie wie Schneeflocken vom Himmel hernieder und bedecken Straßen und Felder. Zuweilen erscheinen sie auch massenhaft auf Schiffen, um hier einige Augenblicke von ihrer Wanderung auszuruhen. »Am siebzehnten Mai«, sagt Malmgren, »schlug auf der Takelage unseres Fahrzeuges ein Schwärm von Schneeammern nieder, die sehr ermüdet zu sein schienen. Sie gaben sich jedoch nicht lange Zeit zum Ausruhen, sondern begannen von neuem ihren mühevollen Zug, bei starkem Gegenwinde gerade auf Spitzbergen zu.« Ähnliche Erfahrungen haben auch andere Reisende, namentlich Holboell, gemacht. Es geht aus diesen Angaben zur Genüge hervor, daß unsere Ammern einen weiten Flug, selbst über das Meer hinweg, nicht scheuen.
Die Schneeammern ähneln in ihrem Betragen den Lerchen ebenso sehr wie den Ammern. Sie laufen ganz nach Lerchenart, fliegen leicht und geschickt, wenig flatternd und in großen Bogenlinien, auf der Reise in bedeutender Höhe, sonst gern dicht über den Boden dahin. Gesellschaften, die Nahrung suchen, wälzen sich, wie Naumann sagt, über die Erde dahin, indem nur ein Teil sich niederläßt und die letzteren über die ersteren dahinfliegen. Sie sind unruhige, bewegliche Vögel, die auch während der strengsten Kälte ihre Munterkeit nicht verlieren und selbst bei entschiedenem Mangel noch vergnügt zu sein scheinen. Selten nur verweilen sie an einem und demselben Orte längere Zeit, durchstreifen vielmehr gern ein gewisses Gebiet. Bei tiefem Schneefall suchen sie die Straßen auf und kommen selbst in die Städte herein; solange sie jedoch auf den Feldern noch Nahrung finden können, wählen sie diese zu ihrem Winteraufenthalt und treiben sich hier während des ganzen Tages in der beschriebenen Weise umher. Ihre Lockstimme ist ein hell pfeifendes »Fit« und ein klingendes »Zirr«, der Gesang des Männchens ein Gezwitscher, das in manchen Teilen dem Gesang der Feldlerche ähnelt, sich aber durch laute, scharf schrillende Strophen unterscheidet. Auf ihren Brutplätzen singen sie, auf dem Schnee oder noch lieber auf Steinen sitzend. Gefangene dauern selten lange im Käfige aus, weil ihnen unser Klima zu warm ist.
*
Zur Sippe der Ammern im engern Sinne ( Emberiza) gehört unsere Rohrammer ( Emberiza schoeniclus). Bei ihr sind Kopf, Kinn und Kehle bis zur Kropfmitte herab schwarz, ein Bartstreifen, ein den Hals umgebendes Nackenband und die Unterteile weiß, Mantel und Schultern von Grau in Schwarzbraun übergehend, durch die rostbraunen Seitensäume der Federn angenehm gezeichnet, die Schwingen braunschwarz, die Steuerfedern schwarz. Der Augenring ist tiefbraun, der Schnabel dunkelbraun, der Fuß bräunlich. Beim Weibchen ist der Kopf rotbraun, Kinn und ein breiter Bartstreifen rotweiß, einen undeutlichen schwarzen, rostbraun gesäumten Kehlfleck einschließend, Hinterhals, Kropf und Seiten endlich rostbräunlich, dunkel längsgestrichelt. Die Länge beträgt einhundertundsechzig, die Breite zweihundertunddreißig, die Fittichlänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge fünfundfünfzig Millimeter. Das Verbreitungsgebiet umfaßt ganz Europa und Westasien. Hier fehlt die Rohrammer nur dem Gebirge. Doch herbergt sie ausschließlich da, wo sumpfige Orte mit hohen Wasserpflanzen, Rohre, Schilfe, Riedgrase, Weidengestrüppe und ähnlichen Sumpfgewächsen bestanden sind, also mit andern Worten an Teichen, Flüssen, Seeufern, in Morästen und auf nassen Wiesen. Hier brütet sie auch.
Das Nest wird sehr versteckt auf dem Boden kleiner Inseln und anderer wasserfreien Erdstellen zwischen Wurzeln und Gras errichtet, gewöhnlich aus allerlei Halmen und Ranken, Grasstoppeln und dürren Grasblättern liederlich zusammengebaut und innerlich mit einzelnen Pferdehaaren oder mit Rohr- und Weidenwolle ausgelegt. Zweimal im Sommer, im Mai oder Anfang Juli, findet man vier bis sechs niedliche, sehr abändernde, durchschnittlich neunzehn Millimeter lange, vierzehn Millimeter dicke, auf grauweißem, ins Bräunliche oder Rötliche spielenden Grunde mit aschgrauen bis schwarzbraunen, schärferen oder verwaschenen Flecken, Punkten und Äderchen bezeichnete Eier. Das brütende Weibchen sitzt so fest über denselben, daß man es fast mit der Hand fangen kann; das Männchen kommt, sobald man sich dem Neste nähert, ängstlich herbeigeflogen und schreit kläglich. Die Jungen werden in üblicher Weise ernährt und erzogen.
Die Rohrammer, ein munterer, netter Vogel, ist behender und gewandter als seine Verwandten, klettert geschickt im Rohre auf und nieder und weiß sich auf den schwächsten Zweigen oder Halmen sitzend zu erhalten, hüpft rasch auf dem Boden dahin, fliegt schnell und leicht, obgleich zuckend, schwingt sich beim Ausfliegen hoch empor und stürzt sich beim Niedersetzen plötzlich herab, tummelt sich auch oft in schönen Bogen über dem Röhricht. Ihr Lockton ist ein helles, mehr als üblich gedehntes »Zie«, der Gesang, wie Naumann sehr bezeichnend sagt, stammelnd, denn »die Rohrammer würgt die einzelnen Töne hervor«. Dafür singt sie sehr fleißig, und dieser Eifer befriedigt.
Während ihres Sommerlebens nährt sich auch die Rohrammer fast ausschließlich von Kerbtieren, die im Rohr, im und am Wasser leben; im Herbst und Winter bilden die Gesäme von Rohr, Schilf, Binsen, Seggengras und andern Sumpfpflanzen ihre Kost. Bald nach der Brutzeit sammelt sie sich zu kleinen Flügen, besucht ab und zu Felder, steigt an Hirsenstengeln oder Getreidehalmen in die Höhe und klaubt die Samen aus den Rispen. Mit Eintritt der rauhen Witterung verläßt sie die nördlichen Gegenden und sucht in den Rohrwäldern oder auf den mit höheren Gräsern und Disteln bestandenen Flächen Südeuropas Winterherberge.

Ammern ( Emberiza).
Unter den übrigen deutschen Arten der Sippe mag die schwerleibige Grauammer ( Emberiza miliaria) zunächst genannt sein. Ihre Länge beträgt neunzehn, ihre Breite neunundzwanzig, ihre Fittichlänge neun, ihre Schwanzlänge sieben Zentimeter. Die Oberteile, mit Ausnahme der einfarbigen Bürzel- und Schwanzdeckfedern, sind auf erdbräunlichem Grunde mit dunklen Schaftstrichen gezeichnet, Zügel und undeutlicher Schläfenstrich fahlweiß, Backen- und Ohrgegend auf bräunlichem Grunde dunkel längsgestrichelt, Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel horngelb, der Fuß blaßgelb.
Vom südlichen Norwegen an begegnet man in ganz Europa und ebenso im westlichen Asien der Grauammer an geeigneten Orten überall, entweder als Stand- oder wenigstens als Strichvogel. Auf dem Zuge geht sie einzeln oder in Scharen bis nach Nordafrika hinüber, ist dann in Ägypten nicht selten und auf den Kanarischen Inseln gemein. Ihre Sommerwohnsitze sind weite, fruchtbare, mit Getreide bebaute Ebenen, ihre beliebtesten Aufenthaltsorte Gegenden, in denen Feld und Wiese miteinander abwechseln und einzelnstehende Bäume und Sträucher vorhanden sind. In größeren Waldungen sieht man sie ebensowenig als auf Gebirgen. In Norddeutschland ist sie nirgends selten; in Mitteldeutschland verbreitet sie sich, allmählich einwandernd, mehr und mehr; in den reichen Getreideebenen Österreichs und Ungarns ist sie, wenn nicht der häufigste aller Vögel, so doch die häufigste aller Ammern.
Der gedrungene, kräftige Leib, die kurzen Flügel und die schwachen Beine lassen vermuten, daß die Grauammer ein schwerfälliger Gesell ist. Sie hüpft am Boden in gebückter Stellung langsam umher, zuckt dazu mit dem Schwanze und fliegt mit Anstrengung unter schnurrender Flügelbewegung in Bogenlinien, jedoch immer noch schnell genug, weiß auch mancherlei geschickte Wendungen, die man ihr nicht zutrauen möchte, auszuführen. Ihre Lockstimme, die beim Auffliegen oft wiederholt und auch im Fluge häufig ausgestoßen wird, ist ein scharfes »Zick«, der Warnungsruf ein gedehntes »Sieh«, der Ton der Zärtlichkeit ein sanfteres »Tick«, der Gesang weder angenehm noch laut, dem Geräusche, das ein in Bewegung gesetzter Strumpfwirkerstuhl hervorbringt, in der Tat ähnelnd, da auf ein wiederholtes »Tick, tick« ein unnachahmliches Klirren folgt und das sonderbare Tonstück beendet. Während des Sommers nimmt die Grauammer verschiedene Stellungen an und bemüht sich nach Möglichkeit, mit ihren Gebärden dem mangelhaften Gesange nachzuhelfen. Liebenswürdige Eigenschaften zeigt sie nicht, ist im Gegenteil ein langweiliger Vogel, der außerdem friedfertigeren Verwandten durch Zanksucht beschwerlich fällt.
Das Nest wird im April in eine kleine Vertiefung in das Gras oder zwischen andere deckende Pflanzen, immer nahe über dem Boden, gebaut. Alte Strohhalme, trockene Grasblätter, Hälmchen bilden die Wandungen; die innere Höhlung ist mit Haaren oder sehr feinen Hälmchen ausgelegt. Die vier bis sechs vierundzwanzig Millimeter langen, achtzehn Millimeter dicken Eier haben eine feine, glanzlose Schale und sind auf mattgraulichem oder schmutzig gelblichem Grunde mit rotbläulichgrauen Punkten, Fleckchen und Strichelchen gezeichnet und geädert, am stumpfen Ende am dichtesten. Die Jungen werden mit Kerbtieren groß gefüttert und sind zu Ende des Mai flugbar. Sobald sie selbständig geworden, schreiten die Alten zur zweiten Brut; wenn auch diese glücklich vollendet ist, scharen sie sich in Flüge und beginnen nun ihre Wanderung.
Häufiger, jedoch kaum mehr verbreitet, ist die Goldammer ( Emberiza citrinella). Die Länge beträgt einhundertsiebzig, die Breite zweihundertsiebzig, die Fittichlänge fünfundachtzig, die Schwanzlänge siebzig Millimeter. Kopf, Hals und Unterteile sind schön hochgelb, Mantel und Schultern fahlrostbraun, die unteren Körperseiten mit dunkelbraunen, die oberen mit breiten schwarzen Schaftstrichen gezeichnet, die Schwingen und die Schwanzfedern schwarzbraun. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel dunkelblau, an den Schneiden heller, der Fuß rötlichgelb. Bei dem Weibchen sind alle Farben matter. Nord- und Mitteleuropa, ebenso ein großer Teil Asiens, namentlich Sibirien, sind die Heimat der Goldammer. In Deutschland fehlt sie keinem Gaue, steigt auch im Gebirge bis gegen die Waldgrenze auf und darf da, wo zwischen Feldern, Wiesen und Obstpflanzungen niedrige Gebüsche stehen, mit Sicherheit erwartet werden.
Im Süden gesellt sich ihr, hier und da vertritt sie, die über ganz Südeuropa lückenhaft verbreitete und in Südwestdeutschland stellenweise vorkommende, ihr sonst höchst ähnliche Zaunammer ( Emberiza cirlus). Ihre Länge beträgt einhundertachtundfünfzig, die Breite zweihundertvierzig, die Fittichlänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge siebzig Millimeter. Der auf dem Scheitel schwarz gestrichelte Kopf, der Hinterhals, die Halsseiten und ein breites Querband über den Kropf sind graugrün, Kinn, Oberkehle und ein von letzterer ausgehender, bis hinter die Ohrgegend reichender Streifen ist schwarz, die Unterteile hellgelb, Mantel und Schultern zimmetrot, die Schwingen dunkelbraun, die Schwanzfedern dunkelbraun, außen fahl gesäumt. Das Auge dunkelbraun, der Schnabel oberseits schwarz, unterseits lichtbräunlich, der Fuß lichtrötlich. Dem Weibchen fehlen das Schwarz der Kehle und die beiden gelben Streifen am Kopfe.
Während des ganzen Sommers trifft man unsere allbekannte Goldammer paarweise oder ihre Jungen in kleinen Gesellschaften an. Die Alten gehen mit Eintritt des Frühlings an ihr Brutgeschäft. Oft findet man schon im März das Nest, das aus groben, halb verrotteten Pflanzenstengeln, Grashalmen und dürrem Laube erbaut, innen aber mit Grashalmen und Pferdehaaren ausgelegt ist, in niederem Gesträuche, meist nahe auf dem Boden, zwischen Stämmen oder im dichten Gezweige steht und spätestens zu Anfang des April das erste Gelege enthält. Letzteres besteht aus vier bis fünf Eiern, die einundzwanzig Millimeter lang, fünfzehn Millimeter dick, feinschalig, auf trübweißem oder rötlichem Grunde mit dunkleren bunten Flecken und Äderchen gezeichnet und bekritzelt sind und von beiden Eltern wechselseitig bebrütet werden, wie beide auch der Sorge um die Brut gemeinschaftlich sich widmen. In günstigen Jahren brütet sie zwei-, nicht selten dreimal. Solange die Brutzeit währt, ist das Männchen sehr munter, singt vom frühesten Morgen bis zum späten Abend sein einfaches, aus fünf bis sechs fast gleichen Tönen und dem um eine Oktave höheren, etwas gezogenen Schlußlaute bestehendes Liedchen, das das Volk sich in die Worte übersetzt hat: »S'is, s'is noch viel zu früh« oder »Wenn ich 'ne Sichel hätt', wollt' ich mit schnitt«, oder endlich, um mit Mosen zu sprechen, »Wie, wie hab ich dich lieb«. Der Sänger sitzt beim Singen auf einer freien Astspitze und läßt den Menschen sehr nahe an sich herankommen, sich und sein Treiben daher leicht beobachten.
Nach der Brutzeit sammelt sich alt und jung zu Scharen und schweift nun zunächst in einem ziemlich kleinen Gebiete des Landes umher, vereinigt sich wohl auch mit Lerchen und Finken, selbst mit Wacholderdrosseln. In strengen Wintern wird unser Vogel gezwungen, seine Nahrung von den Menschen sich zu erbetteln, und kommt massenhaft, oft als gern gesehener oder wenigstens geduldeter Gast, in das Gehöft des Landmannes herein, kehrt aber im nächsten Frühjahre auf seinen Standort zurück. Hier und da wird er auf besonderen Herden gefangen; doch hat er in dem Raubzeuge ungleich gefährlichere Feinde als in dem Menschen.
Berühmter als die Goldammer ist die Gartenammer oder der Ortolan ( Emberiza hortulana). Ihre Länge beträgt sechzehn, die Breite sechsundzwanzig, die Fittichlänge acht, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Kopf, Hals und Kropf sind matt graugrünlich, die Unterteile zimmetrostrot, die Oberteile matt rostbraun, Mantel und Schultern durch breite dunkle Schaftstriche gezeichnet, die Schwingen dunkelbraun und die Schwanzfedern dunkelbraun. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel wie der Fuß rötlich hornfarben. Beim Weibchen sind Kopf und Hinterhals bräunlichgrau, Kehle und Kropf roströtlich, alle diese Teile mit feinen schwarzen Schaftstrichen gezeichnet, Kinn, Kehle und ein Streif unter den braunen Backen, der unterseits durch einen schmalen Bartstreifen begrenzt wird, roströtlichgelb.
Auch die Gartenammer verbreitet sich über einen großen Teil Europas, kommt aber immer nur hier und da, in vielen Gegenden nicht oder äußerst selten vor. In Deutschland bewohnt sie ständig die unteren Elbgegenden, die Mark und Lausitz, Schlesien, Westfalen und die Rheinlande. Häufig ist sie in Südnorwegen und Schweden und gemein in Südeuropa. Im Winter wandert sie bis West- und Ostafrika, bezieht mit Vorliebe Gebirge und steigt in ihnen bis zu einem Höhengürtel von dreitausend Meter über dem Meere empor.
Im südöstlichen Europa, zumal in Griechenland, ebenso in Kleinasien, Palästina, Westasien und Nordafrika gesellt sich ihr die auch in Süddeutschland und auf Helgoland erlegte Rostammer ( Emberiza caesia), die sich von ihr durch grauen Kopf und graue Kropfquerbinde, blaß zimmetrote Kehle, dunkel zimmetrote Unterseite, kleinere weiße Endflecke der äußeren Schwanzfedern und korallroten Schnabel unterscheidet.
Leben und Betragen unterscheiden die Gartenammer wenig von andern Arten ihrer Familie. Sie bewohnt ungefähr dieselben Örtlichkeiten wie die Goldammer und beträgt sich ihr sehr ähnlich, singt aber etwas besser, obschon in ganz ähnlicher Weise. Der Lockton lautet wie »Gif gerr«, der Ausdruck der Zärtlichkeit ist ein sanftes »Gi« oder ein kaum hörbares »Pick«, das Zeichen unangenehmer Erregung ein lautes »Gerk«. Nest und Eier gleichen den bereits beschriebenen.
Bereits die Römer wußten das schmackhafte, zarte Fleisch der Fettammer zu würdigen und mästeten sie in besonders dazu hergerichteten Käfigen, die nachts durch Lampenschein erhellt wurden. Dasselbe Verfahren soll jetzt noch in Italien, dem südlichen Frankreich und namentlich auf den griechischen Inseln angewendet werden. Dort fängt man die Fettammern massenhaft ein, würgt sie ab, nachdem sie den nötigen Grad von Feistigkeit erhalten haben, siedet sie mit heißem Wasser und verpackt sie zu zwei- und vierhundert Stück mit Essig und Gewürz in kleine Fäßchen, die dann versandt werden. Feinschmecker zahlen für so zubereitete Ortolane gern hohe Preise.
Eine der schönsten ihrer Unterfamilie ist die Zippammer ( Emberiza cia). Die Länge beträgt einhundertachtzig, die Breite zweihundertvierzig, die Fittichlänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge sechsundsiebzig Millimeter. Kopf und Hinterhals sind aschgrau, Mantel und Schultern rostrotbraun, obere Schwanzdecken und die Unterteile zimmetrostrot, auf der Bauchmitte heller, die Schwingen schwarzbraun, die Schwanzfedern dunkel braunschwarz. Der Augenring ist dunkelbraun, der Oberschnabel schwarz, der untere lichtbraun, der Fuß licht hornfarben. Bei dem im allgemeinen matter gefärbten Weibchen sind die schwarzen Längsstreifen des Kopfes minder deutlich, der Oberkopf braun, dunkel längsgestrichelt, der mittlere Streifen grau, der Augenstreifen fahlweiß und das Grau der Kehle und des Kopfes mit verwaschenen dunkeln Tüpfelchen gezeichnet.
In Deutschland bewohnt die Zippammer in erster Linie die Rheinlande. Nicht minder selten kommt sie in Österreich vor. Häufig dagegen ist sie in Südeuropa. Sie ist ein Gebirgsvogel. Halden mit möglichst zerrissenem Gestein bilden ihre Lieblingsplätze. Hier treibt sie sich zwischen und auf den Steinen und Blöcken nach Art anderer Ammern umher. Auf Bäume oder Sträuche setzt sie sich selten. Im übrigen ist sie eine echte Ammer in ihrem Betragen und in ihren Bewegungen, im Fluge und in der Stimme. Letztere, ein oft wiederholtes »Zippzippzipp« und »Zei«, entspricht ihrem Namen. Der Gesang ähnelt dem der Goldammer, ist aber kürzer und reiner; Bechstein hat ihn sehr gut mit »Zizizizirr« wiedergegeben.
Das Nest hat man am Rhein in den Ritzen und Höhlungen der Weinbergsmauern gefunden. Die drei bis vier Eier sind einundzwanzig Millimeter lang, sechzehn Millimeter dick, auf grauweißlichem Grunde mit grauschwarzen und zwischendurch mit einigen grauen Fäden, oft gürtelartig in der Mitte des Eies, umsponnen, diese Fäden aber nicht kurz abgebrochen, die Eier also dadurch leicht von den oft ähnlich gezeichneten der Goldammer zu unterscheiden. Auch die Zippammer brütet wahrscheinlich zweimal im Jahre: in Spanien bemerkten wir ihre Jungen jedoch nicht vor dem Juli. Um die Mitte des August begann bereits die Mauser. Am Rhein erscheint der Vogel zu Anfang des April und verweilt dort bis zum November. In Spanien fanden wir ihn im Winter, zu sehr großen Flügen vereinigt, außerordentlich häufig an allen sonnigen Abhängen der Sierra Nevada.
Ein nicht minder schöner Vogel, die Weidenammer ( Emberiza aureola), gehört Nordasien an, bewohnt jedoch auch den Nordosten Europas in zahlreicher Menge und verfliegt sich von hier aus nicht allzu selten nach Westeuropa, während die Hauptmenge ihre Winterreise nach Südchina und die übrigen Länder des westlichen Himalaja richtet. Die Länge beträgt einhundertundachtzig, die Breite zweihundertundachtzig, hie Fittichlänge achtundachtzig, die Schwanzlänge fünfundvierzig Millimeter. Die Oberteile, ein Querband unter der gelben Kehle und die Kropfseiten sind tiefrostbraun, Zügel, Kopfseiten und Kinn schwarz, die Unterteile gelb, seitlich durch rotbraune Schaftstriche geziert, die Schwingen dunkelbraun; ein großes Feld auf den oberen und die unteren Flügeldecken sind weiß, die äußerste Schwanzfeder weiß, die zweite innen durch einen weißen Längsstreifen geschmückt, die übrigen haben die Färbung der Handschwingen. Das Auge ist rötlichbraun, der Schnabel gelblich, der Unterschnabel rötlich, der Fuß bräunlich hornfarben. Beim Weibchen sind die Oberteile rostbräunlich, dunkel geschaftet, die Unterteile gelblich, an den Seiten etwas dunkler und hier ebenfalls durch Schaftstriche gezeichnet.
Im ganzen mittleren Sibirien, und zwar in den Niederungen wie im Gebirge, bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe, zählt die Weidenammer zu den häufigsten Arten der Unterfamilie. Nicht minder zahlreich tritt sie auch in Osteuropa, namentlich im mittleren und südlichen Ural, auf, von hier aus bis zur Dwina und dem Südwesten des Onegasees sich verbreitend. Wasserreiche Gegenden, die mit buschigen Weiden gut bestanden sind, bilden ihre bevorzugten Aufenthaltsorte. Nächstdem herbergt sie in sonnigen Birkenhainen, nie aber in Nadelwaldungen. Auch sie trifft, von ihrer Winterreise kommend, erst spät im Frühjahr, selten vor den ersten Tagen des Mai, am Brutgebiete ein, treibt sich hier ganz nach Art der Goldammer umher, läßt wie diese den so vielen Arten gemeinsamen Lockton, ein scharfes »Zip, zip«, vernehmen, singt aber, auf hohen Zweigspitzen sitzend, besser als die meisten Ammern, da der einfache Gesang sich durch drei kurze, voneinander wohl unterschiedene, flötende Strophen auszeichnet. Die Nester, die Henke auf den Dwinainseln nördlich von Archangel am sechzehnten Juni fand, standen niedrig am Boden oder nicht hoch über demselben im Grase, Gestrüppe und Gesträuche versteckt, waren auf einer Unterlage aus trockenen Halmen, Blättern und Gewurzel erbaut und mit feinen Würzelchen, Bastfasern, zarten Grasblättern, zuweilen auch mit einzelnen Haaren und Federn ausgelegt. Die fünf bis sechs Eier, deren Längsdurchmesser dreiundzwanzig und deren Querdurchmesser siebzehn Millimeter beträgt, sind auf grünlichem oder bräunlich grauweißem Grunde mit kleinen und großen, teilweise ineinandergeflossenen verwaschenen Schalenflecken von grünlicher oder bräunlichgrauer Färbung und mit brandfleckiger Zeichnung, Punkten, unregelmäßigen Flecken, Haarzügen und Schnörkeln von brauner und schwarzer Farbe geziert. Nach der Brutzeit schart sich alt und jung in zahlreiche Flüge und begibt sich allmählich auf die Wanderung.
*
In der nächsten, mehrere hundert Arten umfassenden Unterfamilie vereinigen wir die Finken im engeren Sinne ( Fringillinae). Sie bewohnen die Alte Welt, ohne jedoch in der Neuen gänzlich zu fehlen, verbreiten sich über alle Gebiete und vereinigen in sich fast alle Eigentümlichkeiten ihrer ganzen Familie. Die Edelfinken ( Fringilla), die wir als die am höchsten stehenden Glieder der Gesamtheit ansehen, haben einen gestreckten Bau, mittellangen, rein kegel- oder kreiselförmigen Schnabel, dessen oberer Teil gegen die Spitze hin sich ein wenig neigt, und dessen Schneiden etwas eingezogen erscheinen, kurzläufige und schwachzehige, mit dünnen, schmalen, aber spitzigen Nägeln bewehrte Füße, verhältnismäßig lange Flügel, in denen die zweite, dritte und vierte Schwinge die Spitze bilden, und mittellangen, in der Mitte seicht ausgeschnittenen Schwanz.
Der Edel- oder Buchfink ( Fringilla coelebs) ist überall so bekannt, zudem auf unserer farbigen Singvogeltafel dargestellt, daß eine genaue Angabe seiner Farben wohl entbehrt werden kann. Seine Länge beträgt hundertfünfundsechzig, die Breite zweihundertachtundsiebzig, die Fittichlänge achtundachtzig, die Schwanzlänge fünfundsiebzig Millimeter. Mit Ausnahme der nördlichsten Länder ist der Edelfink in ganz Europa eine gewöhnliche Erscheinung, im Süden während des Sommers jedoch nur im Gebirge zu finden. Außerdem bewohnt er einzelne Teile Asiens und erscheint im Winter einzeln in Nordafrika.
In den Atlasländern vertritt ihn der sehr ähnliche, aber etwas größere Maurenfink ( Fringilla spodiogenys), der einmal auch in Südfrankreich erlegt worden sein soll. Bei ihm sind Kopf, Augen- und Schultergegend bläulich aschgrau, die Oberteile olivengrün, die Unterteile blaß weinrot, seitlich graulich, die Handschwingen schwarz, die vorderen Armschwingen an der Wurzel, die hinteren fast ganz weiß, die kleinen Flügeldecken weiß, die großen weiß mit schwarzem Mittelbande, die übrigen Teile im wesentlichen wie bei unserm deutschen Vogel gefärbt.
In Deutschland gibt es wenige Gegenden, in denen der Edelfink nicht zahlreich auftritt. Er bewohnt Nadel- wie Laubwälder, ausgedehnte Waldungen wie Feldgehölze, Baumpflanzungen oder Gärten und meidet eigentlich nur sumpfige oder nasse Strecken. Ein Paar lebt dicht neben dem andern; aber jedes wahrt eifersüchtig das erkorene Gebiet und vertreibt aus demselben jeden Eindringling der gleichen Art. Erst wenn das Brutgeschäft vorüber, sammeln sich die einzelnen Paare zu zahlreicheren Scharen, nehmen unter diese auch andere Finken- und Ammerarten auf, wachsen allgemach zu starken Flügen an und streifen nun gemeinschaftlich durch das Land. Von Anfang September an sammeln sich die reiselustigen Vögel in Flüge; im Oktober haben sich die Herden gebildet, und zu Ende des Monats verschwinden sie, bis auf wenige in der Heimat überwinternde Männchen, allmählich aus unsern Gauen. Dann nehmen sie in Südeuropa und in Nordwestafrika Besitz von Gebirg und Tal, von Feld und Garten, Busch und Hecken, sind überall zu finden, überall häufig, aber auch überall in Gesellschaft, zum Zeichen, daß sie hier nicht in der Heimat, sondern nur als Wintergäste leben. Wenn der Frühling im Süden beginnt, wenden sie sich wieder heimwärts. Man hört dann den hellen, kräftigen Schlag der Männchen noch geraume Zeit ertönen; bald aber wird es still und öde da, wo Hunderttausende versammelt waren, und schon zu Anfang des März sind die Wintergäste bis auf die Weibchen verschwunden. Die Finken wandern nämlich, wenigstens auf dem Rückzüge, nach Deutschland, in getrennten Scharen, die Männchen besonders und zuerst, die Weibchen um einen halben Monat später. Selten kommt es vor, daß beide Geschlechter fortwährend zusammen leben, also auch zusammen reisen. Bei schönem Wetter erscheinen in Deutschland die ersten Männchen bereits Ende Februar; die Hauptmasse trifft im März bei uns ein, und die Nachzügler kommen erst im April zurück.
Jedes Männchen sucht den alten Wohnplatz wieder auf und harrt sehnsüchtig der Gattin. Wenn diese eingetroffen ist, beginnen beide sofort die Anstalten zum Nestbau. Die Wiege für die erste Brut pflegt fertig zu sein, noch ehe die Bäume sich völlig belaubt haben. Beide Gatten durchschlüpfen, emsig suchend, die Kronen der Bäume, das Weibchen mit großem Ernste, das Männchen unter lebhaften Bewegungen sonderbarer Art und Hintansetzung der dem Finken bei aller Menschenfreundlichkeit sonst eigenen Vorsicht. Jenes beschäftigt zumeist die Sorge um das Nest, dieses fast ausschließlich seine Liebe und kaum minder die Eifersucht. Endlich ist der günstigste Platz zur Aufnahme des Nestes gefunden: ein Gabelzweig im Wipfel, ein alter, knorriger Ast, der bald von dichtem Laube umgeben sein wird, ein abgestutzter Weidenkopf oder sogar, obwohl nur selten, das Strohdach eines Hauses. Das Nest selbst, ein Kunstbau, ist fast kugelrund, nur oben abgeschnitten. Seine dicken Außenwände werden aus grünem Erdmoose, zarten Würzelchen und Hälmchen zusammengesetzt, außen aber mit den Flechten desselben Baumes, aus dem es steht, überzogen, und diese durch Kerbtiergespinste miteinander verbunden, so daß die Außenwände täuschende Ähnlichkeit mit einem Astknorren erhalten. Das Innere ist tief napfförmig und sehr weich mit Haaren und Federn, Pflanzen- und Tierwolle ausgepolstert. Solange der Nestbau währt und das Weibchen brütet, schlägt der Fink fast ohne Unterbrechung während des ganzen Tages, und jedes andere Männchen in der Nähe erwidert den Schlag seines Nachbars mit mehr als gewöhnlichem Eifer; beide Nebenbuhler im Liede erhitzen sich gegenseitig, und es beginnt nun ein tolles Jagen durch das Gezweige, bis der eine den andern im buchstäblichen Sinne des Wortes beim Kragen gepackt hat und, unfähig noch zu fliegen, mit ihm wirbelnd zum Boden herabstürzt. Bei solchen Kämpfen setzen die erbitterten Vögel ihre Sicherheit oft rücksichtlos aufs Spiel, sind blind und taub gegen jede Gefahr. Endet der Kampf mit Schnabel und Klaue, so beginnt das Schlagen von neuem, wird immer heftiger, immer leidenschaftlicher, und wiederum stürmen die beiden gegeneinander an, nochmals wird mit scharfen Waffen gefochten. So ist die Brutzeit des Edelfinken nichts als ein ununterbrochener Kampf. Das Weibchen legt fünf bis sechs kleine, achtzehn Millimeter lange, vierzehn Millimeter dicke, zartschalige Eier, die auf blaß blaugrünlichem Grunde mit bleich rötlichbraunen, schwach gewellten und mit schwarzbraunen Punkten verschiedener Größe besetzt zu sein pflegen, in Form und Zeichnung aber vielfach abändern. Die Zeit der Bebrütung währt vierzehn Tage; das Weibchen brütet hauptsächlich, das Männchen löst es ab, solange jenes, Nahrung suchend, das Nest verlassen muß. Die Jungen werden von beiden Eltern ausschließlich mit Kerbtieren großgefüttert, verlangen auch nach dem Ausfliegen noch eine Zeitlang der elterlichen Fürsorge, gewöhnen sich aber bald daran, ihre Nahrung selbst zu erwerben. Als unmündige Kinder ließen sie ein sonderbar klingendes »schilkendes« Geschrei vernehmen, als Erwachsene bedienen sie sich des Locktones der Alten. Diese schreiten schon wenige Tage, nachdem die Erziehung ihrer Jungen beendet, zu einer zweiten Brut. Beide Eltern lieben letztere ungemein. Sie schreien kläglich, wenn ein Feind dem Neste naht, und geben ihrer Angst durch die verständlichsten Gebärden Ausdruck. Ungeachtet der Anhänglichkeit und Zärtlichkeit gegen die Jungen weicht das Edelfinkenpaar in gewisser Hinsicht von andern Finken nicht unwesentlich ab. Wenn man junge Hänflinge aus dem Neste nimmt und in ein Bauer steckt, darf man sicher sein, daß die Alten sich auch dann noch in der Fütterung ihrer Kinder nicht stören lassen; die Edelfinken dagegen lassen unter gleichen Umständen ihre Jungen verhungern. Doch kommen Ausnahmen auch bei Edelfinken vor.
Der Fink ist ein munterer, lebhafter, geschickter, gewandter und kluger, aber heftiger und zänkischer Vogel. Während des ganzen Tages fast immer in Bewegung, verhält er sich nur zur Zeit der größten Mittagshitze etwas ruhiger. Auf den Ästen trägt er sich aufgerichtet, auf der Erde mehr wagerecht; auf dem Boden geht er halb hüpfend, halb laufend, auf den Zweigen gern in seitlicher Richtung; im Fluge durchmißt er weite Strecken in bedeutender, kurze in geringer Höhe, schnell und zierlich flache Wellenlinien beschreibend und vor dem Aufsitzen mit gebreiteten Schwingen einen Augenblick schwebend. Seine Lockstimme, das bekannte »Pink« oder »Fink«, wird sehr verschieden betont und erhält dadurch mannigfache Bedeutungen. Im Fluge läßt er häufiger als das »Pink« ein gedämpftes, kurzes »Güpp, güpp« vernehmen; bei Gefahr warnt er durch ein zischendes »Siih«, auf das auch andere Vögel achten; in der Begattungszeit zirpt er, bei trübem Wetter läßt er ein Knarren vernehmen, das die Thüringer Knaben durch das Wort »Regen« übersetzen. Der Schlag besteht aus einer oder zwei regelmäßig abgeschlossenen Strophen, die vielfach abändern, mit größter Ausdauer und sehr oft, rasch nacheinander wiederholt, vorgetragen, von Liebhabern genau unterschieden und mit besonderen Namen belegt werden. Die Kunde dieser Schläge ist zu einer förmlichen Wissenschaft geworden, die jedoch ihre eigenen Priester verlangt und einem nicht in deren Geheimnisse eingeweihten Menschen immer dunkel bleiben wird. Während das ungeübte Ohr nur einen geringen Unterschied wahrnimmt, unterscheiden diese Leute mit untrüglicher Sicherheit zwischen zwanzig und mehr verschiedenen Schlägen, deren Namen bei Unkundigen Lächeln erregen, aber doch meist recht gut gewählt und zum Teil Klangbilder des Schlages selbst sind.
Der Edelfink verursacht irgendwie nennenswerten Schaden höchstens in Forst- und Gemüsegärten, indem er hier auf frisch besäten Beeten die obenaufliegenden Samen wegfrißt. Zwar beschuldigt man ihn außerdem, durch Auflesen der ausgefallenen Buchen- und Nadelholzsamen dem Walde empfindlich zu schaden, glaubt aber wohl selbst nicht an die Tatsächlichkeit solcher Behauptung. Er verzehrt Sämereien verschiedener Pflanzen, hauptsächlich die des Unkrautes, ernährt seine Brut und während der Nistzeit sich selbst aber ausschließlich von Kerbtieren, zumeist solchen, die unsern Nutzbäumen schaden. So wird schlimmstenfalls aller ihm zur Last gelegte Schaden durch den ihm zuzusprechenden Nutzen aufgewogen. Man sollte ihn hegen und pflegen, nicht aber schonungslos verfolgen, wie es leider noch immer hier und da geschieht. Die Liebhaber, die Finken für ihr Bauer fangen, sind es nicht, die deren Bestand verringern; die Herdsteller aber, die Tausende mit einem Male vernichten, tun der Vermehrung dieser anmutigen Vögel empfindlichen Abbruch.
Der nächste Verwandte unseres Finken ist der Bergfink oder Quäker und Böhmer ( Fringilla montifringilla). Seine Länge beträgt einhundertsechzig, die Breite zweihundertsechzig, die Fittichlänge neunzig, die Schwanzlänge sechsundsechzig Millimeter. Kopf, Nacken und Mantel, Wangen und obere Halsseiten sind tiefschwarz, bläulich glänzend, die Bürzelfedern in der Mitte reinweiß, an den Seiten schwarz, Kehle und Brust gelblich überflogen, Zügel, Kinn und Bauchseiten gelblichweiß, letztere schwarz gefleckt, die Unterschwanzdecken rostgelb, die Schwingen braunschwarz, die Schulterfedern gelblich rostfarben, die kleinen Flügeldeckfedern etwas lichter, die mittleren schwarz, am Ende gelblichweiß, die großen schwarz mit langen, scharf abstechenden gelbroten Endkanten und Spitzen, die Schwanzfedern in der Endhälfte weiß, gelblich umsäumt, innen mit weißen Keilflecken. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel licht blauschwarz, im Herbste wachsgelb, an der Spitze schwärzlich, der Fuß rotbraun. Beim Weibchen sind Kopf und Nacken grünlichgrau, die Oberteile olivengraubraun, die Unterteile hellgrau. Nach der Mauser werden die lebhaften Farben durch gelbbraune Federränder verdeckt.
Das Verbreitungsgebiet des Bergfinken erstreckt sich über den hohen Norden der Alten Welt, vom neunundfünfzigsten Breitengrade an nach Polen zu, soweit der Baumwuchs reicht. Von hier aus durchstreift und durchzieht er im Winter ganz Europa bis Spanien und Griechenland oder Asien bis zum Himalaja und kommt auf diesem Zuge sehr häufig zu uns. Er rottet sich bereits im August in Scharen zusammen, treibt sich in den nächsten Monaten in den südlichen Gegenden seiner Heimatländer umher und wandert nun allgemach weiter nach dem Süden hinab. Bei uns erscheint er Ende September; in Spanien trifft er wenige Tage später ein, jedoch nicht in derselben Häufigkeit und Regelmäßigkeit wie bei uns. Gebirge und zusammenhängende Waldungen bestimmen die Richtung seiner Reise, falls solche nicht durch Scharen anderer Finken, mit denen er sich gern vermischt, einigermaßen abgeändert wird. In Deutschland begegnet man den Bergfinken, regelmäßig mit Edelfinken, Hänflingen, Ammern, Feldsperlingen und Grünlingen vereinigt, in Wäldern und auf Feldern. Eine Baumgruppe oder ein einzelner hoher Baum im Felde wird zum Sammelplatze, der nächstgelegene Wald zur Nachtherberge dieser Scharen. Von hier aus durchstreifen sie, Nahrung suchend, die Felder. Hoher Schneefall, der ihnen ihre Futterplätze verdeckt, treibt sie aus einer Gegend in die andere. Ihr Zug ist unregelmäßig, durch zufällige Umstände bedingt.
Der Bergfink hat mit seinem edlen Verwandten viele Ähnlichkeit. Auch er ist als einzelner Vogel zänkisch, jähzornig, bissig und futterneidisch, so gesellig er im übrigen zu sein scheint. Die Scharen teilen gemeinsam Freud und Leid, die einzelnen unter ihnen liegen sich ohne Unterlaß in den Federn. Hinsichtlich seiner Bewegung ähnelt der Bergfink dem Edelfinken sehr; im Gesange steht er tief unter ihm. Sein Lockton ist ein kurz ausgestoßenes »Jäckjäck« oder ein lang gezogenes »Quäk«, dem zuweilen noch ein kreischendes »Schrüig« angehängt wird, der Gesang ein erbärmliches Gezirpe ohne Wohlklang, Regel und Ordnung, eigentlich nichts weiter als eine willkürliche Zusammenfügung der verschiedenen Laute. Wie alle nordländischen Wandervögel, zeigt er sich anfangs vertrauensselig und dreist, wird aber doch durch Verfolgung bald gewitzigt und oft sehr scheu.
In der Heimat bewohnt der Bergfink Nadelwaldungen, zumal solche, die mit Birken untermischt sind, oder Birkenwaldungen selbst, tritt aber keineswegs ebenso häufig auf wie unsere Edelfinken unter gleichen Umständen, sondern vereinzelt sich oft so, daß man lange nach ihm suchen muß. Jedes Paar grenzt sein Brutgebiet ab. Im übrigen gleicht ihr Betragen dem, das wir im Winter zu beobachten gewohnt sind, in jeder Beziehung. Besonders anziehend erscheinen sie auch in der Zeit ihrer Liebe nicht. Das Nest ähnelt dem unseres Edelfinken, ist aber stets dickwandiger und außen nicht bloß mit Moosen, sondern sehr häufig auch mit Birkenschalen, innen mit feiner Wolle und einzelnen Federn ausgekleidet, durch letztere, die am oberen Rande eingebaut zu sein pflegen, zuweilen halb verdeckt. Die fünf bis acht Eier, die einen Längsdurchmesser von siebzehn bis fünfundzwanzig und einen Querdurchmesser von dreizehn bis vierzehn Millimeter haben, unterscheiden sich durch etwas grünlichere Grundfärbung von denen des Verwandten. Ölhaltige Sämereien verschiedener Pflanzen und im Sommer außerdem Kerbtiere bilden die Nahrung auch dieses Finken.
*
Hoch oben auf den Alpengebirgen der Alten Welt, von den Pyrenäen an bis nach Sibirien hin, im Sommer immer über der Grenze des Holzwuchses, lebt ein unserm Edelfinken verwandter Vogel, der Schnee- oder Steinfink ( Montifringilla nivalis). Er unterscheidet sich von den vorstehend beschriebenen Arten durch den langen, gekrümmten, spornartigen Nagel der Hinterzehe, die langen Flügel und die gleichartige Befiederung beider Geschlechter und wird deshalb als Vertreter einer besondern gleichnamigen Sippe ( Montifringilla) angesehen. Seine Länge beträgt etwa zwanzig, die Breite sechsunddreißig, die Fittichlänge elf, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Oberkopf, Wangen, Hinter- und Seitenhals sind licht aschgrau, die Mantelfedern kaffeebraun, lichter gekantet, die Bürzelfedern in der Mitte schwarz, weißlich oder bräunlich gewellt, seitlich weiß, Kehle und Gurgel schwarz, Brustseiten und Weichen licht gelblichaschgrau, Kinn, Brust und Bauchmitte schmutzigweiß, die Schenkelfedern lichtgrau, der After und die Unterschwanzfedern weiß, letztere mit kleinen dunkelbraunen Endflecken gezeichnet. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schieferschwarz, im Herbste und Winter wachsgelb, an der Spitze immer schwarz, der Fuß schwarz. Beim Weibchen ist das Weiß im Flügel weniger ausgedehnt. Nach der Mauser im Herbste sind alle dunklen Farben durch lichtere Federränder teilweise verdeckt.
Unsere Alpen, die Karpathen, der Kaukasus, die persischen Hochgebirge und der Himalaja beherbergen den Schneefinken. Fast ebenso zähe wie das Alpenschneehuhn, hängt er, laut Stölker, an dem höheren Gürtel des Gebirges. Arger Schneefall muß stattgefunden haben und strenge Kälte eingetreten sein, bevor er sich entschließt, die tieferen Täler zu besuchen. Im Vorwinter geschieht dies weit seltener noch als im Nachwinter, weil den wettergestählten Vogel Schnee und Kälte so lange nicht behelligen, als noch Futtervorrat vorhanden ist. Auch während des strengsten Winters entfernt er sich kaum vom Gebirge. Im Laufe des Sommers lebt er nur in dem höchsten Alpengürtel, unmittelbar unter der Grenze, des ewigen Schnees, während der Brutzeit paarweise, nach derselben in Trupps und Flügen, meist am Rande der Halden, woselbst er rasch über die einzelnen Felsen trippelt, zeitweise mit den Genossen sich erhebt und unter leisem »Jüp, jüp« eine Strecke weit fliegt, aber bald wieder sich niederläßt und ebenso eifrig wie vorher weiter nach Nahrung sucht. In Angst gesetzt zirpt er kläglich, und bei Gefahr warnt er durch ein schmetterndes »Gröo« Sein Gesang, den man im Freien nur während der Fortpflanzungszeit vernimmt, wird aus allen diesen Lauten zusammengesetzt und von den Kennern als der schlechteste aller Finkengesänge bezeichnet; er ist kurz, rauh, hart und unangenehm stark. In seinen Bewegungen erinnert er mehr an Schneeammer und Lerche als an den Edelfinken, fliegt auch wie jene sehr leicht und schwebend; aufgescheucht hebt er sich gewöhnlich in bedeutende Höhe, kehrt aber oft, nachdem er einen weiten Umkreis beschrieben, fast genau auf dieselbe Stelle zurück. Vor dem Menschen scheut er sich nicht, und wenn er bei Ankunft eines solchen entflieht, geschieht es meist wohl nur deshalb, weil ihn die ungewohnte Erscheinung schreckte. Auf den Bergstraßen kommt er im Winter regelmäßig vor die Häuser und fliegt dort, wo er des Schutzes sicher ist, furchtlos in die Wohnungen aus und ein; in der ungastlichen Tiefe zeigt er sich anfänglich so vertrauensselig, daß er der Tücke des Menschen nur allzu leicht zum Opfer fällt; Verfolgung aber witzigt binnen kurzem auch ihn.
Schon im April, meist aber erst Anfang Mai, schreitet der Schneefink zur Fortpflanzung. Er brütet am liebsten in den Spalten steiler, senkrechter Felswände, zuweilen auch in Mauerritzen oder unter den Dachplatten einzelner Gebäude, gleichviel, ob solche bewohnt sind oder leerstehen. Das Nest, ein dichter und großer Bau, wird aus feinen Halmen zusammengetragen und sorgsam mit Wolle, Pferdehaaren, Schneehuhnfedern und dergleichen ausgefüttert. Die Eier, die die unseres Edelfinken an Größe übertreffen, sind schneeweiß. Beide Eltern füttern gemeinschaftlich, und zwar hauptsächlich mit Larven, Spinnen und Würmchen, ihre Jungen groß. Haben sie mehr in der Tiefe gebrütet, so führen sie die ausgeflogenen Jungen baldmöglichst zu den Gefilden des »ewigen Schnees« empor. Hier wie während des Winters bilden verschiedene Sämereien ihre Nahrung, und wie es scheint, leiden sie auch in der armen Jahreszeit keinen Mangel. In den Hospizen werden sie regelmäßig gefüttert und sammeln sich deshalb oft in Scharen um diese gastlichen Häuser.
Gefangene gewöhnen sich ohne Umstände im Käfig ein, nehmen mit allerlei passendem Futter vorlieb und erwerben sich durch ruhiges und verträgliches Wesen, Geselligkeit und Liebenswürdigkeit, Anspruchslosigkeit und Dauerhaftigkeit die Zuneigung jedes Pflegers.

Finken:
Unser Grünling, Grün- und Rappfink ( Ligurinus chloris), Vertreter der Sippe der Grünfinken ( Ligurinus), kennzeichnet sich durch kräftigen Bau und kurzkegelförmigen, an den eingezogenen Laden scharfschneidigen Schnabel. Seine Länge beträgt einhundertfünfundzwanzig, die Breite zweihundertsechzig, die Fittichlänge dreiundachtzig, die Schwanzlänge sechzig Millimeter. Die vorherrschende Färbung ist ein angenehmes Olivengelbgrün; Kinn und Oberkehle sind lebhafter und mehr gelb, Ohrgegend, Nacken, Bürzel, Oberschwanzdecken und die unteren Seiten aschgrau verwaschen, Unterbrust, Bauch, Unterschwanzdecken und Flügelrand lebhaft zitrongelb. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel wie der Fuß rötlichgrau. Das Weibchen ist minder lebhaft gefärbt, junge Vögel sind oberseits olivengelbbraun, Kopfseiten, Bürzel und ganze Unterseite blaßgelblich, schmal, rostbräunlich längsgestrichelt. Mit Ausnahme der nördlichen Gegenden Europas fehlt der Grünling nirgends in diesem Erdteile, und ebenso verbreitet er sich über Nordwestafrika und Kleinasien bis zum Kaukasus. Sehr häufig ist er in Südeuropa, namentlich in Spanien, aber auch bei uns keineswegs selten. Er bewohnt am liebsten fruchtbare Gegenden, wo kleine Gehölze mit Feldern, Wiesen und Gärten abwechseln, findet sich in allen Augegenden in Menge, hält sich in unmittelbarer Nähe bewohnter Gebäude auf, meidet aber die Wälder. Bei uns ist er bedingungsweise Wander-, in Südeuropa Standvogel. Wahrscheinlich entstammen diejenigen, die bei uns überwintern, dem Norden.
Nur auf der Wanderschaft schlägt sich der Grünling mit verwandten Vögeln in zahlreiche Flüge zusammen, so mit Edel- und Buchfinken, Feldsperlingen, Goldammern, Bluthänflingen und andern. Sonst lebt er paar- oder familienweise. Er wählt ein kleines Gehölz oder einen Garten zum Standorte, sucht in ihm einen dicht belaubten Baum zum Schlafplatze aus und streift von hier aus nach Nahrung umher. Während des Tages sieht man ihn hauptsächlich auf dem Boden, wo er allerhand Sämereien aufliest. Bei Gefahr flüchtet er dem nächstbesten Baume zu und verbirgt sich im Gelaube der Krone. So plump er erscheint, so munter und rasch ist er. Im Sitzen trägt er den Leib gewöhnlich wagerecht und die Federn locker; oft aber richtet er sich so auf und legt das Gefieder so glatt an, daß man ihn kaum erkennt. Sein Gang ist hüpfend, aber nicht ungeschickt, sein Flug ziemlich leicht, bogenförmig, weil die Schwingen bald stark ausgebreitet, bald sehr zusammengezogen werden, vor dem Niedersetzen stets schwebend. Ohne Not fliegt er ungern weit, obwohl es ihm nicht darauf ankommt, auch längere Strecken in einem Zuge zurückzulegen. Beim Auffliegen läßt er gewöhnlich seinen Lockton, ein kurzes »Tschick« oder »Tscheck«, vernehmen, das zuweilen vielmals nacheinander wiederholt wird. Der Laut der Zärtlichkeit ist ein ungemein sanftes, jedoch immerhin weit hörbares »Zwui« oder »Schwunsch«. Dasselbe wird auch als Warnungsruf gebraucht, dann aber gewöhnlich mit einem sanften, hellen Pfeifen begleitet. Da, wo der Grünling sich sicher weiß, ist er sehr wenig scheu, in Gesellschaft anderer aber sehr oft vorsichtig.
Sämereien der verschiedensten Pflanzen, auch giftige, vor allem aber ölige, Rübsamen, Leindotter, Hederich, Hanfsamen und dergleichen, bilden seine Nahrung. Er liest sie nach Art der Edelfinken von der Erde auf, und nur, wenn tiefer Schnee seinen Tisch verdeckt, versucht er auch, solche auszuklauben oder nimmt Wacholder- und Vogelbeeren an und beißt die Buchnüsse auf, um des Kernes habhaft zu werden. In Gegenden, wo Hanf gebaut wird, kann er zuweilen recht schädlich werden; außerdem belästigt er vielleicht noch im Gemüsegarten, nützt dafür aber durch Auflesen und Aufzehren des Unkrautsamens wahrscheinlich mehr, als er schadet.
Der Grünling pflegt zweimal, in guten Sommern wohl auch dreimal zu brüten. Schon vor der Paarung läßt das Männchen seinen einfachen Gesang fortwährend vernehmen und steigt dabei gelegentlich, beständig singend, schief nach oben empor, hebt die Flügel so hoch, daß ihre Spitzen sich fast berühren, schwenkt hin und her, beschreibt einen oder mehrere Kreise und flattert nun langsam wieder zu dem Baume herab, von dem es sich erhob. Nebenbuhler vertreibt es nach hartnäckigen Kämpfen. Das Nest wird auf Bäumen oder in hohen Hecken, zwischen einer starken Gabel oder dicht am Stamme angelegt und je nach den Umständen aus sehr verschiedenen Stoffen zusammengebaut. Dürre Reiserchen und Würzelchen, Quecken, trockene Halme und Graswurzeln bilden die Unterlage, auf die eine Schicht feinerer Stoffe derselben Art, untermischt mit grünem Erdmoos oder Flechten, auch wohl mit Wollklümpchen, zu folgen pflegt. Zur Ausfütterung der Nestmulde dienen einige äußerst zarte Würzelchen und Hälmchen, auf und zwischen denen Pferde-, Hirsch- und Rehhaare liegen, vielleicht auch kleine Flöckchen Tierwolle eingewebt sind. Der Bau steht an Schönheit dem Neste des Edelfinken weit nach, ist tiefer als eine Halbkugel, nicht sehr fest und dicht, aber doch hinlänglich gut gebaut. Zu Ende des April findet man das erste, im Juni das zweite, und wenn noch eine Brut erfolgt, zu Anfang des August das dritte Gelege. Es besteht aus vier bis sechs Eiern von zwanzig Millimeter Längs- und fünfzehn Millimeter Querdurchmesser, die sehr bauchig, dünn und glattschalig und auf bläulichweißem oder silberfarbenem Grunde, besonders am stumpfen Ende mit bleichroten, deutlichen oder verwaschenen Fleckchen und Pünktchen bedeckt sind. Das Weibchen brütet allein, sitzt sehr fest auf dem Neste, wird inzwischen von dem Männchen ernährt und zeitigt die Jungen in ungefähr vierzehn Tagen. Beide Eltern teilen sich in die Aufzucht der Brut und füttern diese zunächst mit geschälten und im Kropfe erweichten Sämereien, später mit härteren Nahrungsstoffen derselben Art. Schon wenige Tage nach dem Ausfliegen werden die Jungen ihrem Schicksale überlassen, vereinigen sich mit anderen ihrer Art, auch wohl mit verwandten jungen Finken, streifen mit diesen längere Zeit umher und schließen sich dann den Eltern, die inzwischen die zweite oder dritte Brut beschäftigt hat, wieder an.
Unsere kleineren Raubtiere und ebenso Eichhörnchen, Haselmäuse, Krähen, Elstern, Häher und Würger zerstören viele Nester, fangen auch die Alten weg, wenn sie ihrer habhaft werden können. Gleichwohl nimmt der Bestand bei uns eher zu als ab.
*
Als Verbindungsglied zwischen Grünfinken und Zeisigen mag der Citronfink oder Citronzeisig ( Citrinella alpina) gelten. Die von ihm vertretene Sippe der Citronzeisige ( Citrinella) unterscheidet sich nur durch den etwas kürzeren und dickeren Schnabel von den Zeisigen. Stirn, Vorderkopf und die Gegend um das Auge, Kinn und Kehle sind schön gelbgrün, die Unterteile lebhafter gelb, Hinterkopf, Nacken, Hinterhals, Ohrgegend und Halsseiten grau, Mantel und Schultern auf düster olivengrünem Grunde durch verwaschene, dunkle Schaftstriche gezeichnet, die Schwingen braunschwarz, die Schwanzfedern schwarz, außen schmal grünlich, innen, wie auch die Schwingen, weißlich gesäumt. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel fleischbräunlich, der Fuß gelbbräunlich. Das kleinere Weibchen ist minder lebhaft und mehr grau gefärbt. Die Länge beträgt einhundertzwanzig, die Breite zweihundertdreißig, die Fittichlänge achtzig, die Schwanzlänge fünfundfünfzig Millimeter. Der Citronfink ist ein Gebirgsvogel, der die Westalpen und Kleinasien, in Deutschland auch den Schwarzwald bewohnt, aber nur an einzelnen Stellen zahlreich auftritt. In den Schweizer Alpen bewohnt er nur die oberen Waldungen, im badischen Schwarzwalde die Hochrücken, namentlich die Waldränder oder Weiden, meidet aber einzeln stehende Berggipfel ebenso wie das Innere von Waldungen. Im Schwarzwalde verläßt er im Winter seine Aufenthaltsorte und steigt in die sonnigen Schluchten der Taleingänge herab, tut dies aber nur bei wirklich schlechtem Wetter und findet sich schon zu Anfang Mai wieder auf seinen Brutplätzen ein, ob auch dort der Boden mit Schnee bedeckt sein sollte. Alle Forscher, die ihn eingehend beobachten konnten, schildern ihn als einen munteren und lebhaften Vogel, der in beständiger Bewegung ist und dabei ununterbrochen lockt und singt. Bei schlechter Witterung kaum wahrnehmbar, läßt er, laut Schütt, an sonnigen und Windstillen Tagen seinen klagenden Lockton »Güre, güre, bitt, bitt« häufig hören und macht sich dadurch sehr bemerklich, ist in der Regel aber ziemlich scheu und deshalb schwer zu beobachten. Der Citronzeisig hat einen eigentümlich klirrenden Gesang, in dem Stieglitz- und Girlitzstrophen wechseln und ineinander übergehen, gehört jedoch nicht zu den vorzüglichen Sängern des Finkengeschlechtes, sondern zu denen zweiten Ranges.
Je nach der Lage des Brutgebietes und der in ihm herrschenden Witterung beginnt das Paar im April oder spätestens im Mai mit dem Baue des Nestes. Letzteres steht auf Bäumen, bald höher, bald niedriger, im Schwarzwalde, nach Schütt, immer auf etwa sechs Meter hohen Fichten, am Stamme und nahe am Wipfel im dichtesten Astwerke, besteht aus Würzelchen, Bartmoos und Pflanzenfasern und ist mit Pflanzenwolle und Federn ausgefüttert. Die vier oder fünf Eier ähneln denen des Stieglitzes, sind aber kleiner und zartschaliger. Die Jungen werden von beiden Eltern gefüttert, locken gedehnt »Zi-be, zi-be«, sitzen lange im Nest, fliegen aber, sobald man dieses berührt, gleich jungen Zaunkönigen davon und suchen ihr Heil im Moos und Heidelbeergestrüpp. Gegen den Herbst hin vereinigen sie und ihre Eltern sich mit andern und bilden Flüge von vierzig bis fünfzig Stück, die meist auf jungen Schlägen am Boden dem Gesäme nachgehen und sich von Nahrung versprechenden Orten schwer vertreiben lassen. Im Sommer liebt der Vogel den Samen des Löwenzahnes, gleichviel ob derselbe bereits gereift oder noch weich ist, und gewinnt denselben, indem er sich nach Stieglitzart an die Samenkrone hängt, oder liest vom Boden andere Sämereien auf, nimmt auch sehr gern Knospen und weiche Blattspitzen zu sich. Seine Ernährung im Käfige verursacht wenig Schwierigkeiten; gleichwohl hält er sich schlecht und steht deshalb als Stubenvogel den Zeisigen wie dem Stieglitz nach.
*
Die Zeisige ( Carduelis) kennzeichnen sich durch langen, feinspitzigen, oben sanft gewölbten Schnabel, mit kurzen Nägeln besetzte Zehen und verhältnismäßig lange Flügel. Unser Zeisig ( Carduelis spinus) ist auf dem ganzen Oberkopfe und dem Nacken sowie an Kinn und Oberkehle schwarz, auf Hinterhals, Mantel und Schultern gelbgrün, dunkel längsgestrichelt; ein Augenbrauenstreifen, die vorderen Backen, Kehle, Halsseiten, Kropf und Oberbrust sind schön olivengelb, Unterbrust, Bauch und Seiten fast weiß, die unteren Schwanzdecken gelb und wie die Schenkelseiten schwarz gestrichelt, die Bürzelfedern olivengelb, die Oberschwanzdecken grün, die Schwingen braunschwarz, von der vierten an außen im Wurzelteile gelb, übrigens schmal gelbgrün gesäumt, die letzten Armschwingen außen breit grüngelb, an der Spitze weißlich gesäumt, die Flügeldeckfedern olivengrün, die der Armschwingen olivengelb, an der Wurzel aber schwarz, weshalb eine schwarze Querbinde ersichtlich wird, die Schwanzfedern gelb, am Ende schwarz, die beiden Mittelfedern braunschwarz, außen grün gesäumt. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel fleischfarben, an der Spitze schwärzlich, der Fuß braun. Beim Weibchen sind die Federn des Oberkopfes und der Oberseite grünlichbraun, die der Unterseite schmutzigweiß, durch dunkle Schaftflecke gezeichnet. Die Länge beträgt einhundertzwanzig, die Breite zweihundertzwanzig, die Fittichlänge fünfundfünfzig, die Schwanzlänge fünfundvierzig Millimeter.
Das Verbreitungsgebiet des Zeisigs umfaßt ganz Europa und Asien, soweit es bewaldet ist, nach Norden hin bis zur Breite Mittelnorwegens. In Deutschland ist er ein Strichvogel, der außer der Brutzeit weit im Lande umherstreift, unser Vaterland aber nur selten verläßt; in nördlichen Ländern wandert er und gelangt dann häufig zu uns, um Herberge während des Winters zu nehmen. Während des Sommers bewohnt er die Nadelwälder bergiger Gegenden, brütet hier und beginnt von ihnen aus seine Streifereien. In gewissen Wintern erscheint er zu Tausenden in den Dörfern oder in unmittelbarer Nähe derselben; in andern Wintern sieht man hier kaum einzelne. Baumlose Gegenden meidet er, hält sich aber auch fast beständig in den obersten Kronzweigen der Bäume auf.
Der Zeisig ist, wie Naumann sagt, »immer munter, flink und keck, hält sein Gefieder stets schmuck, obgleich er dasselbe meistens nicht anlegt, bewegt sich schnell hin und her, wendet und dreht oft den Hinterleib hinüber und herüber, hüpft, steigt und klettert vortrefflich, kann sich verkehrt an die Spitzen schwankender Zweige hängen, an senkrechten, dünnen Ruten ungemein schnell auf- und abhüpfen und gibt in alledem den Meisen wenig nach. Sein Sitz auf Zweigen ist höchst verschieden, und nirgends hat er lange Ruhe, wenn er nicht beim Fressen ist. Auch auf der Erde hüpft er leicht und schnell, obgleich er dies, solange es gehen will, zu vermeiden sucht«. Sein Flug ist wogend, schnell und leicht, er scheut sich deshalb nicht, weite Räume zu überfliegen und steigt zu bedeutenden Höhen empor. Der Lockton klingt wie »Trettet« oder wie »Tettertetett« und »Di, di« oder »didilei«. Mit letzteren Tönen beginnt das Männchen gewöhnlich auch seinen Gesang, ein nicht eben ausgezeichnetes, aber doch gemütliches Gezwitscher, dem als Schluß ein langgezogenes »Dididlidlideidää« angehängt wird. Er ist arglos und zutraulich, gesellig, furchtsam, friedfertig und im gewissen Sinne leichtsinnig, verschmerzt wenigstens bald den Verlust seiner Freiheit. Als Stubenvogel empfiehlt er sich sehr. Äußerst gelehrig, eignet er sich bald allerlei belustigende Kunststücke an macht kaum nennenswerte Ansprüche an das Futter, verträgt sich mit allen übrigen Vögeln, in deren Gesellschaft er leben muß, wird seinem Herrn rücksichtslos zugetan, gewöhnt sich, frei aus- und einzufliegen, hört und folgt auf den Ruf und brütet unter sorgsamer Pflege ebensoleicht wie irgendein anderer seiner Freiheit beraubter Vogel.
Sämereien mancher Art, hauptsächlich Baumgesäme, junger Knospen und Blätter, während der Brutzeit aber Kerbtiere, bilden die Nahrung. Die Jungen werden ausschließlich mit letzteren, zumal mit Räupchen, Blattläusen usw. aufgefüttert und bald nach dem Ausfliegen in Gärten und Obstpflanzungen geführt, weil diese reicher an Kerbtieren zu sein pflegen als die tieferen Wälder.
»Die Erlenzeisige«, sagt mein Vater, der die ersten eingehenden Beobachtungen über das Brutgeschäft veröffentlicht hat, »paaren sich im April. Das Männchen singt dann sehr laut und fliegt dabei flatternd in der Luft umher. Dieses kleine Tierchen sieht dann groß aus, schlägt die Flügel sehr stark, breitet den Schwanz aus und flattert in Kreisen und Bogen in einer beträchtlichen Höhe umher. Dieses geschieht oft fern vom Brutorte, zuweilen in den Gärten, von denen, die keine Weibchen bekommen können, bis in den Sommer hinein. Das Weibchen verhält sich hierbei ganz ruhig, bleibt aber in der Nähe des Männchens, schnäbelt sich hernach mit ihm und streicht mit ihm umher. Man findet gewöhnlich mehrere Paare zusammen, die friedlich nebeneinander Sämereien auflesen. Das Bauen des Nestes beginnt, nachdem das Weibchen einen schicklichen Platz dazu ausgesucht hat. Und in der Tat muß man über die Klugheit erstaunen, mit der die Stelle zum Zeisignest gewählt wird! Ich habe es nur auf Fichten und Tannen und eines auf einer Föhre gesehen; sie standen alle weit vorn, einige fast auf der Spitze der Äste, und so verborgen, daß man sich über die Meinung, ein Zeisignest sei unsichtbar, nicht zu verwundern braucht. Eines davon war auf einem Fichtenaste voller Flechten so angebracht, daß man nur von oben, wo es aber durch einen darüberliegenden Ast gedeckt war, an der Vertiefung es erkennen konnte; von unten und von der Seite war wegen der Flechten durchaus nichts davon zu bemerken. Dazu kommt, daß ein Zeisignest zehn bis fünfundzwanzig Meter hoch und fast immer weit vom Stamme entfernt steht, was das Entdecken und Erreichen desselben sehr erschwert. Die Unsichtbarkeit ist also in gewisser Hinsicht gar nicht zu leugnen; denn wer die Erlenzeisige nicht bauen oder füttern sieht, wird nie ein Nest entdecken. Das Bauen des letztern geht schnell vonstatten. Bei zwei Paaren, die ich beobachtete, baute auch das Männchen mit, und da beide Gatten miteinander flogen, so wartete gewöhnlich der eine, bis der andere das Nest wieder verlassen hatte. Beide brachen dürre Zweige zur Unterlage ab und rissen das Moos unten an den Baumstämmen los; sie trugen ganze Schnäbel voll. Sonderbar sah es aus, wenn sie etwas Schafwolle zum Neste bereiteten: sie zupfen diese, indem sie mit dem einen Fuß darauf treten, so lange herum, bis sie ganz aufgelockert ist. Ich habe sie fast den ganzen Vormittag und auch in den Nachmittagsstunden sehr emsig bauen sehen. Bei den andern Paaren, die ich zu beobachten Gelegenheit hatte, baute bloß das Weibchen; das Männchen flog aber beständig neben ihm her. Sie sind beim Bauen gar nicht schüchtern und lassen sich ganz in der Nähe betrachten; gleichwohl haben sie die Gewohnheit, daß sie ein angefangenes Nest oft verlassen und an einem frischen arbeiten. Daß der Erlenzeisig das Wasser sehr liebt, zeigt sich auch bei der Wahl des Nestplatzes. Alle drei Nester, die ich im Juni 1819 fand hatten Wasser in der Nähe; zwei eine große Pfütze und eins einen Teich; ein anderes stand nicht fern von einem Waldbach. Die Zeit des Legens ist verschieden. Wir haben einmal Anfang Mai schon flügge Junge gesehen; die meisten jedoch trifft man Anfang Juli an, so daß die Legezeit in den Anfang des Juni fällt.« Die Nester weichen einigermaßen voneinander ab, bestehen aber im wesentlichen äußerlich aus dürren Reisern, sodann aus Baummoos und Fichtenflechten, Schafwolle und dergleichen, welche Stoffe durch Raupengespinste fest miteinander verbunden werden, und sind inwendig mit Würzelchen, Pflanzenwolle, Flechtenfasern, Moosstengeln, Grasblättchen und Federn dicht ausgefüttert. Ihre Wandungen sind sehr dick, und der Napf ist ziemlich tief. Die fünf bis sechs Eier sind nach Gestalt, Größe und Farbe verschieden, gewöhnlich etwa sechzehn Millimeter lang, dreizehn Millimeter dick und auf weißblaulichem oder bleich grünblauem Grunde mit mehr oder minder deutlichen Punkten, Flecken und Adern gezeichnet. Das Weibchen brütet allein, wird währenddem vom Männchen aus dem Kropfe gefüttert und zeitigt die Brut binnen dreizehn Tagen. An der Aufzucht der Jungen beteiligen sich beide Eltern.
Der allbekannte Stieglitz oder Distelzeisig und Distelfink ( Carduelis elegans) kennzeichnet sich durch kreiselförmigen, sehr gestreckten und spitzigen Schnabel, sowie durch sein buntes und lockeres Gefieder. Ein schmales Band rings um den Schnabel, Zügel, Scheitelmitte und Hinterkopf sind tiefschwarz, Stirn, Hinterwangen und Kehle hoch karminrot, Schläfe und Wangen weiß, Nacken, Schultern und Rücken gelblich-, Kropf und Brustseiten hell rötlichbraun, Gurgel, Bürzel und die noch nicht genannten Unterteile weiß, die Schwingen tiefschwarz, unterseits dunkelgrau, die kleinen Oberflügeldecken tiefschwarz, die mittleren und großen hellgelb, die Steuerfedern tiefschwarz. Das Auge ist nußbraun, der Schnabel rötlichweiß, an der Spitze schwarz, der Fuß bläulich fleischfarben. Beide Geschlechter ähneln sich täuschend. Den Jungen fehlt das Rot und Schwarz am Kopfe; ihr Oberkörper ist auf bräunlichem Grunde dunkel, der Unterkörper auf weißen Grunde braun gefleckt. Die Länge beträgt dreizehn, die Breite zweiundzwanzig, die Fittichlänge sieben, die Schwanzlänge fünf Zentimeter.
Vom mittleren Schweden an findet sich der Stieglitz in ganz Europa, aber auch auf Madeira, den Kanarischen Inseln, in Nordwestafrika und in einem großen Teil Asiens, von Syrien an bis nach Sibirien hinauf. Auf Kuba ist er verwildert. Innerhalb dieses Verbreitungsgebietes scheint er nirgends zu fehlen, nimmt auch mit gesteigertem Obstbaue an Menge zu, bequemt sich überhaupt verschiedenen Verhältnissen trefflich an, kommt aber keineswegs überall in gleicher Häufigkeit vor. In einzelnen Gegenden ist er selten, in andern sieht man ihn in zahlreichen Flügen. In Deutschland schart er sich zu Herbstes Anfang und zieht dann zuweilen in Gesellschaften im Lande umher, die mehrere Hunderte zählen. Diese Massen pflegen sich gegen den Winter hin in kleinere Trupps aufzulösen, die dann wochenlang zusammenleben. Als Brutorte sind Gegenden zu betrachten, in denen der Laubwald vorherrscht oder Obstbau getrieben wird. Waldbewohner im strengeren Sinne ist der Stieglitz nicht; denn lieber noch als in zusammenhängenden Beständen siedelt er sich in Gärten oder Parks, an Straßen, auf Angern oder Wiesen und ähnlichen Orten an, und hier pflegt er auch zu brüten.
Der Stieglitz ist höchst anmutig, unruhig, gewandt und listig, hält sich zierlich und schlank. Als wahrer Baumvogel kommt er nur ungern auf den Boden herab und bewegt sich hier auch ziemlich ungeschickt; dagegen klettert er wie eine Meise, hängt sich, wie die Zeisige, geschickt von unten an die dünnsten Zweige und arbeitet minutenlang in solcher Stellung. Sein Flug ist leicht und schnell, wie bei den meisten Finken wellenförmig, und nur dann schwebend, wenn der Vogel sich niederlassen will. Zum Ruhen bevorzugt er die höchsten Spitzen der Bäume oder Gesträuche, hält sich aber niemals lange an einem und demselben Orte auf, weil sich seine Unruhe immer geltend macht. Dem Menschen gegenüber zeigt er sich stets vorsichtig, scheu aber nur dann, wenn er bereits Nachstellungen erfahren hat. Mit andern Vögeln lebt er in Frieden, läßt jedoch einen gewissen Mutwillen an ihnen aus. Seine Lockstimme wird am besten durch seinen Namen wiedergegeben; denn dieser ist nichts anderes als ein Klangbild der Silben »Stiglit« »Pickelnit« und »Pickelnick ki kleia«, die er im Sitzen wie im Fliegen vernehmen läßt. Ein sanftes »Mai« wird als Warnungsruf gebraucht, ein rauhes »Rärärärä« ist das Zeichen unangenehmer Erregung. Die Jungen rufen »Zif litzi zi« usw. Das Männchen singt, obgleich die einzelnen Töne denen des Bluthänflings an Klang und Fülle nachstehen, laut und angenehm, mit viel Abwechselung und so fröhlich, daß der Liebhaber den Stieglitz namentlich auch seines Gesanges halber hoch in Ehren hält. In der Gefangenschaft singt er fast das ganze Jahr; im Freien schweigt er nur während der Mauser und bei sehr schlechtem Wetter.
Die Nahrung besteht in Gesäme mancherlei Art, vorzüglich aber in solchem der Birken, Erlen und nicht minder der Disteln im weitesten Sinne, und man darf deshalb da, wo Disteln oder Kletten stehen, sicher darauf rechnen, ihn zu bemerken. »Nichts kann reizender sein«, sagt Bolle, »als einen Trupp Stieglitze auf den schon abdorrenden Distelstengeln sich wiegen und aus der weißen Seite ihrer Blütenköpfe die Samen herauspicken zu sehen. Es ist dann, als ob die Pflanzen sich zum zweiten Male und mit noch farbenprächtigeren Blumen, als die ersten es waren, geschmückt hätten.« Der Vogel erscheint auf den Distelbüschen, hängt sich geschickt an einen Kopf an und arbeitet nun eifrig mit dem langen, spitzen Schnabel, um sich der versteckten Samenkörner zu bemächtigen. Im Sommer verzehrt er nebenbei Kerbtiere, und mit ihnen füttert er auch seine Jungen groß. Er nützt also zu jeder Jahreszeit, durch Verminderung des schädlichen Unkrautes nicht minder als durch Wegfangen der Kerbtiere. Strenge Beurteiler seiner Taten beschuldigen ihn freilich, durch leichtfertiges Arbeiten an den Samenköpfen der Disteln diese verbreiten zu helfen, vergessen dabei aber, daß der Wind auch ohne Stieglitz der eigentliche Urheber solcher Unkrautverbreitung ist, und tun dem zierlichen Vogel somit entschieden Unrecht.
Das Nest, ein fester, dicht zusammengefilzter Kunstbau, steht in lichten Laubwäldern oder Obstpflanzungen, oft in Gärten und unmittelbar bei den Häusern, gewöhnlich in einer Höhe von sechs bis acht Metern über dem Boden, ward am häufigsten in einer Astgabel des Wipfels angelegt und so gut verborgen, daß es von unten her erst dann gesehen wird, wenn das Laub von den Bäumen fällt. Grüne Baumflechten und Erdmoos, seine Würzelchen, dürre Hälmchen, Fasern und Federn, welche Stoffe mit Kerbtiergespinsten verbunden werden, bilden die äußere Wandung, Wollagen aus Distelflocken, die durch eine dünne Lage von Pferdehaaren und Schweinsborsten in ihrer Lage erhalten werden, die innere Auskleidung. Das Weibchen ist der eigentliche Baumeister, das Männchen ergötzt es dabei durch fleißigen Gesang, bequemt sich aber nur selten, bei dem Bau selbsttätig mitzuwirken. Das Gelege enthält vier bis fünf zart- und dünnschalige Eier, die durchschnittlich sechzehn Millimeter lang, zwölf Millimeter dick und auf weißem oder blaugrünlichem Grunde sparsam mit violettgrauen Punkten bedeckt, am stumpfen Ende aber kranzartig gezeichnet sind. Selten findet man diese Eier früher als im Mai, und wahrscheinlich nisten die Paare nur einmal im Laufe des Sommers. Das Weibchen brütet allein und zeitigt die Eier binnen dreizehn bis vierzehn Tagen. Die zarten Jungen werden mit kleinen Kerbtierlarven, die größeren mit Kerbtieren und Sämereien gefüttert, die ausgeflogenen noch lange von den Eltern geleitet und geführt. Wie der Hänfling, so füttert auch der Stieglitz seine Kinder groß, wenn sie vor dem Ausfliegen in einen Käfig eingesperrt wurden.
Unser Blut- oder Rothänfling ( Carduelis cannabina) ist auf der Stirn und in der Augengegend braungelblichweiß, auf dem Scheitel prachtvoll karminrot, auf den hintern Kopfseiten und dem Halse aschgrau, rötlichgelb gestrichelt, auf Hinterrücken und Schultern zimmetbraun, auf dem Unterrücken weißbräunlich, auf dem Bürzel schmutzigweiß; Kehle und Gurgel sind bräunlichweiß, durch dunkelgraue Striche und längere Flecke gezeichnet, Brustmitte, Bauch und untere Schwanzdecken weiß, die Brustseiten lebhaft karminrot, die Weichen licht zimmetfarbig, die schwarzen Handschwingen außen und innen schneeweiß, die schwarzbraunen Armschwingen lichter und breiter hellzimmetfarbig gesäumt, die zimmetbraunen Schultern und Oberflügeldecken am Ende rostgelblich gekantet, die Schwanzfedern schwarz. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel bleigrau, an der Wurzel dunkler, der Fuß rötlichgrau. Die Länge beträgt einhundertdreißig, die Breite zweihundertdreißig, die Fittichlänge dreiundsiebzig, die Schwanzlänge fünfundfünfzig Millimeter. Der Bluthänfling bewohnt ganz Europa, Kleinasien und Syrien und erscheint auf dem Zuge in Nordwestafrika, selten aber in Ägypten. In Deutschland ist er überall häufig, am gemeinsten vielleicht in hügeligen Gegenden. Hohe Gebirge meidet er, ausgedehnte Waldungen nicht minder.
Im hohen Norden Europas vertritt ihn der Berghänfling ( Carduelis flavirostris). Oberkopf, Schultern und Rücken sind braungelb, streifig schwarzbraun gefleckt, die Kehlfedern dunkel rostgelb, Kropf- und Brustseiten heller, mit schwarzen Längsflecken gezeichnet, Brustmitte und Bauch gelblichweiß bis weiß, die Schwingen außen rotbraun, die Steuerfedern braunschwarz.
Unter unsern Finken gehört der Hänfling zu den liebenswürdigsten und anmutigsten, abgesehen von seiner Gesangskunst, die ihn zu einem der beliebtesten Stubenvögel stempelt. »Der Bluthänfling«, sagt mein Vater, der ihn sehr eingehend beschrieben hat, »ein gesellschaftlicher, munterer, flüchtiger und ziemlich scheuer Vogel, ist außer der Brutzeit immer in kleinen und großen Flügen beieinander; selbst während der Brutzeit habe ich mehrere zusammen gesehen. Im Herbst, gewöhnlich schon im August, schlagen sich die Bluthänflinge in große Herden zusammen, so daß ich bis hundert und mehr in einem Zuge beobachtet habe. Im Winter mischen sie sich unter die Grünlinge, auch unter Edel- und Bergfinken, Feldsperlinge und Goldammern. Im Frühjahr sondern sie sich nach der Paarung voneinander ab, brüten aber oft in friedlicher Nähe nebeneinander. Merkwürdig ist, wie sehr dieser Vogel selbst während der Brutzeit hin- und herstreicht. In meinem Garten singt im Frühjahr und Vorsommer fast alle Morgen ein Bluthänfling, der eine Viertelstunde davon sein Nest hat. Solange das Weibchen nicht über den Eiern oder Jungen sitzt, fliegt es mit dem Männchen umher. Deswegen sieht man sie dann immer beisammen. Treu lieben sich beide Gatten und ebenso zärtlich lieben sie ihre Eier und Jungen; sie lassen sich bei den letzteren sehr leicht fangen. Der Flug ist leicht, ziemlich schnell, in Absätzen und schwebend, besonders wenn der Vogel sich setzen will, oft im Kreise sich herumdrehend. Oft nähert sich der Hänfling im Fluge dem Boden, so daß man glaubt, er wolle sich niederlassen; er erhebt sich aber nicht selten wieder und fliegt eine große Strecke weiter. Auf der Erde hüpft er ziemlich geschickt herum. Wenn er auf Bäumen singt, sitzt er gewöhnlich auf der höchsten Spitze oder auf einem einzeln stehenden Aste; dies tut er auch auf Büschen, besonders auf Fichten- und Tannenbüschen; überhaupt sitzt er gern auf dem Wipfel, auch wenn er nicht singt.«
Die Lockstimme des Hänflings ist ein kurzes, hartes »Gäck« oder »Gäcker«, das häufig mehrmals schnell hintereinander ausgestoßen wird. Ihm wird oft ein wohlklingendes »Lü« zugefügt, zumal wenn die Vögel etwas Verdächtiges bemerken. Der Gesang, einer der besten, den ein Fink überhaupt vorträgt, fängt gewöhnlich mit dem erwähnten »Gäckgäck« an; diesen Lauten werden aber flötende, klangvolle Töne beigemischt und sie wie jene mit viel Abwechselung und Feuer vorgetragen. Jung eingefangene Männchen lernen leicht Gesänge anderer Vögel nachahmen oder Liedchen nachpfeifen, fassen aber leider auch unangenehme Töne auf und werden dann zu unleidlichen Stümpern. Mein Vater erwähnt eines Bluthänflingmännchens, das den Schlag des Edelfinken täuschend nachahmte, und eines andern, das den Zeisiggesang vollständig erlernt hatte; Naumann berichtet von solchen, die die Lieder der Stieglitze, Lerchen und selbst den Schlag der Nachtigallen vortrugen.
Bereits im April schreitet der Hänfling zum Nestbau, und während des Sommers nistet er mindestens zwei-, gewöhnlich aber dreimal. Das Nest wird am liebsten in Vor- oder Feldhölzern, aber auch in einzelnen Büschen, meist niedrig über dem Boden, angelegt, besteht äußerlich aus Reiserchen, Würzelchen und Grasstengeln, Heidekraut und dergleichen, welche Stoffe nach innen zu immer feiner gewählt werden und so gleichsam eine zweite Lage bilden, und ist in der Mulde vorzugsweise mit Tier- und Pflanzenwolle, namentlich aber auch Pferdehaar, ausgelegt. Das Gelege enthält vier bis fünf Eier von siebzehn Millimeter Längs- und dreizehn Millimeter Querdurchmesser, die auf weißbläulichem Grunde mit einzelnen blaßroten, dunkelroten und zimmetbraunen Punkten und Strichelchen gezeichnet sind. Sie werden vom Weibchen allein in dreizehn bis vierzehn Tagen ausgebrütet, die Jungen aber, namentlich die der letzten Brut, von beiden Eltern gemeinschaftlich mit vorher im Kropfe erweichten Sämereien aufgefüttert. Während das Weibchen auf dem Neste sitzt, kommt das Männchen oft herbeigeflogen und singt von einem der nächsten Bäume herab sehr eifrig. Im Gegensatz zu den Edelfinken leben die Hänflinge auch während der Brutzeit in Frieden zusammen. Das Hänflingspaar verläßt seine Eier nur äußerst selten, seine Jungen nie; die Alten füttern diese vielmehr auch dann noch groß, wenn man sie mit dem Nest in einen Käfig sperrt. Doch hat dies Auffütternlassen der Jungen den einen Nachteil, daß letztere wild und scheu bleiben, während diejenigen, die man selbst großzieht, bald ungemein zahm werden.
Der Hänfling ernährt sich fast ausschließlich von Sämereien, wird aber demungeachtet nirgends als erheblich schädlich angesehen, es sei denn, daß man ihm Übergriffe auf Kohl-, Rüben-, Salatsämereien und andere Nutzpflanzen unseres Gartens, die er sich allerdings zuweilen zuschulden kommen läßt, ungebührlich hoch anrechnen wolle. Unkraut liefert ihm wohl die Hauptmasse seiner Mahlzeiten. Er frißt die Samen von Wegebreit, Löwenzahn, die Sämereien aller Kohl-, Mohn-, Hanf- und Rübsenarten und namentlich Grasgesäme.
Mit Recht gilt der Hänfling als einer der beliebtesten Stubenvögel. Er ist anspruchslos wie wenig andere, befreundet sich nach kurzer Gefangenschaft innig mit seinem Gebieter und singt fleißig und eifrig fast das ganze Jahr hindurch.
An die Hänflinge erinnert, den Zeisigen ähnelt der Leinfink, Birken- oder Flachszeisig ( Carduelis linaria). Stirn und Scheitel sind lebhaft dunkel karminrot, Hinterkopf und die übrigen Oberteile matt rostbraun, Unterteile weiß, die Schwingen und Schwanzfedern tiefbraun. Das Auge ist dunkelbraun, der Oberschnabel hornblau, der Unterschnabel gelb, der Fuß graubraun. Die Länge beträgt dreizehn, die Breite zweiundzwanzig, die Fittichlänge sieben, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Das Verbreitungsgebiet umfaßt den kalten Gürtel beider Welten, soweit der Baumwuchs reicht. Von hier aus wandert der Leinfink alljährlich in südlichere Gegenden hinab und erscheint dabei zuweilen in unschätzbarer Menge auch in Deutschland. In den Alpen ersetzt ihn der Bergleinfink oder Rotleinfink ( Carduelis rufescens), in Grönland der Langschnabelleinfink ( Carduelis holboelli), der in Färbung und Größe dem Leinfinken gleicht, sich aber durch den ansehnlich größeren, lebhaft orangegelben und auf dem Firstrücken schwarzen Schnabel, der von den Federchen der Nasenlöcher höchstens zu einem Drittel bedeckt wird, von ihm unterscheidet. Der Grauleinfink ( Carduelis borealis) endlich steht dem Hänfling an Größe nicht nach, ist im allgemeinen dem Leinfinken ähnlich gefärbt, aber stets merklich heller, weil die rostbräunlichen Federsäume letzterer Art bei ihm mehr ins Blaßweiße ziehen.
Sein Brutgebiet reicht von der Petschora an durch Nordasien und Amerika hindurch bis Grönland; aber auch er erscheint wie die andern, in strengen Wintern zuweilen, immer jedoch nur selten, in mehr oder minder zahlreichen Flügen bei uns in Deutschland.
Erst wenn man die ungeheuren Birkenwaldungen des hohen Nordens durchwandert oder mindestens gesehen hat, begreift man, warum der Leinfink, auf dessen Lebensschilderung ich mich beschränken darf, nicht in jedem Winter in derselben Häufigkeit bei uns erscheint. Nur wenn im Norden der Birkensamen nicht geraten ist und er Mangel an Nahrung erleidet, sieht er sich genötigt, nach südlicheren Gegenden hinabzustreifen. So zahlreich auch die Massen sein mögen, die zuweilen bei uns vorkommen, ungleich größere Mengen verweilen jahraus jahrein in ihrer Heimat; denn die Ansprüche, die der Birkenzeisig an das Leben stellt, werden ihm im Norden viel besser als bei uns gewährt. Hunderte und Tausende von Geviertkilometern sind Birkenwaldungen, und es muß schon ein besonders ungünstiger Sommer gewesen sein, wenn diese Waldungen ihren Kindern nicht hinlängliche Nahrung mehr bieten.
Der Birkenzeisig ist in demselben Grade an jene Waldungen gebunden wie der Kreuzschnabel an den Nadelwald. Er findet in ihm zur Winterszeit Sämereien und in den Sommermonaten, während er brütet, Kerbtiere, namentlich Mücken, in größter Menge. Ich begegnete ihm in Nordwestsibirien selten, in Skandinavien, nördlich von Tromsö, dagegen recht häufig, und zwar in kleinen Familien mit seinen vielleicht vor wenigen Tagen erst dem Neste entschlüpften Jungen, die er eifrig mit Kerbtieren fütterte. Aber es war nicht leicht, ihn zu beobachten, und es wurde mir unmöglich, die von meinem Vater sehnlichst gewünschten Nestjungen zu erbeuten; denn die Wälder waren dermaßen mit Mücken erfüllt, daß eine Jagd auf die harmlosen Vögel Beschwerden und Qualen im Gefolge hatten, von denen man bei uns zulande keine Ahnung gewinnen kann. Gerade da, wo ich die Birkenzeisige fand, war jeder Baum und jeder Busch von Mückenwolken umhüllt, und der Mensch, der sich in diese Wolken wagte, wurde augenblicklich von Hunderttausenden dieser Quälgeister angefallen und so gepeinigt, daß er alle Jagdversuche sobald als nur möglich wieder aufgab. So viel aber wurde mir klar, daß unser Vogel hier während des Sommers seine Nahrung mit spielender Leichtigkeit sich erwirbt, und daß es sonderbar kommen muß, wenn er auch im Winter nicht genug zu leben haben sollte. Mücken im Sommer für alt und jung, Birkensamen im Winter: mehr braucht unser Fink zum Leben nicht.
Die eben geschilderten Umstände erklären, daß wir über das Sommerleben noch äußerst dürftig unterrichtet sind. Bald nach seiner Ankunft am Brutorte vereinzelt sich der sonst so gesellige Vogel mehr oder weniger, um zum Nisten zu schreiten. Im mittleren Skandinavien wählt er hochgelegene Waldungen der Gebirge zur Brutstätte, im Norden siedelt er sich ebensowohl in der Höhe wie in der Tiefe an, vorausgesetzt, daß die Birke den vorherrschenden Bestand bildet. Das Nest steht meist niedrig über dem Boden auf einer der hier buschartigen Birken, kommt in der Bauart dem unseres Hänflings am nächsten, ist napfförmig und besteht aus feinen Zweiglein, die den Unterbau, Halmen, Moos, Flechten und Haaren, die die Wandung, sowie endlich aus Federn, die die innere Auskleidung bilden. Die drei bis fünf, höchstens sechs, etwa siebzehn Millimeter langen, vierzehn Millimeter dicken Eier, die man kaum vor Mitte Juni findet, sind auf lichtgrünem Grunde düster rot und hellbraun gefleckt und gepunktet. Das Männchen singt, laut Collet, während der Brutzeit sehr eifrig, und zwar meist im Fliegen, brütet wahrscheinlich abwechselnd mit dem Weibchen und trägt gemeinsam mit diesem den Jungen als alleinige Atzung allerlei Kerbtiere zu. Erwähnenswert dürfte noch sein, daß der Vogel auch während der Brutzeit die ihm eigene Unstetigkeit insofern betätigt, als er in manchen Jahren an einzelnen Brutorten ungemein zahlreich und dann meist auch gesellig, an andern wiederum nur spärlich und einzeln auftritt.
Im ebenen und hügeligen Deutschland erscheint der Leinfink Anfang November als Wintergast, manchmal in sehr großer Menge. Er vereinigt sich gewöhnlich mit dem Zeisig und streift mit diesem dann, den Gebirgen nachgehend, im Lande hin und her, nachts hohe, dicke Dornhecken zur Herberge erwählend. Der Erlenzeisig ist ein ebenso harmloser als unruhiger, gewandter, munterer Gesell. Im Klettern geschickter als seine sämtlichen Verwandten, wetteifert er nicht bloß mit dem Kreuzschnabel, sondern auch mit dem beweglichen Volke der Meisen. Birken, deren fadenähnliche Zweige von einer Schar der niedlichen Vögel bedeckt sind, gewähren einen prächtigen Anblick. Hier hängt und klettert die ganze Gesellschaft in den verschiedensten Stellungen auf und nieder und klaubt sich aus den Samenzäpfchen eifrig Nahrung aus. Auch auf dem Boden hüpft er geschickt umher. Sein Flug ist schnell, wellenförmig, vor dem Aufsitzen schwebend. Bei dem Überfliegen baumloser Strecken streicht der Schwarm gern in ziemlich bedeutender Höhe dahin, wogegen er sich in baumreichen Gegenden selten mehr als nötig erhebt. Die Lockstimme ist ein wiederholt ausgestoßenes »Tschettscheck«, das namentlich beim Auffliegen aus aller Kehlen ertönt; ihr wird häufig ein zärtliches »Main« angehängt. Der Gesang besteht wesentlich aus diesen beiden Lauten, die durch ein ungeordnetes Gezwitscher verbunden und durch einen trillernden Schluß beendet werden.
Wirklich liebenswürdig zeigt sich der Birkenzeisig gegen andere seiner Art und Verwandte. Eine Schar, die sich einmal zusammenfand, trennt sich nicht mehr und ruft den einzelnen, der sich nur wenig entfernte, ängstlich herbei. Er bekundet aber auch Anhänglichkeit an die Zeisige und mischt sich, in Ermangelung dieser passenden Genossen, unter Hänflinge und Feldsperlinge. Mit allen diesen Vögeln lebt er im tiefsten Frieden; Zank und Streit kennt er überhaupt nicht.
Im Käfig geht das niedliche Vögelchen ohne alle Umstände ans Futter, wird auch in kürzester Zeit ungemein zahm, begnügt sich mit einfacher Nahrung, erfreut durch seine Beweglichkeit und die Kletterkünste, schließt sich andern kleinen Vögeln bald innig an und liebkost sie auf die verschiedenste Weise. Seine Geselligkeit wird ihm dem Vogelsteller gegenüber regelmäßig zum Verderben; denn hat man erst einen gefangen, so kann man sich anderer, die jener herbeilockt, leicht bemächtigen.
*
Die uns bekannteste Art der Sippe der Sperlinge ( Passer) ist der Haussperling, Spatz oder Lüning ( Passer domesticus). Seine Färbung ist so bekannt, daß sich jede Beschreibung erübrigt. Die Länge beträgt einhundertsechzig, die Breite zweihundertfünfzig, die Fittichlänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge siebenunddreißig Millimeter. Der Heimatskreis des Haussperlings erstreckt sich über fast ganz Europa und den größten Teil Asiens, nach Norden hinauf, soweit Ansiedlungen reichen, nach Süden hin bis Nordafrika, Palästina, Kleinasien, Indien und Ceylon. Außerdem ist er eingebürgert worden in Australien und Nordamerika, auf Java und Neuseeland, ist also Weltbürger im wahrsten Sinne des Worts geworden.
Bezeichnend für den Sperling ist, daß er überall, wo er vorkommt, in innigster Gemeinschaft mit dem Menschen lebt. Er bewohnt die volksbewegte Hauptstadt wie das einsame Dorf, vorausgesetzt, daß es von Getreidefeldern umgeben ist, fehlt nur einzelnen Walddörfern, folgt dem vordringenden Ansiedler durch alle Länder Asiens, die er früher nicht bevölkerte, siedelt sich, von Schiffen ausfliegend, auf Inseln an, woselbst er früher unbekannt war, und verbleibt den Trümmern zerstörter Ortschaften als lebender Zeuge vergangener glücklicherer Tage. Standvogel im vollsten Sinne des Wortes, entfernt er sich kaum über das Weichbild der Stadt oder die Flurgrenze der Ortschaft, in der er geboren wurde, besiedelt aber ein neu gegründetes Dorf oder Haus sofort und unternimmt zuweilen Versuchsreisen nach Gegenden, die außerhalb seines Verbreitungsgebietes liegen. So erscheinen am Varanger-Fjord fast alljährlich Sperlingspaare, durchstreifen die Gegend, besuchen alle Wohnungen, verschwinden aber spurlos wieder, weil sie das Land nicht wirtlich finden. Äußerst gesellig, trennt er sich bloß während der Brutzeit in Paare, ohne jedoch deshalb aus dem Gemeinverbande zu scheiden. Oft brütet ein Paar dicht neben dem andern, und die Männchen suchen, so eifersüchtig sie sonst sind, auch wenn ihr Weibchen brütend auf den Eiern sitzt, immer die Gesellschaft von ihresgleichen auf. Die Jungen schlagen sich sofort nach ihrem Ausfliegen mit andern in Trupps zusammen, die bald zu Flügen anwachsen. Sobald die Alten ihr Brutgeschäft hinter sich haben, finden auch sie sich wieder bei diesen Flügen ein und teilen nunmehr mit ihnen Freud und Leid. Solange es Getreide auf den Feldern gibt oder überhaupt, solange es draußen grün ist, fliegen die Schwärme vom Dorfe aus alltäglich mehrmals nach der Flur hinaus, um dort Futter zu suchen, kehren aber nach jedem Ausfluge wieder ins Dorf zurück. Hier halten sie ihre Mittagsruhe in dichten Baumkronen oder noch lieber in den Hecken, und hier versammeln sie sich abends unter großem Geschreie, Gelärme und Gezanke, entweder auf dicht belaubten Bäumen oder später in Scheunen, Schuppen und andern Gebäuden, welche Orte ihnen zur Nachtherberge werden müssen. Im Winter bereiten sie sich förmliche Betten, weich und warm ausgefütterte Nester nämlich, in denen sie sich verkriechen, um gegen die Kälte geschützt zu sein. Zu gleichem Zweck wählen sich andere Schornsteine zur Nachtherberge, ganz unbekümmert darum, daß der Rauch ihr Gefieder berußt und schwärzt.
So plump der Sperling auf den ersten Blick erscheinen mag, so wohl begabt ist er. Er hüpft schwerfällig, immerhin jedoch noch schnell genug, fliegt mit Anstrengung, unter schwirrender Bewegung seiner Flügel, durch weite Strecken in flachen Bogenlinien, sonst geradeaus, beim Niedersitzen etwas schwebend, steigt, so sehr er erhabene Wohnsitze liebt, ungern hoch, weiß sich aber trotz seiner anscheinenden Ungeschicklichkeit vortrefflich zu helfen. Er hat sich nach und nach eine Kenntnis des Menschen und seiner Gewohnheiten erworben, die erstaunlich, für jeden schärferen Beobachter erheiternd ist. überall und unter allen Umständen richtet er sein Tun aus das genaueste nach dem Wesen seines Brotherrn, ist daher in der Stadt ein ganz anderer als auf dem Dorfe, wo er geschont wird, zutraulich und selbst zudringlich, wo er Verfolgungen erleiden mußte, überaus vorsichtig und scheu; verschlagen immer. Seinem scharfen Blicke entgeht nichts, was ihm nützen, nichts, was ihm schaden könnte; sein Erfahrungsschatz bereichert sich von Jahr zu Jahr und läßt zwischen Alten und Jungen seiner Art Unterschiede erkennen, wie zwischen Weisen und Toren. Ebenso, wie mit dem Menschen, tritt er auch mit andern Geschöpfen in ein mehr oder minder freundliches Verhältnis, vertraut oder mißtraut dem Hunde, drängt sich dem Pferde auf, warnt seinesgleichen und andere Vögel vor der Katze, stiehlt dem Huhne, unbekümmert um die ihm drohenden Hiebe, das Korn vor dem Schnabel weg, frißt, falls er es tun darf, mit den verschiedenartigsten Tieren aus einer und derselben Schüssel. Ungeachtet seiner Geselligkeit liegt er doch beständig mit andern gleichstrebenden im Streite, und wenn die Liebe, die bei ihm zur heftigsten Brunst sich steigert, sein Wesen beherrscht, kämpft er mit Nebenbuhlern so ingrimmig, daß man glaubt, ein Streit auf Leben und Tod solle ausgefochten werden, obschon höchstens einige Federn zum Opfer fallen. Nur in einer Beziehung vermag der uns anziehende Vogel nicht zu fesseln. Er ist ein unerträglicher Schwätzer und ein erbärmlicher Sänger. »Schill, schelm, piep«, seine Locktöne, vernimmt man bis zum Überdrusse, und wenn eine zahlreiche Gesellschaft sich vereinigt hat, wird ihr gemeinschaftliches »Tell, tell, silb, dell, dieb, schilk« geradezu unerträglich. Nun läßt zwar der Spatz noch ein sanftes »Dürr« und »Die« vernehmen, um seinem Weibchen Gefühle der Zärtlichkeit auszudrücken; sein Gesang aber, in dem diese Laute neben den vorher erwähnten den Hauptteil bilden, kann trotzdem unsere Zustimmung nicht gewinnen, und der heftig schnarrende Warnungsruf: »Terr« oder der Angstschrei bei plötzlicher Not: »Tell, terer, tell, tell, tell« ist geradezu ohrenbeleidigend. Trotzdem schreit, lärmt und singt der Sperling, als ob er mit der Stimme einer Nachtigall begabt wäre, und schon im Neste schilpen die Jungen.
Da der Spatz durch sein Verhältnis zum Menschen sein ursprüngliches Los wesentlich verbessert und seinen Unterhalt gesichert hat, beginnt er bereits frühzeitig im Jahre mit dem Nestbaue und brütet im Laufe des Sommers mindestens drei-, wenn nicht viermal. Das Nest wird nach des Ortes Gelegenheit, meist in passenden Höhlungen der Gebäude, ebenso aber in Baumlöchern, Schwalbennestern, im Unterbaue der Storchhorste und endlich mehr oder minder frei im Gezweige niederer Gebüsche oder hoher Bäume angelegt, je nach diesen Standorten verschieden, immer aber liederlich gebaut, so daß es nur als unordentlich zusammengetragener Haufen von Stroh, Heu, Werg, Borsten, Wolle, Haaren, Papierschnitzeln und dergleichen bezeichnet werden darf, innerlich dagegen stets dick und dicht mit Federn ausgefüttert. Wenn es frei auf Bäumen steht, ist es oben überdeckt, wenn es in Höhlen angelegt wurde, bald geschlossen, bald unbedacht. Bei einigermaßen günstiger Witterung findet man bereits im März das vollzählige Gelege, das aus fünf bis sechs, ausnahmsweise wohl auch sieben bis acht dreiundzwanzig Millimeter langen und sechzehn Millimeter dicken, zarten, glattschaligen, in Färbung und Zeichnung sehr abweichenden, meist auf bräunlichbläulich oder rötlichweißem Grunde braun und aschgrau gefleckten, bespritzten und bepunkteten Eiern besteht. Beide Eltern brüten wechselweise, zeitigen die Brut in dreizehn bis vierzehn Tagen, füttern sie zuerst mit zarten Kerbtieren, später mit solchen und vorher im Kropfe aufgequellten Körnern, endlich hauptsächlich mit Getreide und andern Sämereien, auch wohl mit Früchten groß, führen sie nach den Ausflügen noch einige Tage, um sie für das Leben vorzubereiten, verlassen sie sodann und treffen bereits acht Tage, nachdem jene dem Neste entflogen, zur zweiten Brut Anstalt. Wird einer der Gatten getötet, so strengt sich der andere um so mehr an, um die hungrige Schar zu ernähren; vermag ein Junges das Nest nicht zu verlassen, so füttern es die Eltern, solange es seiner Freiheit entbehrt.
Über Nutzen und Schaden des Sperlings herrschen sehr verschiedene Ansichten; doch einigt man sich neuerdings mehr und mehr zu der Meinung, daß der auf Kosten des Menschen lebende Schmarotzer dessen Schutz nicht verdient. In den Straßen der Städte und Dörfer verursacht er allerdings keinen Schaden, weil er sich hier wesentlich vom Abfalle ernährt; auf großen Gütern, Kornspeichern, Getreidefeldern und in Gärten dagegen kann er empfindlich schädlich werden, indem er dem Hausgeflügel die Körnernahrung wegfrißt, das gelagerte Getreide brandschatzt und beschmutzt, in den Gärten endlich die Knospen der Obstbäume abbeißt und später auch die Früchte verzehrt. In Gärten und Weinbergen ist er daher nicht zu dulden. Der wesentlichste Schaden, den er verursacht, besteht übrigens, wie Eugen von Homeyer richtig hervorhebt, darin, daß er die allernützlichsten Vögel, namentlich Stare und Meisen, verdrängt und den Sängern den Aufenthalt in solchen Gärten, die er beherrscht, mehr oder weniger verleidet.
Zum Käfigvogel eignet sich der Sperling nicht, obwohl er sehr zahm werden kann.
In Mittel- und Nordeuropa, ganz Mittelasien und ebenso in Nordafrika lebt neben dem Hausspatz ein anderes Mitglied der Familie, der Feldsperling ( Passer montanus). Seine Länge beträgt einhundertvierzig, seine Breite zweihundertfünf, die Fittichlänge fünfundsechzig, die Schwanzlänge fünfundfünfzig Millimeter. Oberkopf, Schläfen und Nacken sind mattrotbraun, die Unterteile bräunlichweiß. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß rötlich hornfarben. Der Feldsperling ist in Mitteleuropa allerorten häufig, in Südwesteuropa sehr selten, in ganz Mittelasien überaus gemein, selbst noch auf Malakka und Java heimisch, dringt bis in den Polarkreis vor, ersetzt am untern Ob, in China, Japan, auf Formosa und in Indien den Haussperling und ist in Australien wie auf Neuseeland mit Erfolg eingebürgert worden. Abweichend von unserm Spatz, bevorzugt er bei uns zulande und ebenso in Westsibirien das freie Feld und den Laubwald, Dörfer und Städte. Zu den Wohnungen der Menschen kommt er im Winter; im Sommer hingegen hält er sich da auf, wo Wiesen mit Feldern abwechseln, und alte, hohle Bäume ihm geeignete Nistplätze gewähren. Hier lebt er während der Brutzeit paarweise, gewöhnlich aber in Gesellschaften. Diese streifen in beschränkter Weise im Lande hin und her, mischen sich unter Goldammern, Lerchen, Finken, Grünlinge, Hänflinge und andere, besuchen die Felder oder, wenn der Winter hart wird, die Gehöfte des Landmannes und zerteilen sich in Paare, wenn der Frühling beginnt.
In seinem Wesen ähnelt der Feldsperling seinem Verwandten sehr, ist aber, weil ihm der innige Umgang mit den Menschen mangelt und Gelegenheit zur Ausbildung fehlt, nicht so klug als dieser. Er trägt sein Gefieder knapp, ist keck, ziemlich gewandt und fast immer in Bewegung. Sein Flug ist leichter, der Gang auf dem Boden geschickter, der Lockton kürzer, gerundeter als der seines Vetters, demungeachtet jedoch ein echtes Sperlingsgeschrei, das nicht verkannt werden kann.
Vom Herbste bis zum Frühling bilden Körner und Sämereien, im Sommer Raupen, Blattläuse und anderes Ungeziefer die Nahrung des Feldspatzes. Auf Weizen- und Hirsefeldern richtet er zuweilen Schaden an; dagegen läßt er die Früchte und die keimenden Gartenpflanzen unbehelligt. Seine Jungen füttert er mit Kerbtieren und mit milchigen Getreidekörnern auf.
Die Brutzeit beginnt im April und währt bis in den August; denn auch der Feldspatz brütet zwei- bis dreimal im Jahre. Das Nest, das immer in Höhlungen, vorzugsweise in Baumlöchern, seltener in Feldspalten, oder an entsprechenden Stellen in Gebäuden, in Ungarn regelmäßig auch in dem Unterbau großer Raubvogel-, zumal Adlerhorste steht, gleicht in seiner Bauart den Brutstätten seines Verwandten. Das Gelege besteht aus fünf bis sieben Eiern, die denen des Haussperlings sehr ähneln, aber etwas kleiner, durchschnittlich neunzehn Millimeter lang und vierzehn Millimeter dick sind. Männchen und Weibchen brüten abwechselnd und zeitigen die Eier in dreizehn bis vierzehn Tagen.
*
Der Steinsperling ( Petronia stulta), Vertreter der Sippe der Felsensperlinge ( Petronia), ist oberseits erdbraun, der Mantel dunkelbraun, das obere Schwanzdeckgefieder an der Spitze fahlweiß, das der Backen und Halsseiten einfarbig erdbräunlich, das der Unterseite gelblichweiß. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel ölgelb, der Oberschnabel dunkler, der Fuß rötlich hornfarben. Die Länge beträgt einhundertundsechzig, die Breite zweihundertundneunzig, die Fittichlänge neunzig, die Schwanzlänge sechsundfünfzig Millimeter.
Das Verbreitungsgebiet des Steinsperlings umfaßt Mittel- und Südeuropa. In Deutschland, wo er durchaus nicht zu den häufigen Vögeln gehört, findet man ihn einzeln in felsigen Gegenden oder als Bewohner alter verfallener Gebäude, namentlich Ritterburgen, so auf der Lobedaburg bei Jena, hier und da im Harz, an der Mosel und am Rhein. Von Südfrankreich an tritt er regelmäßiger auf, und in Spanien, Algerien, auf den Kanarischen Inseln, in Süditalien, in Griechenland, Dalmatien, Montenegro, Palästina und Kleinasien zählt er unter die gemeinen Vögel des Landes, bewohnt hier alle geeigneten Orte, Dörfer und Städte ebensowohl wie die einsamsten Felstäler und bildet nach Art seiner Verwandten sogar Siedlungen. In die Straßen der Städte und Dörfer kommt er nur höchst selten herab, fliegt vielmehr regelmäßig nach der Flur hinaus, um hier Nahrung zu suchen. Scheu und Vorsicht bekundet er stets. Er will auch da, wo er wenig mit dem Menschen zusammenkommt, nichts mit diesem zu tun haben.
In seinen Bewegungen unterscheidet sich der Steinsperling wesentlich von seinen Verwandten. Er fliegt schnell, mit schwirrenden Flügelschlägen, schwebt vor dem Niedersetzen mit stark ausgebreiteten Flügeln und erinnert viel mehr an den Kreuzschnabel als an den Spatz. Auf dem Boden hüpft er ziemlich geschickt umher; im Sitzen nimmt er eine kecke Stellung an und wippt häufig mit dem Schwanze. Sein Lockton ist ein schnalzendes, dreisilbiges »Giüib«, bei dem der Ton auf die letzten Silben gelegt wird, der Warnungsruf ein sperlingsartiges »Errr«, das man jedoch auch sofort erkennen kann, der Gesang ein einfaches, oft unterbrochenes Zwitschern und Schwirren, das in mancher Hinsicht an das Lied des Gimpels erinnert, jedoch nicht gerade angenehm klingt. Hinsichtlich seiner sonstigen Lebensgewohnheiten gilt höchstwahrscheinlich dasselbe, was wir von den übrigen Sperlingen erfahren haben. Während des Sommers verzehren die Steinsperlinge vorzugsweise Kerbtiere, im Winter Sämereien, Beeren und dergleichen. Auf den Landstraßen durchwühlen sie nach Art der Feld- und Haussperlinge den Mist nach Körnern.
In der Gefangenschaft verursacht der Steinsperling wenig Mühe, gewährt aber viel Vergnügen. Er wird bald zutraulich, verträgt sich mit andern Vögeln vortrefflich, erfreut durch die Anmut seines Betragens und schreitet bei geeigneter Pflege auch wohl zur Fortpflanzung.
*
Der Kernbeißer, Kirschfink oder Kirschkernbeißer ( Coccothraustes vulgaris) bildet mit seinen Verwandten eine sehr ausgezeichnete, nach ihm benannte Sippe ( Coccothraustes), die durch sehr kräftigen, gedrungenen Bau, ungemein großen, dicken, völlig kreiselförmigen, an den etwas gebogenen, scharfen Schneiden wenig eingezogenen, vor der Spitze des Oberschnabels undeutlich ausgeschnittenen Schnabel, kurze, aber kräftige und stämmige, mit mittellangen, scharfspitzigen Krallen bewehrte Füße, verhältnismäßig breite Flügel, sehr kurzen, in der Mitte deutlich ausgeschnittenen Schwanz und dichtes und weiches Gefieder sich auszeichnet. Die Länge beträgt achtzehn, die Breite einunddreißig, die Fittichlänge zehn, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Stirn und Vorderscheitel sind braungelb, Oberkopf und Kopfseiten gelbbraun, ein schmaler Stirnstreifen, Zügel und Kehle schwarz, Nacken und Hinterhals aschgrau, der Oberrücken schokolade-, der Unterrücken hell kastanienbraun, Kropf und Brust schmutzig graurot, der Bauch grauweiß, Aftergegend und Unterschwanzdecken reinweiß, die Schwingen, mit Ausnahme der beiden letzten braunschwarzen, metallischblau glänzend, innen mit einem weißen Fleck an der Wurzel geziert, die mittleren Schwanzfedern an der Wurzel schwarz, in der Endhälfte außen gelbbraun, am Ende weiß, die übrigen an der Wurzel schwarz, innen in der Endhälfte weiß, die beiden äußersten außen schwarz, alle am Ende weiß gesäumt. Das Auge ist graurot, der Schnabel im Frühling blau, im Herbst horngelb, der Fuß fleischfarben. Beim Weibchen ist der Oberkopf hell gelblichgrau, die Unterseite grau, der Oberflügel großenteils gelblich. Im Jugendkleide sind Kehle und Zügel dunkel braungrau, Kropf und Hals hellgelb, Scheitel, Wangen und Hinterkopf dunkel rostgelb, Nacken, Halsseiten und Gurgel lehmgelb, die Federn graulichgelb umrandet, die des Mantels matt braungelb, der Kehle hellgelb, des Oberhalses graugelblich, die der übrigen Unterteile schmutzigweiß, seitlich ins Rostfarbene ziehend, überall mit halbmondförmigen, dunkelbraunen Querflecken gezeichnet.
Als Heimat des Kernbeißers sind die gemäßigten Länder Europas und Asiens anzusehen. Seine Nordgrenze erreicht er in Schweden und in den westlichen und südlichen Provinzen des europäischen Rußlands. In Deutschland sieht man ihn oft auch im Winter, wahrscheinlich aber bloß als Gast, der aus dem nördlicheren Europa gekommen ist, wogegen die bei uns lebenden Brutvögel regelmäßig wandern. In Südeuropa erscheint er nur auf dem Zuge. Bei uns ist er hier häufig, dort seltener, aber überall bekannt, weil er auf seinen Streifereien allerorten sich zeigt und jedermann auffällt. Er wählt zu seinem Sommeraufenthalte hügelige Gelände mit Laubwaldungen und hohen Bäumen, auf denen er sich, falls er nicht in eine benachbarte Kirschenpflanzung plündernd einfällt oder im anstoßenden Felde auf dem Boden sich zu schaffen macht, den ganzen Tag über verweilt und ebenso die Nacht verbringt. Nach der Brutzeit streift er mit seinen Jungen im Lande umher und kommt bei dieser Gelegenheit auch in die Kirsch- und Gemüsegärten herein. Zu Ende des Oktober oder im November beginnt er seine Wanderschaft, im März kehrt er wieder zurück; einzeln aber kommt er auch viel später an; so habe ich ihn am 1. Mai auf dem Zuge bei Madrid beobachtet.
Der Kernbeißer ist, wie sein Leibesbau vermuten läßt, ein etwas plumper und träger Vogel. Er pflegt lange auf einer und derselben Stelle zu sitzen, regt sich wenig, bequemt sich auch erst nach einigem Besinnen zum Abstreichen, fliegt nur mit Widerstreben weit und kehrt beharrlich zu demselben Orte zurück, von dem er verjagt wurde. Im Gezweige der Bäume bewegt er sich ziemlich hurtig, auf der Erde dagegen, dem schweren Leibe und den kurzen Füßen entsprechend, ungeschickt; auch sein Flug ist schwerfällig und rauschend, erfordert unaufhörliche Flügelbewegungen, beschreibt seichte Bogenlinien und geht nur vor dem Aufsitzen in Schweben über, fördert aber trotzdem rasch. Er ist ein sehr vorsichtiger und listiger Gesell, der seine Feinde bald kennenlernt und mit Schlauheit auf seine Sicherung Bedacht nimmt.
Am liebsten verzehrt der Kirschkernbeißer die von einer harten Schale umgebenen Kerne verschiedener Baumarten. »Die Kerne der Kirschen und der Weiß- und Rotbuchen«, schildert mein Vater, »scheint er allen andern vorzuziehen. Er beißt die Kirsche ab, befreit den Kern von dem Fleische, das er wegwirft, knackt ihn auf, läßt die steinige Schale fallen und verschluckt den eigentlichen Kern. Dies alles geschieht in einer halben, höchstens ganzen Minute und mit so großer Gewalt, daß man das Aufknacken auf dreißig Schritte hören kann. Mit dem Samen der Weißbuche verfährt er auf ähnliche Weise. Die von der Schale entblößten Kerne gehen durch die Speiseröhre gleich in den Magen über, und erst wenn dieser voll ist, wird der Kropf mit ihnen angefüllt. Wenn die Bäume von den ihnen zur Nahrung dienenden Sämereien entblößt sind, sucht er sie auf der Erde auf; deshalb sieht man ihn im Spätherbst und Winter oft auf dem Boden umherhüpfen. Außerdem frißt er auch Kornsämereien gern, geht deshalb im Sommer oft in die Gemüsegärten und tut den Sämereien großen Schaden. Es ist kaum glaublich, wieviel ein einziger solcher Vogel von den verschiedenen Kohl- und Krautarten zu Grunde richten kann.« Im Winter geht er, ebenfalls nur der Kerne wegen, fleißig auf die Vogelbeerbäume. Außerdem verzehrt er Baumknospen und im Sommer sehr oft auch Kerbtiere, besonders Käfer und deren Larven. »Nicht selten«, berichtet Naumann, »fängt er die fliegenden Maikäfer in der Luft und verzehrt sie dann, auf einer Baumspitze sitzend, stückweise, nachdem er zuvor Flügel und Füße derselben als ungenießbar weggeworfen hat. Ich habe ihn auch auf frisch gepflügte Acker, wohl einige hundert Schritt vom Gebüsch, fliegen, dort Käfer auflesen und seinen Jungen bringen sehen.«
Je nachdem die Witterung günstig oder ungünstig ist, nistet der Kernbeißer ein- oder zweimal im Jahre, im Mai und Anfang Juli. Jedes Paar erwählt sich ein umfangreiches Nistgebiet und duldet in diesem kein anderes seiner Art. »Das Männchen hält deshalb immer oben auf den Baumspitzen Wache und wechselt seinen Sitz bald auf diesen, bald auf jenen hohen Baum, schreit und singt dabei und zeigt außerordentliche Unruhe.« Schwirrende und scharfe Töne, die dem wie »Zi« oder »Zick« klingenden Locktone sehr ähnlich sind, bilden den Gesang, der von dem Männchen stundenlang unter allerlei Wendungen des Leibes vorgetragen wird. Das nicht gerade dickwandige, aber doch recht gut gebaute, ansehnlich breite und daher leicht kenntliche Nest steht hoch oder tief, auf schwachen oder dünnen Zweigen, gewöhnlich aber gut versteckt. Seine erste Unterlage besteht aus dürren Reisern, starken Grashalmen, Würzelchen und dergleichen, die zweite Lage aus gröberem oder feinerem Baummoose und Flechten, die Ausfütterung aus Wurzelfasern, Schweinsborsten, Pferdehaaren, Schafwolle und ähnlichen Stoffen. Die drei bis fünf Eier sind vierundzwanzig Millimeter lang, siebzehn Millimeter dick, ziemlich bauchig und auf schmutzig oder grünlich und gelblich aschgrauem Grunde mit deutlichen und verwaschenen braunen, schwarzbraunen, dunkel aschgrauen, hell- und ölbraunen Flecken, Strichen und Äderchen gezeichnet, um das stumpfe Ende herum am dichtesten. Das Weibchen brütet mit Ausnahme der Mittagsstunden, um welche Zeit es das Männchen ablöst. Die Jungen werden von beiden Eltern gefüttert, sehr geliebt und noch lange nach dem Ausfliegen geführt, gewartet und geatzt; denn es vergehen Wochen, bevor sie selbst imstande sind, die harten Kirschkerne zu knacken.
Der Kernbeißer macht sich dem Obstgärtner sehr verhaßt; denn der Schaden, welchen er in Kirschpflanzungen anrichtet, ist durchaus nicht unbedeutend. »Eine Familie dieser Vögel«, sagt Naumann, »wird mit einem Baum voll reifer Kirschen bald fertig. Sind sie erst einmal in einer Anpflanzung gewesen, so kommen sie gewiß immer wieder, solange es daselbst noch Kirschen gibt, und alles Lärmen, Klappern, Peitschenknallen und Pfeifen hält sie nicht gänzlich davon ab; alle aufgestellten Scheuchen werden sie gewohnt. Schießen ist das einzige Mittel, sie zu verscheuchen, und dies darf nicht blind geschehen, sonst gewöhnen sie sich auch hieran. Die gewöhnlichen sauren Kirschen sind ihren Anfällen am meisten ausgesetzt. In den Gemüsegärten tun sie oft großen Schaden an den Sämereien und in den Erbsenbeeten an den grünen Schoten. Sie zerschroten dem Jäger seine Beeren auf den Ebereschbäumen und richten andern Unfug an.« Es ist daher kein Wunder, daß der Mensch sich dieser ungebetenen Gäste nach Kräften zu erwehren sucht.
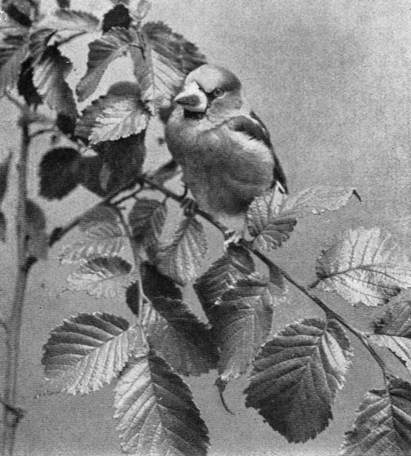
Kirschkernbeißer ( Coccotraustes vulgaris)
Gefangen, gewöhnt sich der Kernbeißer bald ein, nimmt mit allerlei Futter vorlieb, wird auch leicht zahm, bleibt aber immer gefährlich, weil er, erzürnt, empfindlich um sich und in alles beißt, was ihm vor den Schnabel kommt.
*
Kernbeißer mit Hakenschnabel, kurzen Flügeln und langem Schwanz sind die Papageifinken (Pytilinae). Zu dieser Unterfamilie gehört der auch in Europa wohlbekannte Kardinal oder Rotvogel ( Cardinalis virginianus), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Cardinalis), die durch kurzen, kräftigen und spitzigen, an der Wurzel sehr breiten, auf der Firste gekrümmten, oben in der Mitte stark ausgebuchteten Schnabel, sowie durch einen aufrichtbaren Schopf gekennzeichnet ist. Seine Länge beträgt zwanzig, die Breite sechsundzwanzig, die Fittichlänge sieben, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Die vorherrschende Färbung des Gefieders ist ein lebhaftes Scharlachrot. Der Augenring ist rotbraun, der Schnabel rot, der Unterschnabel an der Wurzel schwarz, der Fuß braun.

Grauer Kardinal ( Cardinalis virginianus)
Das Verbreitungsgebiet des Kardinals umfaßt die südlichen Vereinigten Staaten, Mexiko und Kalifornien. In gelinden Wintern verweilt er jahraus, jahrein an demselben Orte; bei strengerer Witterung wandert er. Wegen seines prachtvollen Gefieders fällt er schon von weitem in die Augen und bildet eine wahre Zierde des Waldes. Nach Prinz von Wied hält er sich am Tage gern in den dichtverworrenen Zweigen der Schlingpflanzen auf und streift von hier aus nach den benachbarten Feldern und Gärten; man begegnet ihm daher ebensowohl in der Nachbarschaft der Städte als im tiefsten und einsamsten Walde. Während des Sommers lebt er paarweise, im Herbst und Winter dagegen in kleinen Gesellschaften. Bei strenger Kälte kommt er, wenn er im Lande bleibt, nicht selten in das Gehöft des Bauern und pickt hier vor der Scheuer mit Sperlingen, Tauben, Schneevögeln, Ammerfinken und andern Gesäme auf, dringt in offene Ställe und Böden oder sucht an den Einhegungen der Gärten und Felder nach Nahrung. Mit seinem dicken Schnabel weiß er die harten Körner des Maises geschickt zu zerkleinern, Hafer zu enthülsen und Weizen zu zermalmen; in einem benachbarten Heuschober oder einem dichtwipfeligen Baume findet er eine geeignete Nachtherberge, und so übersteht er den Winter ziemlich leicht. Unruhig und unstet, hält er so sich nur minutenlang an einer und derselben Stelle auf, sonst hüpft und fliegt er hin und her, auf dem Boden mit ziemlicher Geschicklichkeit, im Gezweige mit großer Gewandtheit. Der Flug ist hart, schnell, ruckweise und sehr geräuschvoll, wird aber ungern weit ausgedehnt. Wechselseitiges Ausbreiten und Zusammenlegen, Zucken und Wippen des Schwanzes begleitet ihn wie alle übrigen Bewegungen. Wenn er wandert, reist er teilweise zu Fuß, hüpft und schlüpft von Busch zu Busch und fliegt von einem Walde zum andern.
Während der Paarzeit stürzen sich die Männchen mit Wut auf jeden Eindringling in ihr Gehege, folgen ihm unter schrillem Geschrei von Busch zu Busch, fechten heftig in der Luft mit ihm und ruhen nicht eher, als bis der Fremde ihr Gehege verlassen hat. Innig ist die Anhänglichkeit der Gatten. »Als ich«, sagt Audubon, »gegen Abend eines Februartages das Männchen eines Paares im Stellbauer gefangen hatte, saß am andern Morgen das Weibchen dicht neben dem Gefangenen, und später fing es sich auch noch.« Der Nistplatz ist ein Busch oder ein Baum nahe am Gehöfte, inmitten des Feldes, am Waldrande oder im Dickichte. Nicht selten findet man das Nest in unmittelbarer Nähe eines Bauernhauses. Es besteht aus trockenen Blättern und Zweigen, namentlich stacheligen Reisern, die mit Halmen und Rebenschlingen verbunden, innen aber mit zarten Grashalmen ausgelegt sind. Vier bis sechs Eier von schmutzigweißer Farbe, über und über mit olivenbraunen Flecken gezeichnet, bilden das Gelege. Sie haben Ähnlichkeit in der Färbung mit denen der Kalanderlerche oder mit denen unsers gemeinen Haussperlings, ändern aber sehr ab. In den nördlicheren Staaten brütet das Paar selten mehr als einmal, in den südlichen zuweilen dreimal im Jahr. Die Jungen werden nur wenige Tage von ihren Eltern geführt, dann aber ihrem Schicksal überlassen.
Allerlei Körner, Getreide- und Grassämereien, Beeren und wahrscheinlich auch Kerbtiere bilden die Nahrung. Im Frühling verzehrt er die Blüten des Zuckerahorns, im Sommer Holderbeeren, nebenbei jagt er eifrig nach Käfern, Schmetterlingen, Heuschrecken, Raupen und andern Kerbtieren. Nach Wilson soll Mais seine Hauptnahrung sein und er außerdem den Kirschen, Äpfeln und Beeren der Kerne wegen sehr nachgehen.
Die amerikanischen Forscher rühmen ziemlich einstimmig den Gesang. »Die Töne des Kardinals«, sagt Wilson, »sind denen der Nachtigall vollständig gleich. Man hat ihn oft ›Virginische Nachtigall‹ genannt, und er verdient seinen Namen wegen der Klarheit und Verschiedenheit seiner Töne, die ebenso wechselnd als klangvoll sind.« In gleichem Sinn spricht sich Audubon aus. »Der Gesang ist zuerst laut und klar und erinnert an die schönsten Töne des Flageolets; mehr und mehr aber sinkt er herab, bis er gänzlich erstirbt. Während der Zeit der Liebe wird das Lied dieses prachtvollen Sängers mit großer Macht vorgetragen. Er ist sich seiner Kraft bewußt, schwellt seine Brust, breitet seinen rosigen Schwanz, schlägt mit seinen Flügeln und wendet sich abwechselnd zur Rechten und zur Linken, als müsse er sein eigenes Entzücken über die wundervollen Töne seiner Stimme kundgeben. Von neuem und immer von neuem werden diese Weisen wiederholt; denn der Vogel schweigt nur, um Luft zu schöpfen. Man hört ihn lange, bevor die Sonne den Himmel im Osten vergoldet, bis zu der Zeit, wenn das flammende Gestirn Licht und Wärme herniedersendet und alle Vögel zu zeitweiliger Ruhe zwingt; sobald die Natur aber wieder aufatmet, beginnt der Sänger von neuem und ruft, als habe er niemals seine Brust angestrengt, das Echo wach in der ganzen Nachbarschaft, ruht auch nicht eher, als bis die Abendschatten um ihn sich verbreiten. Tag für Tag verkürzt der Rotvogel das langweilige Geschäft des brütenden Weibchens, und von Zeit zu Zeit stimmt auch dieses mit ein mit der Bescheidenheit ihres Geschlechtes. Wenige von uns verweigern diesem ansprechenden Sänger den Zoll der Bewunderung. Wie erfreulich ist es, wenn bei bedecktem Himmel Dunkel die Wälder deckt, so daß man meint, die Nacht sei schon hereingebrochen, wie erfreulich, plötzlich die wohlbekannten Töne dieses Lieblingsvogels zu vernehmen! Wie oft habe ich mich dieses Vergnügens erfreut, und wie oft möchte ich mich dessen noch erfreuen!«
*
Auf die Papageifinken will ich die Gimpel ( Pyrrhulinae) folgen lassen. Bezeichnend für sie sind der kurze, dicke, allseitig gewölbte Schnabel mit kleinen Haken am Oberkiefer, der kurze und mittelstarke Fuß, der mittellange, stumpfspitzige Flügel, der meist kurze, wenig ausgeschnittene Schwanz und das mehr oder minder lange und weiche, gewöhnlich sehr zart gefärbte Gefieder. Mit Ausnahme Australiens verbreiten sich die Gimpel über alle Erdteile, gehören jedoch hauptsächlich dem gemäßigten und kalten Gürtel an.
Der in Deutschland heimische Vertreter der Sippe der Girlitze ( Serinus) ist der Girlitz ( Serinus hortulanus). Seine Länge beträgt einhundertfünfundzwanzig, seine Breite zweihundertzehn, seine Fittichlänge siebenundsechzig, seine Schwanzlänge fünfzig Millimeter. Die vorherrschende Färbung des Gefieders ist ein schönes Grün; Hinterkopf, Rücken und Schultern sind grüngelb, durch verwaschene schwärzliche Längsflecke gezeichnet. Der Bürzel und die Unterteile sind goldgelb, nach dem Bauch zu sich lichtend und auf den Unterschwanzdecken in Weiß übergehend, die Brust und Bauchseiten mit großen, dunkelschwarzen Längsflecken gezeichnet. Der Augenring ist hellbraun, der Schnabel horngrau, unterseits rötlichgrau, der Fuß gelblich fleischfarben. Bei dem kleineren Weibchen ist das der Hauptfärbung nach grüngelbe Gefieder fast überall mit schwarzen Längsflecken gezeichnet. Die Jungen ähneln den Weibchen, unterscheiden sich aber durch sehr blasse, fast weißliche Grundfärbung. Ursprünglich im Süden Europas und in Kleinasien heimisch, hat sich der Girlitz allmählich nach Norden hin verbreitet, tut dies auch gegenwärtig noch und bürgert sich weiter und weiter vorschreitend in Gebieten ein, in denen er vor einem Menschenalter vollständig fehlte.

Girlitz ( Serinus hortulanus)
Bei uns zulande ist der Girlitz ein Wandervogel, der regelmäßig im Frühjahr, und zwar in den letzten Tagen des März oder in den ersten Tagen des April erscheint und bis in den Spätherbst verweilt. In ganz Südeuropa streicht er während des Winters höchstens von einem Ort zum andern, ohne jedoch eine wirkliche Wanderung zu unternehmen. Hier tritt er überall häufiger auf als in Deutschland, bevölkert jede Örtlichkeit und fehlt selbst auf ziemlich hohen Berggipfeln nicht. Baumgärten, in deren Nähe Gemüsepflanzungen sind, sagen ihm am meisten zu; deshalb findet er sich in Deutschland an einzelnen Stellen sehr häufig, während er an andern, nahe liegenden nicht vorkommt.
Der Girlitz ist ein schmucker, lebendiger und anmutiger Vogel, immer munter und gutgelaunt, gesellig und friedliebend, solange die Liebe nicht trennt, vereinzelt und zum Kampf treibt. Die ersten Ankömmlinge bei uns sind stets Männchen; die Weibchen folgen später nach. Erstere machen sich sogleich durch ihren Gesang und ihr unruhiges Treiben bemerkbar, setzen sich auf die höchsten Baumspitzen, lassen die Flügel hängen, erheben den Schwanz ein wenig, drehen sich beständig nach allen Seiten und singen dabei sehr eifrig. Je näher die Begattungszeit kommt, um so eifriger trägt der Vogel sein Liedchen vor, und um so sonderbarer gebärdet er sich. Nicht genug, daß er mit den zärtlichsten Tönen um Liebe bittet, er legt sich auch wie ein Kuckuck platt auf einen Ast, sträubt die Kehlfedern wie ein balzender Hahn, breitet den Schwanz weit aus, dreht und wendet sich, erhebt sich plötzlich, steigt in die Luft, flattert, ungleichmäßig schwankend, fledermausartig um den Baum, wirft sich bald nach der einen, bald nach der andern Seite und kehrt dann auf den früheren Sitzplatz zurück, um seinen Gesang fortzusetzen. Andere Männchen in der Nähe wecken die Eifersucht des Sängers; dieser bricht plötzlich ab und stürzt sich erbost auf den Gegner; letzterer entflieht in behendem Flug; und so jagen sich beide wütend längere Zeit umher, durch die belaubten Bäume hindurch oder auch sehr nahe über den Boden hinweg, wobei sie ohne Unterbrechung ihren Zorn durch ein helles »Sisisi« bekunden. Erst nach langwierigem Kampf, und wenn das Weibchen brütet, endet dieser Zank und Streit. Den Gesang vergleicht Hoffmann treffend mit dem Gesang der Heckenbraunelle und deutet an, daß der einzige Unterschied, der zwischen beider Liedern bemerkt wird, wohl nur auf den dickeren Finkenschnabel zurückzuführen sei, der die Töne selbst verhärtet. Ausgezeichnet kann man das Lied gerade nicht nennen; es ist zu einförmig und enthält zu viel schwirrende Klänge; doch muß ich gestehen, daß es mich immer angesprochen hat. Der Name »Hirngritterl« ist gewissermaßen ein Klangbild desselben.
Das Nest, ein kleiner, dem unsers Edelfinken am meisten ähnelnder Kunstbau, ist ziemlich verschieden zusammengesetzt, zuweilen fast nur aus dünnen Würzelchen, zuweilen aus Halmen, Gras und Heu erbaut und innen äußerst fein und weich mit Haaren und Federn ausgelegt. Es steht bald höher, bald tiefer, immer aber möglichst verborgen im dichten Gezweig eines Busches oder Baumes. Nach Hoffmann soll der Girlitz eine ganz besondere Vorliebe für den Birnbaum zeigen und auf diesem, wo es nur immer angeht, sein Nest anlegen; er brütet aber auch auf Apfel- und Kirsch- oder auf Nadelbäumen und nach den neueren Beobachtungen nicht minder auf Schwarzholz, zeigt sich überhaupt in dieser Beziehung nicht wählerisch. Das Gelege enthält vier bis fünf kleine, stumpfbauchige, sechzehn Millimeter lange, zwölf Millimeter dicke Eier, die auf schmutzigweißem oder grünlichem Grund überall, am stumpfen Ende jedoch mehr als an der Spitze, mit mattbraunen, roten, rotgrauen, purpurschwarzen Punkten, Flecken und Schnörkeln gezeichnet sind. In Spanien fand ich vom April bis zum Juli fortwährend frisch gelegte Eier; in Deutschland beginnt die Brutzeit um die Mitte des April. Höchstwahrscheinlich macht ein und dasselbe Paar mindestens zwei Bruten im Jahr. Solange das Weibchen brütet, wird es von dem Männchen aus dem Kropf gefüttert. »Wenn es nun Hunger hat«, sagt Hoffmann, »so ruft es das Männchen, und zwar mit demselben Ton, den dieses bei seinen Minnekämpfen hören läßt, nur etwas leiser.« Es brütet sehr fest und bleibt ruhig sitzen, wenn tagelang Feld- oder Gartenarbeiten unter seinem Nest versehen werden. Nach ungefähr dreizehn Tagen sind die Jungen ausgeschlüpft. Solange sie im Nest sitzen, verlangen sie durch ein leises »Zickzick« oder »Sittsitt« nach Nahrung. Gegen das Ende ihres Wachstums hin werden sie sehr unruhig, und oft fliegen sie früher aus, als sie sollten. Die Eltern füttern sie eine Zeitlang noch eifrig, auch wenn man sie in einen Bauer kerkert und diesen in der Nähe des Nestplatzes aufhängt. Nach der Brutzeit gesellen sich die vereinzelten Paare nebst ihren Jungen den früher ausgeflogenen und gescharten, vereinigen sich auch wohl mit Stieglitzen, Hänflingen, Feldsperlingen und anderen Familienverwandten, treten mit letzteren jedoch nicht in engeren Verband, sondern bewahren sich stets eine gewisse Selbständigkeit. Diese Schwärme streifen fortan im Lande umher und suchen gemeinsam ihre Nahrung, die fast nur aus feinen Sämereien und Pflanzenschossen besteht, ohne dem Menschen irgendwie lästig zu werden. Im Käfig ist unser Vögelchen recht angenehm, dauert jedoch nicht so gut aus, als man von vornherein annehmen möchte.
»Dreihundert Jahre sind verflossen«, sagt Bolle, »seit der Kanarienvogel durch Zähmung über die Grenzen seiner wahren Heimat hinausgeführt und Weltbürger geworden ist. Der gesittete Mensch hat die Hand nach ihm ausgestreckt, ihn verpflanzt, vermehrt, an sein eigenes Schicksal gefesselt und durch Wartung und Pflege zahlreich aufeinanderfolgender Geschlechter so durchgreifende Veränderungen an ihm bewirkt, daß wir jetzt fast geneigt sind, mit Linné und Brisson zu irren, indem wir in dem goldgelben Vögelchen das Urbild der Art erkennen möchten und darüber die wilde, grünliche Stammart, die unverändert geblieben ist, was sie von Anbeginn her war, beinahe vergessen haben. Das helle Licht, in dem der zahme Kanarienvogel vor uns steht, die genaue und erschöpfende Kenntnis, die wir von seinen Sitten und Eigentümlichkeiten besitzen, scheint nebelnder Entfernung, in der der wilde von uns lebt, die Hauptursache der ziemlich geringen Auskunft zu sein, die wir über letzteren besitzen.«
Es bedurfte eines Bolle, um das Freileben des Kanarienvogels zu schildern. Alle Naturforscher vor ihm, Alexander von Humboldt allein ausgenommen, berichten uns wenig oder, wenn überhaupt etwas, Wahres und Falsches so verquickt, daß es schwer hält, das eine von dem andern zu trennen. Erst Bolles Schilderung, die ich nachstehend im Auszug wiedergebe, bietet uns ein ebenso treues als farbenreiches Bild des wichtigen Vogels. Unser Forscher fand diesen auf den fünf Waldinseln der Kanarischen Gruppe, Gran Canaria, Teneriffa, Gomera, Palma und Ferro, glaubt aber, daß derselbe früher noch auf mehreren andern, jetzt entwaldeten Inseln vorgekommen sein mag, ebenso wie er auf Madeira und den Inseln des Grünen Vorgebirges heimisch ist. Auf den genannten Eilanden lebt er überall, wo dicht wachsende Bäume mit Gestrüpp abwechseln, vorzugsweise längs der mit üppigem Grün umsäumten Wasserbetten jener Inseln, die während der Regenzeit Bäche sind, während der trockenen Zeit aber versiegen, nicht minder häufig in den Gärten um die Wohnungen des Menschen. Seine Verbreitung erstreckt sich von der Meeresküste bis zu über fünfzehnhundert Meter unbedingter Höhe im Gebirge hinauf. Wo die Bedingungen zu seinem Wohlbefinden gegeben, ist er überall häufig, in den Weinbergen der Inseln gemein, auch in Kieferbeständen, die die Abhänge des Gebirges bekleiden, nicht selten; nur das Innere des schattigen Hochwaldes, dessen Ränder er noch bevölkert, scheint er zu meiden.
Der wilde Kanarienvogel, der auch in seiner Heimat von Spaniern und Portugiesen » Canario« genannt wird ( Serinus canarius), ist merklich kleiner und gewöhnlich auch etwas schlanker als derjenige, der in Europa gezähmt unterhalten wird. Seine Länge beträgt zwölf bis dreizehn Zentimeter, die Fittichlänge zweiundsiebzig, die Schwanzlänge sechzig Millimeter. Beim alten Männchen ist der Rücken gelbgrün mit schwärzlichen Schaftstrichen und sehr breiten, hell aschgrauen Federrändern, die beinahe zur vorherrschenden Färbung werden, der Bürzel gelbgrün, das Oberschwanzdeckgefieder aber grün, aschgrau gerandet; Kopf und Nacken sind gelbgrün mit schmalen grauen Rändern, die Stirne und ein breiter Augenstreifen, der nach dem Nacken zu kreisförmig verläuft, grünlich goldgelb, ebenso Kehle und Oberbrust, die Halsseiten dagegen aschgrau. Die Brustfärbung wird nach hinten hin heller, gelblicher; der Bauch und die Untersteißfedern sind weißlich, die Schultern schön zeisiggrün, mattschwarz und blaßgrünlich gebändert, die schwärzlichen Schwungfedern schmal grünlich, die schwarzgrauen Schwanzfedern weißlich gesäumt. Der Augenring ist dunkelbraun; Schnabel und Füße sind bräunlich fleischfarben. Bei dem Weibchen sind die Oberteile braungrau, mit breiten schwarzen Schaftstrichen, die Federn des Nackens und Oberkopfes ebenso gefärbt, am Grunde aber hellgrün, die Stirnfedern grün, die Zügel grau, die Wangen teils grüngelb, teils aschblaugrau, die Schulter- und kleinen Oberflügelfedern licht gelbgrün, die großen Flügeldecken wie die Schwingen dunkelfarbig, grünlich gesäumt, Brust und Kehle grünlich goldgelb, ihrer weißgrauen Federränder halber aber weniger schön als bei dem alten Männchen, Unterbrust und Bauch weiß, die Körperseiten bräunlich mit dunkleren Schaftstrichen. Das Nestkleid ist bräunlich, an der Brust ins Ockergelbe spielend, mit sehr wenig und schwachem Zitronengelb an Wangen und Kehle.
Die Nahrung besteht größtenteils, wenn nicht ausschließlich, aus Pflanzenstoffen, feinem Gesäme, zartem Grün und saftigen Früchten, namentlich Feigen. »Wasser ist für den Kanarienvogel gebieterisches Bedürfnis. Er fliegt oft, meist gesellig, zur Tränke und liebt das Baden, bei dem er sich sehr naß macht, im wilden Zustand ebenso sehr als im zahmen.
Paarung und Nestbau erfolgen im März, meist erst in der zweiten Hälfte desselben. Nie baute der Vogel in den uns zu Gesicht gekommenen Fällen niedriger als zwei Meter über dem Boden, oft in sehr viel bedeutenderer Höhe. Für junge, noch schlanke Bäumchen scheint er besondere Vorliebe zu hegen und unter diesen wieder die immergrünen oder sehr früh sich belaubenden vorzüglich gern zu wählen. Der Birn- und der Granatbaum werden ihrer vielfachen und doch lichten Verästelung halber sehr häufig, der Orangenbaum seiner immer dunklen Krone wegen schon seltener der Feigenbaum, wie man versichert, niemals zur Brutstätte ausersehen. Das Nest wird sehr versteckt angebracht, doch ist es, namentlich in Gärten, vermöge des vielen Hin- und Herfliegens der Alten und ihres nicht großen Nistgebietes unschwer zu entdecken. Wir fanden das erste uns zu Gesicht gekommene in den letzten Tagen des März 1856 inmitten eines verwilderten Gartens der Villa Orotava, auf einem etwa vier Meter hohen Buchsbaume, der sich über einer Myrthenhecke erhob. Es stand, nur mit dem Boden auf den Ästen ruhend, in der Gabel einiger Zweige und war unten breit, oben sehr eng mit äußerst zierlicher Rundung, nett und regelmäßig gebaut, durchweg aus schneeweißer Pflanzenwolle zusammengesetzt und nur mit wenigen dürren Hälmchen durchwebt. Das erste Ei wurde am 30. März, dann täglich eins hinzugelegt, bis die Zahl von fünf beisammen war, die die regelmäßige Zahl des Geleges zu sein scheint, obwohl wir in andern Fällen nur drei bis vier Eier, nie aber mehr als fünf in einem Neste gefunden haben. Die Eier sind blaß meergrün und mit rötlichbraunen Flecken besät, selten beinahe oder ganz einfarbig. Sie gleichen denen des zahmen Vogels vollkommen. Ebenso hat die Brutzeit durch die Zähmung keine Veränderung erlitten; sie dauert beim wilden Kanarienvogel ebenfalls ungefähr dreizehn Tage. Die Jungen bleiben im Neste, bis sie vollständig, befiedert sind, und werden noch eine Zeitlang nach dem Ausfliegen von beiden Eltern, namentlich aber vom Vater, aufs sorgsamste aus dem Kropfe gefüttert. Die Anzahl der Bruten, die in einem Sommer gemacht werden, beträgt in der Regel vier, mitunter auch nur drei.«
Sämtliche Nester, welche Bolle beobachtete, waren auf gleich saubere Weise aus Pflanzenwolle zusammengesetzt; in einzelnen fand sich kaum ein Grashalm oder Rindenstückchen zwischen der glänzenden Pflanzenwolle. »Das Männchen sitzt, während das Weibchen brütet, in dessen Nähe, am liebsten hoch auf noch unbelaubten Bäumen, im ersten Frühling gern auf Akazien, Platanen oder echten Kastanien, Baumarten, deren Blattknospen sich erst spät öffnen, oder auch auf dürren Zweigspitzen, wie sie die Wipfel der in Gärten und in der Nähe der Wohnungen so allgemein verbreiteten Orangen nicht selten aufzuweisen haben. Von solchen Standpunkten aus läßt es am liebsten und längsten seinen Gesang hören.
Es ist viel über den Wert des Gesanges geredet worden. Von einigen überschätzt und allzu hoch gepriesen, ist er von andern einer sehr strengen Beurteilung unterzogen worden. Man entfernt sich nicht von der Wahrheit, wenn man die Meinung ausspricht, die wilden Kanarienvögel sängen wie in Europa die zahmen. Der Schlag dieser letzteren ist durchaus kein Kunsterzeugnis, sondern im großen ganzen geblieben, was er ursprünglich war. Einzelne Teile des Gesanges hat die Erziehung umgestalten und zu glänzenderer Entwicklung bringen, andere der Naturzustand in größerer Frische und Reinheit bewahren mögen; das Gepräge beider Gesänge aber ist noch jetzt vollkommen übereinstimmend und beweist, daß, mag ein Volk auch seine Sprache verlieren können, eine Vogelart dieselbe durch alle Wandlungen äußerer Verhältnisse unversehrt hindurchträgt. So weit das unbefangene Urteil. Das befangene wird bestochen durch die tausend Reize der Landschaft, durch den Zauber des Ungewöhnlichen. Was wir vernehmen, ist schön; aber es wird noch schöner und klangreicher dadurch, daß es nicht im staubigen Zimmer, sondern unter Gottes freiem Himmel erschallt, da, wo Rosen und Jasmin um die Zypresse ranken und die im Raume verschwimmenden Klangwellen das Harte von sich abstreifen, welches an dem meist in zu großer Nähe vernommenen Gesange des zahmen Vogels tadelnswert erscheint. Und doch begnügt man sich nicht, mit dem Ohre zu hören; unvermerkt vernimmt man auch durch die Einbildungskraft, und so entstehen Urteile, die später bei andern Enttäuschungen hervorrufen. So wenig wie alle Hänflinge und Nachtigallen oder alle zahmen Kanarienvögel gleich gute Schläger sind, darf man dies von den wilden fordern. Auch unter ihnen gibt es stärkere und schwächere; das aber ist unsere entschiedene Ansicht, die Nachtigallentöne oder sogenannten Rollen, jene zur Seele dringenden tiefen Brusttöne, haben wir nie schöner vortragen hören als von wilden Kanarienvögeln und einigen zahmen der Inseln, die bei jenen in der Lehre gewesen. Nie werden wir in dieser Hinsicht die Leistungen eines wundervoll hochgelben Männchens von Gran Canaria, das wir als Geschenk eines Freundes eine Zeitlang besaßen, zu vergessen imstande sein. Am meisten möge man sich hüten, den Naturgesang des Kanarienvogels nach dem oft stümperhaften sehr jung gefangener, die im Käfig ohne guten Vorschläger aufwuchsen, zu beurteilen.
Der Flug des Kanarienvogels gleicht dem des Hänflings. Er ist etwas wellenförmig und geht meist in mäßiger Höhe von Baum zu Baum, wobei, wenn der Vogel schwarmweise fliegt, die Glieder der Gesellschaft sich nicht dicht aneinander drängen, sondern jeder sich in einer kleinen Entfernung von seinem Nachbar hält und dabei einen abgebrochenen, oft wiederholten Lockruf hören läßt. Die Scharen, in welche sie sich außer der Paarungszeit zusammentun, sind zahlreich, lösen sich aber den größten Teil des Jahres hindurch in kleinere Flüge auf, die an geeigneten Orten ihrer Nahrung nachgehen und sehr häufig längere Zeit auf der Erde verweilen, vor Sonnenuntergang sich aber gern wieder zusammenschlagen und eine gemeinschaftliche Nachtherberge suchen.
Der Fang dieser Tierchen ist sehr leicht; zumal die Jungen gehen fast in jede Falle, sobald nur ein Lockvogel ihrer Art daneben steht; ein Beweis mehr für die große Geselligkeit der Art. Ich habe sie in Canaria sogar einzeln in Schlagnetzen, deren Locker nur Hänflinge und Stieglitze waren, sich fangen sehen. Gewöhnlich bedient man sich, um ihrer habhaft zu werden, auf den Kanaren eines Schlagbauers, der aus zwei seitlichen Abteilungen besteht, den eigentlichen Fallen mit aufstellbarem Trittholze, getrennt durch den mitten inne befindlichen Käfig, in dem der Lockvogel sitzt. Dieser Fang wird in baumreichen Gegenden, wo Wasser in der Nähe ist, betrieben und ist in den frühen Morgenstunden am ergiebigsten. Er ist, wie wir aus eigener Anschauung wissen, ungemein anziehend, da er dem im Gebüsch versteckten Vogelsteller Gelegenheit gibt, die Kanarienvögel in größter Nähe zu beobachten und sich ihrer anmutigen Bewegungen und Sitten ungesehen zu erfreuen. Wir haben auf diese Weise binnen wenigen Stunden sechzehn bis zwanzig Stück, eines nach dem andern, fangen sehen; die Mehrzahl davon waren indes noch unvermauserte Junge.«
Eine Schilderung des zum Haustier gewordenen Kanarienvogels muß ich mir an dieser Stelle versagen, darf dies wohl auch unbedenklich tun, da in den letzten Jahren so viel über Kanarienvögel, Kanarienzucht und Kanarienhandel geschrieben worden ist, daß ich meine Leser mit dem zum Überdruß abgehandelten Gegenstand nicht behelligen will.
*
Der Karmingimpel oder Brandfink ( Carpodacus erythrinus), Vertreter der Sippe der Rosengimpel (Carpodacus), ist vorherrschend karminrot, auf dem Hinterhalse und Rücken braungrau, durch dunklere, karminrot überhauchte Flecke gezeichnet, auf dem Bauche, den Schenkeln und unteren Schwanzdeckfedern schmutzigweiß; die dunkelbraunen Schwingen sind außen rostgelblichweiß gesäumt, die Schulterfedern hellbräunlich umrandet und karminrot überflogen, die Steuerfedern graubraun und etwas lichter, die Oberschwanzdecken karminrot gesäumt. Beim Weibchen ist anstatt des Karminrot Fahlgraubraun vorherrschend und die Zeichnung aus dunkleren Längsflecken hergestellt. Das Auge ist braun, der Schnabel licht-, der Fuß dunkelhornfarben. Die Länge beträgt sechzehn, die Breite sechsundzwanzig, die Fittichlänge acht, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.
In Europa bewohnt der Karmingimpel ständig nur den Osten, insbesondere Galizien, Polen, die Ostseeprovinzen, Mittel- und Südrußland, außerdem aber ganz Mittelasien vom Ural an bis Kamtschatka. Von hier aus wandert er regelmäßig nach Süden hinab, durch China bis Indien und durch Turkestan bis Persien, erscheint ebenso nicht allzu selten in Ostdeutschland, hat in Schlesien und Schleswig gebrütet und ist wiederholt in Mittel-, West- und Süddeutschland, Holland, Belgien, Frankreich, England und Italien beobachtet worden. Auf seinen Brutplätzen trifft er um die Mitte des Mai, frühestens zu Ende des April, ein und verläßt sie im September wieder. Zu seinem Aufenthalt wählt er sich mit Vorliebe dichte Gebüsche in der Nähe eines Gewässers, auch wohl mit Rohr und Gebüsch bestandene Brüche, beschränkt denselben jedoch nicht auf Niederungen, sondern kommt auch im Hügellande und selbst im Gebirge bis über zweitausend Meter unbedingter Höhe vor. Häufig ist er nirgends, wird vielmehr überall einzeln beobachtet und bildet während des Sommers niemals zahlreiche Schwärme.
Unmittelbar nach seiner Ankunft vernimmt man seinen ungemein anziehenden, wechselreichen und klangvollen Gesang, der zwar an den Schlag des Stieglitzes, Hänflings und Kanarienvogels erinnert, aber doch so eigenartig ist, daß man ihn mit dem keines andern Finken verwechseln kann. Dieser Gesang ist ebenso reichhaltig als wohllautend, ebenso sanft als lieblich, zählt überhaupt zu den besten, die dem Schnabel eines Finken entklingen. In Kamtschatka hat man, wie Kittlitz uns mitteilt, diesem Liede sinnreich einen russischen Text untergelegt: »Tschewitscha widäl«. (Ich habe die Tschewitscha gesehen!) »Tschewitscha heißt aber die größte der dortigen Lachsarten, der geschätzteste von allen Fischen des Landes und somit das vornehmste Nahrungsmittel der Einwohner; sie kommt ungefähr mit dem Vogel zugleich in Kamtschatka an. Jener Gesang wird nun so gedeutet, als ob er die Ankunft des Lachses verkünde, und der Karmingimpel ist sonach in einem Lande, dessen Bewohner sich hauptsächlich von Fischen ernähren, nicht nur der Verkündiger der schönen Jahreszeit, sondern auch des sie begleitenden Erntesegens.« In der Tat hört man den russischen Worten ähnelnde Laute mit besonderer Betonung oft in den Strophen des Gesanges. Während des Vortrages zeigt sich das Männchen gewöhnlich frei auf der Spitze des Busches, in dem oder in dessen Nähe das Nest steht, sträubt die Federn des Scheitels und der Brust, als wolle es die volle Pracht seines Gefieders entfalten, verschwindet sodann und trägt noch einige Strophen in gleichsam gemurmelter Weise im Innern des Busches vor, erscheint aber nach kurzer Frist wiederum, um seinen Gesang von neuem zu erheben. Seine Bewegungen erinnern an die des Hänflings, dem er auch hinsichtlich seiner Rastlosigkeit ähnelt.
Die Nahrung besteht in Gesäme aller Art, die der Karmingimpel ebensowohl von höheren Pflanzen wie vom Boden aufliest, auch wohl in Blätterknospen und zarten Schößlingen. Nebenbei nimmt er, mindestens im Bauer, Ameisenpuppen und andere tierische Stoffe zu sich. In der Winterherberge ernährt er sich von den Samen der Bambusen und des Röhrichts, hält sich daher fast ausschließlich da auf, wo diese Pflanzen wachsen, und wird in Indien geradezu »Rohrspatz« genannt. Hier wie in der Heimat fliegt er auch in die Felder, fügt jedoch den Nutzpflanzen nirgends erheblichen Schaden zu.
Das Nest, das gewöhnlich in Schwarzdorn-, überhaupt aber in dichten und stacheligen Büschen, höchstens zwei Meter über dem Grunde, errichtet wird, ähnelt, laut Taczanowski, dem der Dorngrasmücke, ist aus feinen, schmiegsamen Halmen, Stengeln und Würzelchen zusammengesetzt und innen mit noch zarteren Stoffen derselben Art, Blütenrispen und einzelnen Haaren ausgelegt, im ganzen aber sehr lose und locker gebaut. Fünf, seltener sechs, durchschnittlich zwanzig Millimeter lange, fünfzehn Millimeter dicke, sehr zartschalige, auf prachtvoll blaugrünem Grunde spärlich, nur gegen das stumpfe Ende hin dichter, braungelb, schwarzbraun oder rötlich gefleckte und gestrichelte Eier bilden das Gelege, das in den letzten Maitagen vollzählig zu sein pflegt. Während das Weibchen brütet, singt das Männchen noch so feurig als je zuvor, oft aber ziemlich weit entfernt vom Neste, zu dem es jedoch oft zurückkehrt. Bei Gefahr warnt es das Weibchen mit einem Tone, der dem Warnungsruf des Kanarienvogels ähnelt und beiden Geschlechtern gemeinsam ist. Mit dem Flüggewerden der Jungen verstummt sein Gesang, und damit ändert sich auch sein Betragen. Stumm und verborgen, vorsichtig dem nahenden Menschen ausweichend, treibt sich fortan alt und jung im dichten Gebüsch umher, bis die Zeit der Abreise herankommt und eine Familie nach der andern unbemerkt die Heimat verläßt.
Gefangene Karmingimpel sind höchst angenehme Vögel, ihre Färbung aber so hinfällig wie die keines andern in ähnlicher Farbenschönheit prangenden Finken. Sie verlieren Glanz und Tiefe der Färbung schon, wenn sie mit der Hand berührt werden, und erhalten durch die nächste Mauser ein geradezu mißfarbiges Kleid, dauern auch selten mehrere Jahre im Käfig aus.
*
Die Urbilder der Unterfamilie sind die Waldgimpel ( Pyrrhula). Zu dieser Sippe gehört unser gewöhnlicher Gimpel oder Dompfaff ( Pyrrhula europaea). Er ist auf dem Oberkopfe und an der Kehle, auf Flügeln und Schwanz glänzend dunkelschwarz, auf dem Rücken aschgrau, auf dem Bürzel und dem Unterbauche weiß, auf der ganzen übrigen Unterseite aber lebhaft hellrot. Das Weibchen unterscheidet sich leicht durch die aschgraue Färbung seiner Unterseite und die weniger lebhaften Farben überhaupt. Den Jungen fehlt die schwarze Kopfplatte. Der Flügel ist in allen Kleidern durch zwei graulichweiße Binden geziert, die in der Gegend des Handgelenkes verlaufen. Als Spielarten kommen weiße oder schwarze und bunte Gimpel vor. Die Länge beträgt siebzehn, die Breite achtundzwanzig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.

Gimpelmännchen ( Pyrrhula europaea)
Der Gimpel bewohnt, mit Ausnahme des Ostens und Nordens, ganz Europa, den Süden unseres heimatlichen Erdteils jedoch nur als Wintergast. Im Osten und Norden Europas und ebenso in ganz Mittelasien wird er vertreten durch den Großgimpel ( Pyrrhula major), der sich zwar einzig und allein durch bedeutendere Größe, aber so ständig unterscheidet, daß man die zuerst von meinem Vater ausgesprochene Trennung beider Arten anerkennen muß. Der Großgimpel brütet noch in Preußen und Pommern, nicht aber im Westen Deutschlands, erscheint hier auch nur während des Zuges; der Gimpel wiederum kommt schon in Pommern nicht mehr vor. Die eine wie die andere Art, auf deren Trennung ich im nachfolgenden nicht weiter Rücksicht nehmen will, ist streng an den Wald gebunden und verläßt ihn, solange sie Nahrung findet, gewiß nicht. Erst wenn der Winter den Gimpel aus seiner Wohnstätte vertreibt, kommt er gesellschaftsweise in Obstpflanzungen und Gärten der Dörfer oder in Feldgebüsche, um hier nach den wenigen Beeren und Körnern zu suchen, die andere Familienverwandte ihm noch übrig gelassen haben. Zu Anfang des Striches sieht man oft nur Männchen, später Männchen und Weibchen untereinander. Solange nicht besondere Umstände zu größeren Wanderungen nötigen, bleibt er im Vaterlande; unter Umständen dehnt er seine Wanderungen bis nach Südspanien oder Griechenland aus. Er wandert meist bei Tage und fliegt womöglich von einem Walde zum andern.
»Der Name Gimpel«, sagt mein Vater, »ist als Schimpfwort eines als beschränkt zu bezeichnenden Menschen allbekannt und läßt auf die Dummheit unseres Vogels schließen. Es ist nicht zu leugnen, daß er ein argloser, den Nachstellungen der Menschen keineswegs gewachsener Gesell ist; er läßt sich leicht schießen und fangen. Doch ist seine Dummheit bei weitem nicht so groß als die der Kreuzschnäbel; denn obgleich der noch übrige Teil einer Gesellschaft nach dem Schusse, der einen Vogel dieser Art tötet, zuweilen auf oder neben dem Baume, auf dem sie erst saß, wieder Platz nimmt; so weiß ich doch kein Beispiel, daß auf den Schuß ein gesunder Gimpel sitzen geblieben wäre, was allerdings bei den Kreuzschnäbeln zuweilen vorkommt. Wäre der Gimpel wirklich so dumm, als man glaubt, wie könnte er Lieder so vollkommen nachpfeifen lernen? Dieses Beispiel zeigt besonders kraß die anthropozentrische Einstellung der Brehmschen Tierpsychologie. Der Gimpel ist »dumm«, weil er sich leicht schießen läßt, und »klug«, weil er gut Lieder pfeifen lernt. Von einem Menschen, der entsprechend handelt, können wir mit Recht auf Dummheit oder Begabung schließen, aber unmöglich dürfen wir das bei einem Tier tun, das in einer ganz andern Umwelt lebt als der Mensch. Vielmehr muß jedes Tier lediglich aus seiner eigenen Welt heraus verstanden und beurteilt werden. Wir werden in unserer Schlußbetrachtung an Einzelfällen zeigen, wie das gemeint ist. Herausgeber. Ein hervorstechender Zug bei ihm ist die Liebe zu seinesgleichen. Wird einer von der Gesellschaft getötet, so klagen die andern lange Zeit und können sich kaum entschließen, den Ort, wo ihr Gefährte geblieben ist, zu verlassen; sie wollen ihn durchaus mitnehmen. Dies ist am bemerkbarsten, wenn die Gesellschaft klein ist. Diese innige Anhänglichkeit war mir oft rührend. Einst schoß ich von zwei Gimpelmännchen, die in einer Hecke saßen, das eine; das andere flog fort, entfernte sich so weit, daß ich es aus den Augen verlor, kehrte aber doch wieder zurück und setzte sich in denselben Busch, in dem es seinen Gefährten verloren hatte. Ähnliche Beispiele könnte ich mehrere anführen.
Der Gang unseres Gimpels ist hüpfend, auf der Erde ziemlich ungeschickt. Auf den Bäumen ist er desto gewandter. Er sitzt auf ihnen bald mit wagerecht stehendem Leibe und angezogenen Fußwurzeln, bald aufgerichtet mit weit vorstehenden Füßen, und hängt sich oft unten an die Zweige an. Seine lockeren und langen Federn legt er selten knapp an, und deswegen sieht er gewöhnlich viel größer aus, als er ist. Im Fluge, vor dem Fortfliegen, gleich nach dem Aufsetzen und beim Ausklauben der Samenkörner oder Kerne trägt er sich schlank und schön; im Käfig läßt er die Federn fast immer etwas hängen. Ein Baum voll Gimpel gewährt einen prächtigen Anblick. Das Rot der Männchen sticht im Sommer gegen das Grün der Blätter und im Winter gegen den Reif und Schnee herrlich ab. Sie scheinen gegen die Kälte ganz unempfindlich zu sein; denn sie sind im härtesten Winter, vorausgesetzt, daß es ihnen nicht an Nahrung fehlt, sehr munter. Ihr ungemein dichtes Gefieder schützt sie hinlänglich. Dieses hat auch auf den Flug großen Einfluß; denn er ist leicht, aber langsam, bogenförmig und hat mit dem des Edelfinken einige Ähnlichkeit. Wie bei diesem ist das starke Ausbreiten und Zusammenziehen der Schwingen sehr bemerkbar. Vor dem Niedersetzen schweben sie oft, stürzen sich aber auch zuweilen mit stark nach hinten gezogenen Flügeln plötzlich herab. Der Lockton, den beide Geschlechter hören lassen, ist ein klagendes ›Jüg‹ oder ›Lüi‹ und hat im Thüringischen unserm Vogel den Namen ›Lübich‹ verschafft. Er wird am häufigsten im Fluge und im Sitzen vor dem Wegfliegen oder kurz nach dem Auffetzen ausgestoßen, ist, nachdem er verschieden betont wird, bald Anlockungs-, bald Warnungsruf, bald Klageton. Er wird jedesmal richtig verstanden. Man sieht hieraus, wie fein die Unterscheidungsgabe bei den Vögeln sein muß, da die Veränderungen des Locktones, die vom Menschen oft kaum zu bemerken sind, in ihren verschiedenen Bedeutungen stets richtig aufgefaßt werden. Der Gesang des Männchens ist nicht sonderlich; er zeichnet sich namentlich durch einige knarrende Töne aus und läßt sich kaum gehörig beschreiben. In der Freiheit ertönt er vor und in der Brutzeit, in der Gefangenschaft fast das ganze Jahr.«
Baum- und Grassämereien bilden die Nahrung des Gimpels; nebenbei verzehrt er die Kerne mancher Beerenarten und im Sommer viele Kerbtiere. Den Fichten-, Tannen- und Kiefersamen kann er nicht gut aus den Zapfen herausklauben und liest ihn deshalb gewöhnlich vom Boden auf. Die Kerne der Beeren trennt er mit großer Geschicklichkeit von dem Fleisch derselben, das er als ungenießbar wegwirft. Im Winter erkennt man das Vorhandensein von Gimpeln unter beerentragenden Bäumen leicht daran, daß der Boden unten mit den Überbleibseln der Beeren wie besät ist. Doch geht der Vogel nur im Notfall an solches Futter und zieht ihm immer die Sämereien vor. Zur Beförderung der Verdauung liest er Sandkörner auf. Durch Abbeißen der Knospen unserer Obstbäume kann er lästig werden; da er jedoch nirgends in namhafter Menge auftritt, fällt der durch ihn verursachte Schaden kaum ins Gewicht, es sei denn, daß einmal ein Flug in einen kleinen Garten einfallen und hier längere Zeit ungestört sein Wesen treiben sollte.
In gebirgigen Gegenden, wo große Strecken mit Wald bestanden sind und dieser heimliche, wenig besuchte Dickichte enthält, nistet der Gimpel regelmäßig. Ausnahmsweise siedelt er sich auch in Parks und großen Gärten an. So brütet ein Paar alljährlich in dem Efeu, der das Gärtnerhäuschen eines Parks in Anhalt umrankt; andere hat man in Auwaldungen gefunden. Das Nest steht auf Bäumen, gewöhnlich in geringer Höhe, entweder in einer Gabel des höheren Buschholzes, oder auf einem Seitenästchen dicht am Baumschaft, besteht äußerlich aus dürren Fichten-, Tannen- und Birkenreischen, auf denen eine zweite Lage äußerst feiner Wurzelfasern und Bartflechten folgen, und ist innerlich mit Reh- und Pferdehaaren oder auch nur mit zarten Grasblättchen und feinen Flechtenteilen ausgefüttert. Zuweilen wird der inneren Wandung auch wohl Pferdehaar oder Schafwolle beigemischt. Im Mai findet man vier bis fünf verhältnismäßig kleine, etwa einundzwanzig Millimeter lange, fünfzehn Millimeter dicke, rundliche, glattschalige Eier, die auf bleichgrünlichem oder grünlichbläulichem Grunde mattviolette oder schwarze Flecke und rotbraune Punkte, Züge und Schnörkel zeigen. Das Weibchen zeitigt die Eier binnen zwei Wochen und wird, solange es auf dem Neste sitzt, von dem Männchen ernährt. Beide Eltern teilen sich in die Erziehung ihrer Kinder, die sie äußerst zärtlich lieben und mit Lebensgefahr zu verteidigen suchen. Die Jungen erhalten anfänglich Kerbtiere, später junge Pflanzenschößlinge und allerhand im Kropfe erweichte Sämereien und schließlich hauptsächlich die letzteren. Auch nach dem Ausfliegen werden sie noch längere Zeit von den Eltern geführt, falls diese nicht zur zweiten Brut schreiten.
Im Gebirge nimmt man die jungen Gimpel, noch ehe sie flügge sind, aus dem Nest, um sie zu erziehen und zu lehren. Je früher man den Unterricht beginnen kann, um so günstiger ist das Ergebnis. Auf dem Thüringer Walde werden jährlich Hunderte junger Gimpel erzogen und dann durch besondere Vogelhändler nach Berlin, Warschau, Petersburg, Amsterdam, London, Wien, ja selbst nach Amerika gebracht. Der Unterricht beginnt vom ersten Tage ihrer Gefangenschaft an, und die hauptsächlichste Kunst desselben besteht darin, daß der Lehrer selbst das einzuübende Lied möglichst rein und immer gleichmäßig vorträgt. Man hat versucht, mit Hilfe von Drehorgeln zu lehren, aber wenig Erfolg erzielt. Selbst die Flöte kann nicht leisten, was ein gut pfeifender Mund vorträgt. Einzelne lernen ohne sonderliche Mühe zwei bis drei Stückchen, während andere immer Stümper bleiben; einzelne behalten das Gelehrte zeitlebens, andere vergessen es namentlich während der Mauser wieder. Auch die Weibchen lernen ihr Stücklein, obwohl selten annähernd so voll und rein wie die Männchen. Von diesen werden einzelne zu wirklichen Künstlern. »Ich habe«, sagt mein Vater, »Bluthänflinge und Schwarzdrosseln manches Lied nicht übel pfeifen hören; aber dem Gimpel kommt an Reinheit, Weichheit und Fülle des Tones kein deutscher Vogel gleich. Es ist unglaublich, wie weit er gebracht werden kann. Er lernt oft die Weisen zweier Lieder und trägt sie so flötend vor, daß man sich nicht satt daran hören kann.« Abgesehen von der Gabe der Nachahmung, zeichnet sich der Gimpel vor allen übrigen Finken durch leichte Zähmbarkeit, unbegrenzte Anhänglichkeit und unvergleichliche Hingabe an seinen Pfleger aus, tritt mit diesem in ein inniges Freundschaftsverhältnis, jubelt in dessen Gegenwart, trauert in dessen Abwesenheit, stirbt sogar im Übermaß der Freude wie des Kummers, den ihm sein Herr bereitet. Ohne besondere Mühe kann er zum Aus- und Einfliegen gewöhnt werden, brütet auch leicht im Käfig, vereinigt also eine Reihe vortrefflicher Eigenschaften in sich.
*
Vertreter der letzten Sippe der Unterfamilie, die wir in Betracht ziehen können, ist der Hakengimpel ( Pinicola enucleator). Der Leib ist kräftig, der Schnabel allseitig gewölbt, der Oberschnabel jedoch stark hakig übergebogen, an den Schneiden etwas geschweift. Der Schwanz ist ziemlich lang und in der Mitte ausgeschnitten; das Gefieder endlich zeichnet sich durch seine Dichtigkeit und eigenartige Farbenschönheit aus. Bei den alten Männchen ist ein schönes Johannisbeerrot die vorherrschende Färbung, bei den einjährigen Männchen und Weibchen spielt die Farbe mehr in das Gelbliche; die Kehle ist lichter gefärbt, und der Flügel wird durch zwei weiße Querbinden geziert. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schmutzigbraun, an der Spitze schwärzlich, der Unterschnabel lichter als der obere, der Fuß graubraun. Die Länge beträgt zweiundzwanzig, die Breite fünfunddreißig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge acht Zentimeter.
Alle hochnordischen Länder der Erde sind als die Heimat des schönen und auffallenden Vogels zu bezeichnen. Soweit man weiß, kommt der Hakengimpel nirgends häufig vor, lebt vielmehr während des Sommers paarweise und einzeln in einem ausgedehnten Gebiet und schart sich erst im Herbst. Die dann gebildeten Flüge schweifen während des ganzen Winters in den nordischen Waldungen umher, nähern sich auch wohl einsam stehenden Gehöften und kehren mit Beginn des Frühjahrs wieder auf ihre Brutplätze zurück. Einzelne Hakengimpel erscheinen als Wandervögel, wenn auch nicht alljährlich, so doch fast in jedem strengen Winter im nordöstlichen Deutschland und ebenso in den Ostseeprovinzen, Nordrußland und den entsprechenden Landstrichen Nordasiens und Amerikas; zahlreiche Schwärme dagegen kommen unregelmäßig bis zu uns herab; denn nur dann, wenn besondere Ereignisse, namentlich bedeutender Schneefall, sie zum Wandern in südlichere Gegenden veranlassen, geschieht es, daß die Flüge mit anderen sich zusammenschlagen und demgemäß sehr zahlreiche Schwärme auftreten.
In seinem Benehmen erinnert der Hakengimpel vielfach an die Kreuzschnäbel. Er zeigt sich durchaus als Baumvogel, der im Gezweige wohl heimisch, auf dem Boden hingegen fremd ist. In den Kronen der Bäume klettert er sehr geschickt von einem Aste zum andern, hüpft auch mit Leichtigkeit über ziemlich weite Zwischenräume; die Luft durcheilt er fliegend ziemlich schnell, nach Art der meisten Finken weite Bogenlinien beschreibend und nur kurz vor dem Aufsitzen schwebend; auf dem Boden aber hüpft er, falls er überhaupt zu ihm herabkommt, mit plumpen Sprüngen einher. Der Lockton ist flötend und ansprechend, dem des Gimpels ähnlich, der Gesang, der auch während des ganzen Winters ertönt, mannigfach abwechselnd und wegen der sanften, reinen Flötentöne in hohem Grade anmutend. Während der Wintermonate bekommt man von dem reichen Liede selten eine richtige Vorstellung; der Vogel singt dann leise und abgerissen; im Frühling aber, wenn die Liebe in ihm sich regt, trägt er sein Lied mit vielem Feuer kräftig und anhaltend vor, so daß er auch den, der die Leistungen der edelsten Sänger kennt, zu befriedigen versteht. In den tageshellen Sommernächten seiner eigentlichen Heimat singt er besonders eifrig und wird deshalb in Norland der – Nachtwächter genannt. Sein Wesen ist sanft und friedfertig, sein Benehmen gegen den Gatten hingebend und zärtlich im allerhöchsten Grade.
In der Freiheit nährt sich der Hakengimpel von den Samen der Nadelbäume, die er zwischen den geöffneten Schuppen der Zapfen hervorzieht oder von den Ästen und Zweigen und vom Boden aufliest; außerdem nimmt er verschiedene andere Sämereien oder Beeren mancherlei Art gern an und betrachtet Baumknospen oder Grünzeug überhaupt als Leckerbissen. In den Sommermonaten wird er nebenbei vielleicht von Kerbtieren, insbesondere von den in seiner Heimat so überaus häufigen Mücken, sich ernähren und mit ihnen wohl auch seine Jungen auffüttern; doch liegen hierüber, soviel mir bekannt, bestimmte Beobachtungen nicht vor.
Gefangene Hakengimpel gewöhnen sich binnen wenig Stunden an den Käfig, gehen ohne Umstände an geeignetes Futter, werden bald ebenso zahm wie irgendein anderer Gimpel, halten aber selten längere Zeit im Bauer aus und verlieren bei der ersten Mauser in letzterem unwiederbringlich ihre prachtvolle Färbung.
*
Die letzte Unterfamilie ( Loxiinae) umfaßt nur die Kreuzschnäbel ( Loxia), gedrungen gebaute, großköpfige, etwas plumpe Finken. Ihr Schnabel ist sehr stark, dick, seitlich zusammengedrückt, an den Schneiden eingebuchtet, der obere Kiefer auf der schmalen Firste zugerundet, in eine lange Spitze ausgezogen und sanft hakenförmig abwärts gebogen, der untere, der den oberen an Stärke übertrifft, in einen ähnlichen Bogen umgekehrt nach oben gekrümmt und mit jenem bald auf der rechten, bald auf der linken Seite gekreuzt.
Die größte und kräftigste Art der Sippe ist der Kiefernkreuzschnabel, Tannenpapagei oder Krummschnabel ( Loxia pityopsittacus). Seine Länge beträgt zwanzig, die Breite dreißig, die Fittichlänge elf, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Der Schnabel ist ausfallend stark, dick und hoch, oben und unten in einem fast vollständigen Halbkreise gekrümmt und nur wenig gekreuzt. Kopf, Kehle, Gurgel, Brust und Bauch sind mehr oder minder lebhaft rot, vorn hell mennigrot bis johannisbeerrot, auf den Backen graulich, auf der Kehle aschgrau überflogen, die Federn des Rückens graurot, an der Wurzel grau und an der Spitze rot gesäumt, die des Bürzels lebhafter rot als das übrige Kleingefieder, die des unteren Bauches hell aschrot oder weißlich, graurötlich überflogen, die Schwung-, Oberflügel-, Deck- und Steuerfedern grauschwarz, rotgrau gesäumt, die Unterschwanzdeckfedern weißgrau, dunkler gestrichelt und rötlich überflogen. Beim Weibchen sind Scheitel- und Rückenfedern tiefgrau, Nacken und Hinterhals graugrüngelb, die Unterteile, mit Ausnahme der weißgrauen Brust und Bauchmitte, lichtgrau.
Der Fichtenkreuzschnabel oder Krinitz ( Loxia curvirostra) ist kleiner, der Schnabel gestreckter und minder gekrümmt, seine sich kreuzende Spitze länger und niedriger als beim Kieferkreuzschnabel. Die Länge beträgt siebzehn, die Breite achtundzwanzig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Kopf, Nacken und Unterkörper sind ebenso gefärbt wie bei jenem, die Federn des Unterbauches weißgrau, die Schwingen und Steuerfedern nebst ihren oberen Decken grauschwarz, rötlichgrau gesäumt, die Unterschwanzdecken schwarzgrau mit weißen, rötlich überflogenen Spitzen.

Fichtenkreuzschnabel ( Loxia curvirostra)
Der Rotbindenkreuzschnabel ( Loxia rubrifasciata) unterscheidet sich vom Fichtenkreuzschnabel durch einen verdeckten grauen Ring im Nacken, schwarzbraune, rotbespritzte Schultern und zwei breite, rosenrote, beim Weibchen graue, beim jungen Vogel gelbgraue, durch die Spitze der Oberdeckfedern gebildete Flügelbinden.
Der Weißbindenkreuzschnabel ( Loxia bifasciata) endlich ist etwas kleiner als alle bisher genannten. Die vorherrschende Färbung des Gefieders ist ein prachtvolles Johannisbeerrot, das im Nacken und auf der Mitte der Unterseite in Grau übergeht. Die an der Spitze weißen, großen und kleinen Oberflügeldeckfedern bilden zwei breite Binden über die Flügel, die Schulterdeckfedern enden ebenfalls mit weißen Spitzen. Weibchen und Junge ähneln denen des Fichtenkreuzschnabels, tragen jedoch ebenfalls die weißen Binden auf den Flügeln.
Die Kreuzschnäbel gehören zu denjenigen Gliedern ihrer Klasse, die mein Vater passend »Zigeunervögel« genannt hat. Wie das merkwürdige Volk, dessen Namen sie tragen, erscheinen sie plötzlich in einer bestimmten Gegend, verweilen hier geraume Zeit, sind vom ersten Tage an heimisch, liegen auch wohl dem Fortpflanzungsgeschäft ob und verschwinden ebenso plötzlich, als sie gekommen. Ihre Wanderungen stehen in gewissem Einklang mit dem Samenreichtum der Nadelwaldungen, ohne daß man jedoch eine bestimmte Regel feststellen könnte. Demgemäß können sie unsern Schwarzwaldungen jahrlang fehlen und sie dann wieder in Menge bevölkern. Nur ihr Aufenthalt ist bestimmt, ihre Heimat unbegrenzt. Alle die genannten Arten sind Brutvögel Nordeuropas, aber auch solche ganz Nordasiens, soweit es bewaldet ist, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß letztgenannter Erdteil als ihre ursprüngliche Heimat betrachtet werden darf. Wenn in zusammenhängenden Waldungen der Fichten- und Kiefersamen wohl geraten ist, hört man das allen Fängern wohlbekannte »Göp, göp, gip, gip« oder »Zock, zock« unserer Vögel oder vernimmt im günstigeren Falle auch den für viele sehr angenehmen Gesang des Männchens. Die Kreuzschnäbel sind angekommen und haben sich häuslich eingerichtet. Ist der Wald versprechend, so schreiten sie zur Fortpflanzung, ist dies nicht der Fall, so schweifen sie eine Zeitlang hin und her und siedeln sich an einem andern, passenderen Orte an. Die günstigsten Stellen eines Waldes, die zum längeren Aufenthalte erwählt werden sollen, sind bald ausgefunden und werden nun als abendliche Sammelplätze der über Tag hin und her schweifenden Gesellschaften benutzt, somit also gewissermaßen zu dem eigentlichen Wohnsitze.
Alle Kreuzschnäbel, gesellige Tiere, die während der Brutzeit zwar in Paare sich sondern, nicht aber auch aus dem Verbande scheiden, sind Baumvögel, die nur im Notfall auf die Erde herabkommen, um dort zu trinken oder um einige abgefallene Zapfen noch auszunutzen. Sie klettern sehr geschickt, indem sie sich nach Papageienart mit den Schnabelspitzen anhalten und forthelfen, hängen sich kopfunterst oder kopfoberst mit Fuß und Schnabel am Zweige oder Zapfen an und verweilen ohne Beschwerde viele Minuten lang in dieser scheinbar so unbequemen Stellung, fliegen mit wechselweise stark ausgebreiteten und dann plötzlich angezogenen Flügeln, wodurch der Flug Wellenlinien annimmt, schnell und verhältnismäßig leicht, obwohl nicht gern weit, steigen, wenn sie um die Liebe ihres Weibchens werben, flatternd über die Wipfel empor, halten sich schwirrend auf einer und derselben Stelle, singen dabei und senken sich hierauf schwebend langsam wieder zu dem gewöhnlichen Sitzplatz hernieder. Während des Tages, höchstens mit Ausnahme der Mittagsstunden, sind sie fast immer in Tätigkeit. Im Frühjahr, Sommer und Herbst streichen sie schon vor Tagesanbruch im Walde auf und nieder und von einem Gehölz oder von einem Berge zum andern; im Winter dagegen, zumal wenn die Kälte stark ist, bleiben sie länger an dem Orte, der ihnen Nachtruhe gewährte, fliegen selten vor Sonnenaufgang umher, singen jedoch bereits am frühen Morgen, befinden sich um zehn Uhr vormittags in voller Tätigkeit, beginnen mit ihrer Mahlzeit, singen inzwischen, werden nach zwei Uhr mittags stiller, fressen aber bis gegen vier Uhr nachmittags und gehen nunmehr zur Ruhe. Zur Tränke begeben sie sich gegen Mittag, im Sommer schon gegen zehn oder elf Uhr vormittags. Sie bekümmern sich wenig oder nicht um die andern Tiere des Waldes, ebensowenig um den Menschen, dem sie namentlich in den ersten Tagen nach ihrem Erscheinen deutlich genug beweisen, daß sie ihn noch nicht als Feind kennengelernt haben. Ihr Fang und ihre Jagd verursachen wenig Schwierigkeiten, weil ihre Geselligkeit so groß ist, daß sie dieser zuliebe ihre Freiheit oft rücksichtslos aufs Spiel setzen. Das Männchen, dessen Weibchen eben erlegt wurde, bleibt zuweilen verdutzt oder traurig auf demselben Ast sitzen, von dem der Gatte herabgeschossen wurde, oder kehrt, nach dem Gefährten suchend, wiederholt zu dem Ort der Gefahr zurück; wenn es aber wiederholt traurige Erfahrungen über die Tücke des Menschen machen mußte, zeigt es sich gewöhnlich sehr scheu. In Gefangenschaft werden alle Kreuzschnäbel bald rücksichtslos zahm. Sie vergessen schnell den Verlust ihrer Freiheit, lernen ihren Pfleger als Herrn und Gebieter kennen, legen alle Furcht vor ihm ab, lassen sich später berühren, auf dem Arm oder der Hand im Zimmer umhertragen und geben ihm schließlich durch entsprechendes Gebaren ihre warme Liebe kund. Diese Liebenswürdigkeit im Käfig hat sie allen, die sie kennen, innig befreundet, und zumal die Gebirgsbewohner halten sie hoch in Ehren.
Die Lockstimme des Kiefernkreuzschnabels, die beide Geschlechter hören lassen, ist das bereits erwähnte »Göp, göp« oder »Gip, gip« und »Zock, zock«. »›Göp‹ wird im Fluge und im Sitzen ausgestoßen«, sagt mein Vater, dem wir die ausführlichste und beste Beschreibung der Kreuzschnäbel verdanken, »und ist ebensowohl ein Zeichen zum Aufbruch als ein Ruf nach andern Kreuzschnäbeln und ein Ton, um die Gesellschaft zusammenzuhalten; deswegen klingt dieses ›Göp‹ auch sehr stark; ›Gip, gip‹ drückt Zärtlichkeit aus und ist ein Ton, den beide Gatten einander im Sitzen zurufen; er ist so leise, daß man nahe beim Baume sein muß, um ihn zu vernehmen. Oft glaubt man beim Hören dieses Rufes, der Vogel sei sehr weit, und wenn man genau nachsieht, erblickt man ihn über sich. ›Zock‹ wird gewöhnlich von sitzenden Vögeln ausgestoßen, um die vorüberfliegenden zum Herbeikommen und Aufsitzen einzuladen; doch hört man es auch zuweilen von Kreuzschnäbeln im Fluge. Es klingt stark und voll und muß der Hauptruf bei einem Lockvogel sein. Die Jungen haben in ihrem Geschrei viele Ähnlichkeit mit den jungen Bluthänflingen; doch lassen sie bald das ›Göp‹, ›Gip‹ und ›Zock‹ der Alten vernehmen. Der Lockton des Fichtenkreuzschnabels, den er im Fluge, aber auch im Sitzen, hören läßt, ist ›Gip, gip‹, höher und schwächer als der des Kiefernkreuzschnabels. Dieses ›Gip‹ ist Zeichen des Aufbruchs, der Warnung und des Zusammenhaltens. Sitzen sie, und fängt einer stark ›Gip‹ zu schreien an, so sind die andern alle aufmerksam und fliegen gewöhnlich sämtlich mit fort, wenn sich der eine in Bewegung setzt. Wenn sie aber fressen, und es fliegen einige vorbei, die diesen Lockton ausstoßen, so lassen sich die Fressenden gewöhnlich in ihrer Arbeit nicht stören und rufen nur selten ›Zock, zock‹ ihnen zu, was zum Niedersitzen einladet. Auch dieses ›Zock‹ klingt höher und heller als beim Kiefernkreuzschnabel und lockt eigentlich an. Ist einer von dem andern entfernt, und einer sitzt noch, so schreit dieser unaufhörlich ›Zock‹, um jenen zur Rückkehr zu vermögen. Sitzt einer auf der Spitze eines Baumes und will einen ganzen Flug zum Niedersetzen bewegen, so läßt er dieses ›Zock‹ sehr stark hören; im Fluge stoßen sie diesen Lockton selten aus. Beim Sitzen geben sie noch einen ganz leisen Ton zum besten, der fast wie das Piepen der kleinen Küchelchen klingt, wenn diese unter der Henne stecken. Dieser Ton hat mit dem des Kiefernkreuzschnabels große Ähnlichkeit. Die Jungen schreien fast wie die jungen Kiefernkreuzschnäbel, lassen aber auch ein Piepen vernehmen wie die Alten.« Der Gesang des Männchens spricht viele Menschen außerordentlich an. Gewöhnlich singt der Kiefernkreuzschnabel besser als der Fichtenkreuzschnabel; das Lied beider ähnelt sich aber. Es besteht aus einer laut vorgetragenen Strophe, auf die mehrere zwitschernde, schwache und nicht weit hörbare Töne folgen. In der Freiheit singen sie am stärksten, wenn das Wetter schön, heiter, still und nicht zu kalt ist; an windigen und stürmischen Tagen schweigen sie fast gänzlich. Während des Gesanges wählen sie sich fast regelmäßig die höchsten Spitzen der Wipfel, und nur während der Liebeszeit zwitschern und schwatzen sie auch im Fliegen. Die Weibchen singen zuweilen ebenfalls, aber leiser und verworrener als die Männchen. Im Käfig singen sie fast das ganze Jahr, höchstens mit Ausnahme der Mauserzeit.
Die Nahrung der Kreuzschnäbel besteht vorzugsweise aus den Sämereien der Waldbäume. Zur Gewinnung dieser Nahrung ist ihnen ihr starker und gekreuzter Schnabel unentbehrlich. Es erfordert große Kraft und viele Geschicklichkeit, die Kiefer- oder Fichtenzapfen aufzubrechen, um zu den wohl verborgenen Samen zu gelangen; beide aber besitzt der Kreuzschnabel in hohem Grade. Er kommt angeflogen, hängt sich an einen Zapfen an, so daß der Kopf nach unten zu stehen kommt, oder legt den Zapfen auf einen Ast und setzt sich darauf, oder beißt ihn ab, trägt ihn auf einen Ast und hält ihn mit den starken, langen und spitzigen Nägeln fest. »Sehr schön sieht es aus«, fährt mein Vater fort, »wenn ein Fichtenkreuzschnabel, ein so kleiner Vogel, einen mittelmäßig großen Fichtenzapfen von einem Baume auf den andern trägt. Er faßt ihn mit dem Schnabel gewöhnlich so, daß seine Spitze gerade vorwärts gerichtet ist, und fliegt mit geringer Anstrengung zehn, auch zwanzig Schritte weit auf einen benachbarten Baum, um ihn auf diesem zu öffnen; denn nicht auf allen findet er Äste, auf denen er die Zapfen bequem aufbrechen kann. Dieses Aufbrechen wird auf folgende Weise bewerkstelligt. Der Kreuzschnabel reißt, wenn der Zapfen festhängt oder liegt, mit der Spitze der oberen Kinnlade die breiten Deckelchen der Zapfen in der Mitte auf, schiebt den etwas geöffneten Schnabel darunter und hebt sie durch eine Seitenbewegung des Kopfes in die Höhe. Nun kann er das Samenkorn mit der Zunge leicht in den Schnabel schieben, wo es von dem Flugblättchen und der Schale befreit und dann verschluckt wird. Sehr große Zapfen öffnet er nicht. Der über das Kreuz gebogene Schnabel ist ihm und seinen Gattungsverwandten beim Aufbrechen der Zapfen von höchster Wichtigkeit; denn einen solchen Schnabel braucht er nur wenig zu öffnen, um ihm eine außerordentliche Breite zu geben, so daß bei einer Seitenbewegung des Kopfes das Deckelchen mit der größten Leichtigkeit aufgehoben wird. Das Aufbrechen der Zapfen verursacht ein knisterndes Geräusch, das zwar gering, aber doch stark genug ist, um von unten gehört zu werden. Die abgebissenen Zapfen werden vom Fichtenkreuzschnabel selten rein ausgefressen, wie dies bei den Kiefernzäpfchen von seinen Gattungsverwandten geschieht, sondern oft ganz uneröffnet, oft halb oder zum dritten Teile eröffnet herabgeworfen. Deswegen ist der Boden unter den Bäumen, auf denen einige Kreuzschnäbel eine Zeitlang gefressen haben, zuweilen mit Zapfen bedeckt oder wenigstens bestreut. Wenn sie fortfliegen, lassen sie alle ihre Zapfen fallen. Sind die Zapfen an den Bäumen einzeln oder ausgefressen, dann suchen sie die heruntergefallenen auf und öffnen sie wie die an den Bäumen hängenden.« Der Fichtenkreuzschnabel geht selten an die weit schwerer aufzubrechenden Kiefernzapfen, weil er zu der an ihnen erforderlichen Arbeit nicht die nötige Kraft besitzt; der Kiefernkreuzschnabel aber bricht auch Kiefernzapfen ohne Mühe auf; denn er kann mit einem Male alle die Deckelchen aufheben, die über dem liegen, unter dem er seinen Schnabel eingesetzt hat. Beide Arten brechen stets mit dem Oberkiefer auf und stemmen den unteren gegen den Zapfen; daher kommt es, daß bei dem Rechtsschnäbler immer die rechte, bei dem Linksschnäbler immer die linke Seite des Schnabels nach oben gehalten wird. In Zeit von zwei bis drei Minuten ist der Vogel mit einem Zapfen fertig, läßt ihn fallen, holt sich einen andern und öffnet diesen. So fährt er so lange fort, bis sein Kropf gefüllt ist. An den auf dem Boden liegenden Zapfen erkennt man, daß der Wald Kreuzschnäbel beherbergt. Wenn letztere nicht gestört werden, bleiben sie stundenlang auf einem und demselben Baume sitzen und verlassen dann auch die Gegend, in der sie sich einmal eingefunden, wochenlang nicht. Solange sie Holzsamen auffinden, gehen sie kaum andere Nahrung an; im Notfalle aber fressen sie Ahorn- und Hornbaum- oder Hainbuchensamen, auch wohl ölige Sämereien, und nebenbei jederzeit sehr gern Kerbtiere, namentlich Blattläuse, die sie sich auch in den Gärten und Obstpflanzungen der Walddörfer zusammenlesen.
Eine notwendige Folge des vielfachen Arbeitens auf den harzreichen Ästen und Zapfen ist, daß sie sich oft in sehr unerwünschter Weise beschmutzen. Sie sind ebenso reinlich, wie die meisten übrigen Vögel, und putzen sich nach jeder Mahlzeit sorgfältig, um sich von den anhängenden Harzteilen zu reinigen, wetzen namentlich den Schnabel minutenlang auf den Ästen, vermögen aber nicht immer ihr Gefieder so in Ordnung zu halten, als sie es wohl wünschen, und oft kommt es vor, daß die Federn einen dicken Überzug von Harz erhalten. Der Leib der Kreuzschnäbel, die längere Zeit ausschließlich Nadelholzsamen fraßen, wird von dem Harzgehalte so durchdrungen, daß er nach dem Tode längere Zeit der Fäulnis widersteht. »Das Fleisch«, sagt mein Vater, »erhält zwar einen eigenen, widrigen Geruch, aber es verwest nicht eigentlich. Nur muß man es vor den Fleischfliegen in acht nehmen; denn wenn diese dazu kommen, legen sie ihre Eier daran, und die daraus hervorkommenden Maden durchwühlen und verzehren das Fleisch. Ich habe darüber mehrere Versuche angestellt und immer denselben Erfolg gefunden; ich habe einen vor mir liegen, der im Sommer in der größten Hitze geschossen wurde und doch alle Federn behalten hat; ich habe auch eine zwanzig Jahre alte Mumie gesehen.« Daß nur das in den Leib aufgenommene Harz die Ursache dieses eigentümlichen Befundes ist, geht aus andern Beobachtungen hervor; denn wenn der Kreuzschnabel sich einige Zeit von Kerbtieren genährt hat, verfällt sein Leib ebenso schnell der Verwesung, wie die Leiche anderer kleiner Vögel.
Eine Kreuzschnabelgesellschaft bildet zu jeder Zeit eine hohe Zierde der Waldbäume; am prächtigsten aber nimmt sie sich aus, wenn der Winter die Herrschaft führt und dicker Schnee auf den Zweigen liegt. Dann heben sich die roten Vögelchen lebendig ab von dem düsteren Nadelgrün und dem weißen Schnee und wandeln den ganzen Wipfel zu einem Christbaume um, wie er schöner nicht gedacht werden kann. Zu ihrer ansprechenden Färbung gesellt sich ihr frisches, fröhliches Leben, ihre stille, aber beständige Regsamkeit, ihr gewandtes Auf- und Niederklettern, ihr Schwatzen und Singen, um jedermann zu fesseln.
Es ist bekannt, daß die Kreuzschnäbel in allen Monaten des Jahres nisten, im Hochsommer ebensowohl wie im eisigen Winter, wenn der Schnee dick auf den Zweigen liegt und alle übrigen Vögel des Waldes fast vollständig verstummt, sind. Während des Nestbaues sondert sich die frühere Gesellschaft in einzelne Paare; jedes beweibte Männchen setzt sich auf die höchste Spitze des höchsten Baumes, singt eifrig, lockt anhaltend und dreht sich dabei unaufhörlich um sich selbst herum, in der Absicht, dem Weibchen in seiner ganzen Schönheit sich zu zeigen. Kommt dieses nicht herbei, so fliegt es auf einen andern Baum und singt und lockt von neuem; nähert sich die spröde Gattin, so eilt es sofort hinter ihr her und jagt sie spielend unter piependem Rufen von Ast zu Ast. Der Kiefernkreuzschnabel pflegt bei solcher Liebeswerbung noch besondere Flugspiele auszuführen, erhebt sich mit zitternden Flügelschlägen, flattert und singt dabei, kehrt aber ebenso wie der Fichtenkreuzschnabel immer wieder auf denselben Baum zurück. Das Nest steht bald auf einem weit vorstehenden Aste und hier auf einer Gabel oder auf einem dicken Aste am Stamme, bald nahe am Wipfel, bald weit von ihm, immer jedoch so, daß Zweige vor oder über dem Neste hinlaufen, durch die es gegen den darauffallenden Schnee geschützt und zugleich möglichst versteckt ist. Es ist ein Kunstbau, der äußerlich aus dürren Fichtenreisern, Heidekraut, trockenen Grasstengelchen, der Hauptsache nach aber aus Fichtenflechten, Baum- und Erdmoos aufgeführt und innen mit einzelnen Federn, Grashälmchen und Kiefernnadeln ausgelegt wird. Die Wände sind ungefähr drei Zentimeter dick und vortrefflich zusammengewebt; der Napf ist verhältnismäßig tief. »Ich hatte Gelegenheit«, sagt mein Vater, »ein Weibchen während des Nestbaues zu beobachten. Zuerst brach es die dürren Reiser ab und trug sie an Ort und Stelle, dann lief es auf den Ästen der benachbarten Bäume herum, um die Bartflechten zu suchen; es nahm davon jedesmal einen Schnabel voll, trug sie in das Nest und brachte sie in die gehörige Lage. Als die Rundung des Nestes fertig war, verweilte es länger darin und brachte alles durch Drücken mit der Brust und durch Drehen des Körpers in Ordnung. Es nahm fast alle Stoffe des Nestes von einem einzigen benachbarten Baume und war so emsig, daß es auch in den Nachmittagsstunden baute und in der Zeit von zwei bis drei Minuten mit dem Herbeischaffen und Verarbeiten einer Tracht fertig war. Das Männchen blieb immer bei ihm, fütterte es, als es zu brüten oder doch das erste Ei zu wärmen anfing (denn sobald das erste Ei gelegt war, verließ es das Nest nicht mehr), sang beständig in seiner Nähe und schien es so für die Beschwerden des Bauens und Brütens, die es nicht mit ihm teilen konnte, entschädigen zu wollen.« Das Gelege besteht aus drei bis vier verhältnismäßig kleinen, höchstens achtundzwanzig Millimeter langen, zweiundzwanzig Millimeter dicken Eiern, die auf graulich- oder bläulichweißem Grunde mit verloschenen Flecken und Stricheln von blutroter, blutbräunlicher oder schwarzbrauner Färbung besetzt sind. Zuweilen stehen diese Fleckchen kranzartig an dem stumpfen Ende, zuweilen verbreiten sie sich über das ganze Ei; dieses aber ist, aller Änderung ungeachtet, immer als Kreuzschnabel-Ei zu erkennen. Die Jungen, die von den Eltern sehr geliebt werden, erhalten vom ersten Tage ihres Lebens an Fichten- oder Kiefernsamen zur Speise, zuerst solchen, der im Kropfe der Alten erweicht und halb verdaut ist, später härteren, wachsen rasch heran und sind bald recht gewandt und munter, bedürfen aber länger als alle andern Sperlingsarten besonderer Pflege der Eltern, weil ihr Schnabel erst nach dem Ausfliegen zum Kreuzschnabel wird, sie also bis dahin nicht imstande sind, Kiefer- oder Fichtenzapfen zu öffnen. Sie umlagern daher noch lange nach ihrem Ausfliegen die arbeitenden Alten, schreien ununterbrochen wie unartige Kinder, fliegen den Eltern eilig nach, wenn diese den Baum verlassen, oder locken so lange und so ängstlich, bis jene zurückkommen. Nach und nach gewöhnen die Alten sie ans Arbeiten. Zuerst werden ihnen deshalb halbgeöffnete Zapfen vorgelegt, damit sie sich im Aufbrechen der Schuppen üben; später erhalten sie die abgebissenen Zapfen vorgelegt, wie diese sind. Auch wenn sie allein fressen können, werden sie noch eine Zeitlang geführt, endlich aber sich selbst überlassen.
Jagd und Fang der Kreuzschnäbel verursachen keine Schwierigkeit. Die neu bei uns angekommenen lassen sich, ohne wegzufliegen, von dem Schützen unterlaufen, bleiben sogar oft dann noch auf demselben Baume sitzen, wenn einer oder der andere ihrer Gefährten herabgeschossen wurde. Der Fang ist, wenn man erst einen von ihnen berückte, noch leichter als die Jagd. In Thüringen nimmt man hohe Stangen, bekleidet sie oben buschartig mit Fichtenzweigen und befestigt an diesen Leimruten. Die Stangen werden auf freien Blößen im Walde vor Tagesanbruch aufgestellt und ein Lockvogel im Bauer unten an ihnen befestigt. Alle vorüberfliegenden Kreuzschnäbel nähern sich wenigstens dieser Stange, um nach dem rufenden und lockenden Genossen zu schauen. Viele setzen sich auch auf den Busch und dabei gewöhnlich auf eine der Leimruten.
Man darf wohl behaupten, daß der Nutzen, den die Kreuzschnäbel bringen, den geringen Schaden, welchen sie uns bereiten, reichlich aufwiegt. Ganz abgesehen von dem Vergnügen, das sie jedem Tierliebhaber gewähren, oder von der Zierde, die sie im Winter den Nadelbäumen verleihen, nützen sie entschieden dadurch, daß sie in samenreichen Jahren die überladenen Wipfel durch Abreißen der Fichtenzapfen erleichtern und diese hierdurch erhalten. Neuerdings hat man auch sie als schädlich, mindestens forstschädlich, hinzustellen versucht, dabei aber wohl nur an die dürftigen Waldungen der armen Mark und anderer ebenso karger Gaue Deutschlands, nicht aber an die frischen Wälder unserer Mittelgebirge gedacht. Hier finden sie, wenn sie erscheinen, einen so überreich gedeckten Tisch, daß kein Forstmann die Zapfen, die sie aufbrechen, ihnen nachrechnet oder mißgönnt.
*
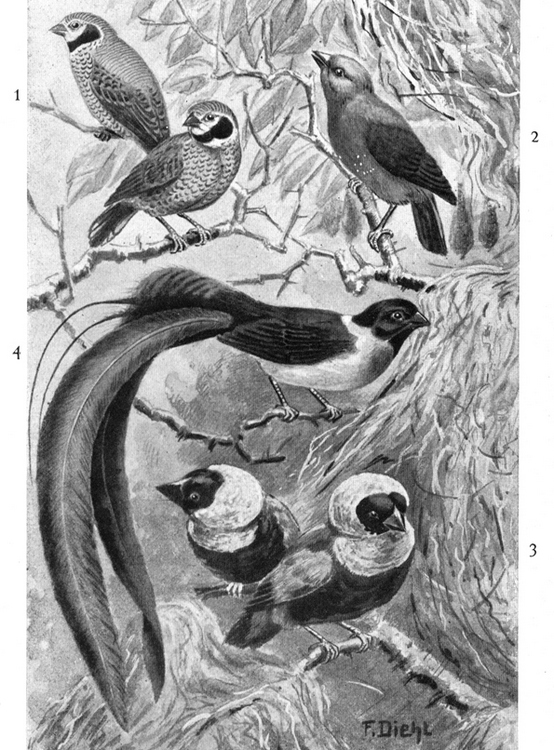
Webervögelgruppe
Bezeichnende Erscheinungen des Äthiopischen Gebietes sind die Webervögel oder Webefinken ( Ploceidae), die außer in Afrika nur noch in Südasien und Australien auftreten. Über alle Teile des Wohngebietes der Familie verbreiten sich die Prachtfinken ( Spermestinae), kleine Arren mit kurzem, dickem oder schlankem Kegelschnabel ohne Endhaken, schwächlichen Füßen, mittellangen Flügeln, deren erste Handschwinge verkümmert zu sein pflegt, kurzem, stufigem Schwanze, dessen Mittelfedern über die andern verlängert sein können, und knapp anliegendem, nach Geschlecht und Alter gewöhnlich verschiedenem Gefieder.
Die dieser Unterfamilie angehörigen Arten leben entweder in lichten Waldungen oder im Schilfe und hohem Grase oder endlich auf fast pflanzenlosen Strecken ihrer heimatlichen Länder. Gesellig, munter und regsam wie wenige Finken, tragen sie zur Belebung des von ihnen bewohnten Gebietes wesentlich bei; denn außer der Brutzeit schweifen sie, ihrer Nahrung nachgehend, auf weithin durch das Land und finden sich dann überall, wo die Erde, sei es auch kümmerlich, das tägliche Brot ihnen spendet. Die Männchen versuchen durch ihren Eifer im Singen den Mangel an Begabung zu ersetzen; die große Mehrzahl aber stümpert erbärmlich, und kaum ein einziger dürfte mit den bevorzugten Finken des Nordens wetteifern können. Hinsichtlich ihrer Bewegungen stehen die Prachtfinken hinter keinem Mitgliede ihrer Familie zurück. Sie fliegen gut, einzelne Arten pfeilschnell, obwohl mit stark schwirrendem Flügelschlage, hüpfen, ihrer schwachen Füße ungeachtet, geschickt auf dem Boden umher, klettern auch an den Halmen des Grases oder des Schilfes auf und nieder. Ihre Brutzeit trifft mit dem erwachenden Frühling ihrer Heimat zusammen, währt aber länger als dieser; die meisten Arten brüten auch dann noch, wenn der heiße Sommer bereits winterliche Armut über das Land verhängte. Freilich läßt dieser Sommer sie nicht Sorge leiden; denn gerade er reift ihre Nahrung, die vorzugsweise aus dem Gesäme allerhand Gräser oder schilfartiger Pflanzen besteht. Ungeachtet ihres schönen Gefieders und ihrer liebenswürdigen Sitten sind sie nirgends beliebt. Auch sie erlauben sich Plünderungen im reifen Getreide und müssen von den Feldern vertrieben werden, wenn sie zu Tausenden sich hier einfinden. Außer dem Menschen, der ihnen oft schonungslos entgegentritt, werden sie von allen in Frage kommenden Raubtieren ihrer Heimat verfolgt, von dem schnellen Edelfalken an bis zu den Schleichkatzen oder Raubbeuteltieren und selbst zu den Schlangen und großen Eidechsen herab. Für gewisse Falken bilden sie die gewöhnliche Speise.
Schon seit langer Zeit werden viele Prachtfinken unter dem Namen »Bengalisten« lebend auf unseren Markt gebracht, und gegenwärtig kommt kaum ein einziges Schiff von der Westküste Afrikas oder aus Australien an, das nicht eine Ladung dieser Vögel an Bord hätte. Sie hallen bei der einfachsten Pflege jahrlang im Käfig aus, brüten auch, wenn ihnen dazu Gelegenheit geboten wird, ohne Umstände im kleinsten Bauer und eignen sich daher in besonderem Grade für angehende Liebhaber von Stubenvögeln, für die jede ihrer Lebensäußerungen noch neu und daher fesselnd ist. Mit unseren einheimischen Finken lassen sie sich in dieser Beziehung nicht vergleichen, und hinter Sängern, Drosseln und andern Stubenvögeln ähnlicher Art stehen sie so weit zurück, daß der erfahrene Pfleger lächeln muß, wenn er sie über alles Verdienst loben und rühmen hört.
Der Bandvogel oder Halsbandfink ( Amadina fasciata) darf als bekanntester Vertreter der Unterfamilie gelten. Die Gesamtlänge dieses niedlichen Vogels beträgt einhundertfünfundzwanzig, die Breite zweihundertzehn, die Fittichlänge dreiundsechzig, die Schwanzlänge vierzig Millimeter. Beim Männchen bildet ein angenehmes Fahlbraun die Grundfärbung; der Rücken ist dunkler, die Unterseite lichter, jede Feder schwarz gewellt, oder, wie auf der Oberbrust, schwarz gesäumt. Das Männchen unterscheidet sich vom Weibchen durch schönere Färbung und ein breites, prächtig karminrotes Halsband, das von einem Auge zu dem andern über das weiße Untergesicht und die weiße Kehle verläuft. Das Auge ist dunkel-, Schnabel und Füße sind blaßbraun.
Wir kennen den Bandvogel seit mehreren Jahrhunderten als Bewohner Afrikas. In den Nilländern begegnet man ihm vom sechzehnten Grade nördlicher Breite an überall in den dünn bestandenen Wäldern der Steppe. Körner, und namentlich Grassämereien, bleiben immer sein Hauptfutter. In Nordostafrika begegnet man ihm gewöhnlich in Gesellschaften von zehn bis vierzig Stück. Ich meinesteils habe ihn nie paarweise gesehen, ihn während seiner Brutzeit freilich auch nicht beobachten können. Der Flug vereinigt sich oft mit andern Verwandten, und es mag wohl sein, daß die bunte Gesellschaft dann längere Zeit gemeinschaftlich im Lande auf und nieder streicht. Ein solcher Schwarm nähert sich furchtlos der Hütte des Dörflers. In den Vormittagsstunden sieht man ihn emsig mit Aufnehmen der Nahrung beschäftigt auf dem Boden umherlaufen, niemals aber auf den niederen Gräsern klettern. Stört man die Gesellschaft, so erhebt sie sich, fliegt einem der benachbarten Bäume zu, putzt und nestelt im Gefieder, und die Männchen beginnen zu singen. Sobald die Störung vorüber ist, kehren alle zum Boden zurück; naht ein Raubvogel, so fliegt der Schwarm geschlossen pfeilschnell davon, irgendeinem dichten dornigen Busche oder Baume zu, der die nötige Sicherheit verspricht. In den Mittagsstunden sitzt die Gesellschaft still in den Zweigen eines schattigen Baumes und gibt sich einem Halbschlummer hin. Nachmittags fliegt sie wiederum nach Nahrung aus.
Durch Vermittlung der Vogelhändler in den Küstenorten erhalten wir ihn alljährlich zu Tausenden, da er die Reisebeschwerden trefflich übersteht. Er hält sich bei der einfachsten Pflege, schreitet, paarweise gehalten, regelmäßig zur Fortpflanzung, fesselt anfänglich durch die Schönheit seines Gefieders oder die Anmut seiner Bewegungen und wird mit der Zeit ebenso langweilig wie alle seine Verwandten.
*
Um auch einen dünnschnäbeligen Prachtfinken aufzuführen, will ich den Blutfinken oder Amarant, das Feuervögelchen, Tausendschön usw. ( Lagonosticta minima), einer kurzen Beschreibung würdigen. Die Sippe der Blutastrilden ( Lagonosticta), die der Vogel vertritt, kennzeichnet sich durch blutfarbenes, weiß getüpfeltes Gefieder. Der Blutfink ist purpurweinrot, auf Mantel und Schultern rehbraun, jede Feder am Ende purpurn gesäumt, die Brustseite durch weiße Pünktchen gezeichnet, das Unterschwanzdeckgefieder blaßbräunlich; Schwingen und Schwanzfedern sind braun, außen purpurrot gesäumt. Das fast durchaus rehbraune Weibchen ist nur am Zügel und auf dem Bürzel purpurrot, an der Brust aber ebenfalls weiß gepunktet. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel rot, mit schwarzer Firsten- und Dillenkante, der Fuß rötlich. Die Länge beträgt neunzig, die Breite einhundertzwanzig, die Fittichlänge fünfundvierzig, die Schwanzlänge fünfunddreißig Millimeter.
Der Blutfink bewohnt ganz Mittelafrika, von der West- bis zur Ostküste und vom zweiundzwanzigsten Grade nördlicher bis zum fünfundzwanzigsten Grade südlicher Breite. Hartmann, der wenige Jahre nach mir die oberen Nilländer bereiste, möchte ihm eine ähnliche Stellung zuweisen, wie solche unser Haussperling erworben hat, und in der Tat darf er als Hausvogel betrachtet werden. Zu gewissen Zeiten fehlt er keiner der Dorfschaften Südnubiens und Ostsudans, nicht einmal der mitten im Walde stehenden einzelnen Hütte. Er ist einer der ersten Vögel der Wendekreisländer, den man bemerkt, wenn man von Ägypten aus dem Sudan zuwandert. Nur ein Honigsauger und der Stahlfink gehen weiter nach Norden hinauf als er. Gewöhnlich sieht man ihn in der Nähe der Dorfschaften, mit andern Familienverwandten zu oft unzählbaren Schwärmen vereinigt; er lebt aber auch fern von den Menschen in der einsamen Steppe und selbst im Gebirge, bis zu anderthalbtausend Meter Meereshöhe, obgleich hier seltener.
Der Blutfink ist nicht bloß ein zierlich gefärbtes, sondern auch ein anmutiges und liebenswürdiges Tierchen, an dem man seine rechte Freude haben kann. Solange die Sonne am Himmel steht, ist er tätig; höchstens in den Mittagsstunden sucht er im schattigen Gelaube der immergrünen Bäume Schutz gegen die drückende Sonne. Sonst fliegt er ohne Unterbrechung von Zweig zu Zweig oder trippelt mit rascher Geschäftigkeit auf den Ästen, den Häusern und endlich auf dem Boden umher. Kaum einer seiner Verwandten übertrifft ihn in der Eilfertigkeit seines Fluges, sicherlich keiner in der Rastlosigkeit, die ihn kennzeichnet. In den letzten Monaten der Dürre hat er seine Mauser vollendet und denkt mit dem ersten Frühlingsregen, etwa Anfang September, an seine Fortpflanzung. Bis dahin lebte er in Scharen; jetzt trennt er sich in Paare, und diese kommen nun vertrauensvoll in die Dörfer und Städte herein und spähen nach einer passenden Stelle unter dem Dache des kegelförmigen Strohhauses oder der würfelförmigen Lehmhütte des Eingeborenen. Hier, in irgendeiner Höhlung oder auf einer andern passenden Unterlage, wird ein wirrer Haufen von dürren Halmen zusammengetragen, dessen Inneres aber eine wohlausgerundete, jedoch keineswegs auch sorgfältig ausgelegte Höhlung enthält. Im Notfalle brütet der Blutfink auf Bäumen oder selbst nahe am Boden. So bemerkte ich im Januar in den Waldungen des oberen Blauen Nils ein Weibchen dieses Vogels, das an einer und derselben Stelle ängstlich über den Boden hin und her flog, vermutete, daß es in der Nähe wohl sein Nest haben möge, suchte und fand dieses auf dem Boden in noch nicht zusammengetretenem dürren Grase stehen, wo es der Umgebung auf das vollständigste ähnelte. Es enthält drei bis sieben vierzehn Millimeter lange, elf Millimeter dicke, weiße, sehr rundliche und glattschalige Eier. Hieraus geht hervor, daß der Blutastrild mehrmals im Jahre brütet, und dies stimmt denn auch mit den Erfahrungen überein, die an Gefangenen dieser Art gesammelt wurden. Das Männchen benimmt sich ebenfalls ungemein zärtlich der Gattin, streitsüchtig einem Nebenbuhler gegenüber und brütet abwechselnd mit dem Weibchen. Die Eier werden binnen dreizehn Tagen gezeitigt, die Jungen mit Kerbtieren und vorher im Kropfe aufgeweichten Sämereien aufgefüttert.
*
Nester der Webervögel verleihen gewissen Bäumen Mittelafrikas und Südasiens einen prächtigen Schmuck. Bäume, die mit einem Teil ihrer Krone ein Gewässer beschatten, werden von diesen gefiederten Künstlern allen übrigen vorgezogen und manchmal mit Nestern förmlich bedeckt. Webervogelansiedelungen können daher geradezu als hervorstechendes Merkmal für Innerafrika, Indien und die Eilande des Indischen Inselmeeres gelten. Es ist bezeichnend für die eigentümlichen Künstler, daß sie stets in größeren Gesellschaften brüten. Ein Webervogelnest an einem Baume ist eine Seltenheit; gewöhnlich findet man ihrer zwanzig, dreißig, selbst hundert und mehr. Die ungemeine Festigkeit dieser künstlichen Nester läßt sie jahrelang Wind und Wetter Trotz bieten, und so kann es kommen, daß man an demselben Baume, der eben von einer Ansiedlung der Vögel bevölkert ist, noch die Nester von drei und vier früheren Jahrgängen hängen sieht. Einen solchen Schmuck gewahrt man innerhalb des Verbreitungsgebietes der Unterfamilie überall, im Gebirge wie in der Ebene, in dem einsamen Walde wie unmittelbar über dem Hause des Dörflers.
Die Webervögel ( Ploceinae) sind die größten Mitglieder und bilden den Kern der nach ihnen benannten Familie. Gelb oder Rötlichgelb und Schwarz sind die vorherrschenden Farben ihres Gefieders; es gibt aber auch vorwaltend schwarze, rote, sperlingsgraue und weißliche Weber. Der Kopf oder das Gesicht pflegt dunkel gefärbt zu sein; der Rücken ist meist grünlich oder rötlichgelb, die Unterseite reingelb, licht- oder dunkelrot gefärbt.
Alle Webervögel treten häufig auf und zeichnen sich durch eine auch während der Fortpflanzungszeit nicht gestörte Geselligkeit aus. Nach der Brutzeit schlagen sie sich in Flüge zusammen, die oft zu vielen Tausenden anwachsen und unter Umständen wahrhaft verheerend in die Felder einfallen können, schwärmen längere Zeit im Lande umher, mausern dabei und kehren schließlich zu demselben Baume, der ihre oder ihrer Jungen Wiege war, oder wenigstens in dessen Nähe zurück. Hier herrscht einige Monate lang ein sehr reges Leben; denn der Bau der Nester erfordert viel Zeit, und die Vögel sind so eifrig und baulustig, daß sie oft das fast ganz fertige Nest wieder einreißen und ein neues errichten. Die Nester sind ohne Ausnahme Kunstbauten und entweder aus Pflanzenfasern oder aus biegsamen Grashalmen, die, wie es scheint, durch den Speichel der Vögel noch besonders geschmeidig werden, zusammengeschichtet oder gewebt. Wahrscheinlich brüten alle Webervögel mehrmals im Jahre, und daraus dürfte es zu erklären sein, daß man selbst in wenig verschiedenen Gegenden eines und desselben Landstriches frische Nester und Eier in verschiedenen Monaten des Jahres findet. Die Jungen sind in solchen Nestern wohl geborgen. An dem schwankenden Gezweige kann sich keine der so gern nesterplündernden Meerkatzen, kein anderes Raubsäugetier erhalten; es stürzt zu Boden, ins Wasser hinab, wenn es mit Räubergelüsten sich naht. Bei gewissen Arten, so beim Mahaliweber, wird das Nest noch außerdem gegen Angriffe verwahrt, indem die bauenden Eltern Dornen mit den Spitzen nach außen einflechten. Innerhalb ihres Nestes also sind alte und junge Weber gegen jeden gewöhnlichen Feind gesichert.
Sämereien aller Art, namentlich aber auch Getreide, Körner und Schilfgesäme, bilden die bevorzugte Nahrung der Webervögel. Außerdem jagen sie sehr eifrig Kerbtiere und füttern namentlich mit solchen ihre verhältnismäßig zahlreiche Brut heran. Raubzüge gegen die Felder unternehmen sie hauptsächlich nach der Brutzeit, während sie die gewaltigen Schwärme bilden. Dann nötigen sie den Menschen, zumal den Bewohner ärmerer Gegenden, der in seinem Getreidefelde sein ein und alles besitzt, zur ernsten Abwehr. Außer dem Menschen haben sie in den Edelfalken und Sperbern ihrer Heimatländer viele und gefährliche Feinde.
Auf unserem Tiermarkte kommen mehrere, wenn auch fast nur westafrikanische Arten ziemlich häufig vor; denn sie sind zählebige Vögel, die die Beschwerden, Entbehrungen und Qualen des Versandes leicht ertragen und bei einigermaßen entsprechender Pflege vortrefflich im Käfig ausdauern, falls man ihnen Gelegenheit gibt, ihre Kunst auszuüben, auch bald zu weben beginnen und in Gesellschaft ihresgleichen unbedingt zur Fortpflanzung schreiten. Aus diesen Gründen dürfen sie als die empfehlenswertesten Käfigvögel bezeichnet werden, die ihre Familie zu bieten vermag. Ihr Gesang ist allerdings nicht viel wert; dafür aber weben sie, solange ihre Brutzeit währt, zur wahren Augenweide ihres Gebieters außerordentlich fleißig an ihren kunstvollen Bauten.
Zwei von mir in Nordostafrika und später im Käfig vielfach beobachtete Arten der Sippe der Edelweber ( Hyphantornis) mögen die teilnahmswerten Vögel genauer kennen lernen.
Der Goldweber ( Hyphantornis galbula) zählt zu den kleineren Arten der Sippschaft; seine Länge beträgt etwa einhundertdreißig, die Fittichlänge siebzig, die Schwanzlänge fünfundvierzig Millimeter. Die Stirn bis zum vorderen Augenrand, Zügel, Kopfseiten und Kinn sind kastanienrotbraun, Oberkopf, Hals und Unterseite gelb, die Oberteile olivengelb, auf dem Bürzel lebhafter, die Schwingen und deren Deckfedern olivenbraun, die Schwanzfedern bräunlich olivengelb. Der Augenring ist rot, der Schnabel schwarz, der Fuß fleischrötlich. Beim Weibchen ist die olivengrünlichgraue Oberseite auf Mantel und Schultern mit dunklen Schaftflecken gezeichnet. Der Goldwebervogel findet sich in Habesch von der Küste des Roten Meeres an bis in das Hochgebirge hinauf, sonst aber auch im ganzen Ostsudan, an geeigneten Orten in großer Anzahl.
Der Masken- oder Larvenwebervogel ( Hyphantornis abyssinica) ist merklich größer als der Goldweber. Seine Länge beträgt einhundertsiebzig, die Breite zweihundertachtzig, die Fittichlänge neunzig, die Schwanzlänge fünfundfünfzig Millimeter. Vorderkopf und Kehle sind schwarz, auf dem Hinterkopfe in Rotbraun übergehend, Nacken, Hinterhals und Unterseite hochgelb, zwei Schulterflecken wiederum schwarz, die dunkelolivenbraunen Schwingen außen schmal oliven-, innen breit schwefelgelb gesäumt, die matt olivengelbbräunlichen Steuerfedern innen breit gelb gesäumt. Der Augenring ist kaminrot, der Schnabel schwarz, der Fuß rötlich hornfarben. Im Winterkleide gleicht das Männchen dem oberseits auf olivengrünem Grunde durch dunkle Schaftstriche gezeichneten, auf der Braue, den Kopfseiten und Unterteilen gelben Weibchen, zeigt auch wie dieses eine breite, durch die gelben Endränder der größten Oberflügeldeckfedern gebildete Flügelquerbinde.
Die Webervögel vereinigen gewissermaßen die Eigenschaften verschiedener Finken in sich. Dies spricht sich in ihrem ganzen Wesen aus. Nur die unter allen Umständen sich gleichbleibende Geselligkeit ist ihnen eigentümlich. Morgens und abends erscheinen sie scharenweise auf gewissen Bäumen, während der Brutzeit selbstverständlich auf denen, die die Nester tragen. Die Männchen sitzen auf der Spitze der höchsten Zweige und singen. Der Gesang ist keineswegs schön, aber im höchsten Grade gemütlich. Es spinnt, schnalzt und schnarrt und pfeift durcheinander, daß man gar nicht daraus klug werden kann. Die Weibchen setzen sich neben die Männchen und hören deren Liedern mit wahrer Begeisterung zu. So treibt es die Gesellschaft bis ein paar Stunden nach Sonnenaufgang; dann geht sie auf Nahrung aus. In den Mittagsstunden sammeln sich verschiedene Flüge, manchmal Tausende, in Gebüschen um Lachen oder in solchen, die an einer seichten Stelle des Stromes stehen, schreien und lärmen in ihnen nach Art unserer Sperlinge und stürzen plötzlich alle zusammen auf einmal an das Wasser, nehmen hier einen Schluck und eilen so schnell wie möglich wieder in das Gebüsch zurück. Zu diesem eiligen Trinken haben sie ihre guten Gründe; denn ihre Hauptfeinde, die Sperber und die kleinen Falken, lauern über den Bäumen auf sie und stoßen pfeilschnell unter sie, sowie sie das sichere Gebüsch verlassen. Gewöhnlich verweilt eine Webervogelschar stundenlang an einer und derselben Stelle, und während dieser Zeit fliegt sie vielleicht zehn- oder zwanzigmal an das Wasser hinab. Nachmittags geht es wieder zum Futtersuchen, und abends vereinigt sich die Schar auf demselben Baume wie am Morgen, um dasselbe Lied zu singen. Die Mauser, die im Ostsudan in den Monaten Juli bis August stattfindet, vereinigt noch größere Scharen als gewöhnlich, und diese streifen nun längere Zeit miteinander umher.
In den Urwäldern am Blauen Flusse wurden die ersten Nester mit Beginn der Regenzeit angelegt, und schon im August fand ich die Eier. In den Bogosländern dagegen brüteten die Webervögel im März und April. Die meisten Arten nisten mindestens zweimal im Jahre, immer im Frühling, in ihrer Heimat. Beim Aufbau des Nestes wird zuerst aus langen Grashalmen ein Gerippe gefertigt und an die äußerste Spitze langer, biegsamer Zweige befestigt. Man erkennt in ihm die Gestalt des Nestes bereits deutlich; doch ist dasselbe noch überall durchsichtig. Nun wird es weiter ausgebaut und namentlich an den Wänden mit großer Sorgfalt verdichtet. Die ersten Halme werden von oben nach unten gezogen, um so ein möglichst wasserdichtes Dach herzustellen, die später verwandten auch quer durch das Gerippe gesteckt. Auf der einen Seite, gewöhnlich nach Süden hin, bleibt das kreisrunde Eingangsloch offen. Das Nest gleicht jetzt seiner Gestalt nach einem stumpfen Kegel, der auf eine Halbkugel gesetzt ist. Noch ist es jedoch nicht vollendet; es wird nun zunächst die Eingangsröhre angefertigt. Diese heftet sich an das Schlupfloch an, läuft an der ganzen Wandung herab und wird mit ihr fest verbunden. An ihrem unteren Ende befindet sich das Einflugloch. Ganz zuletzt erst wird auch das Innere vollends ausgebaut und mit einer Unterlage von äußerst feinen Grashalmen ausgefüttert. Erscheint dem Männchen, das der alleinige Baumeister des Nestes ist, ein Zweig nicht haltbar genug, so verbindet es zunächst deren zwei durch eine Brücke, die dann zur Ansatzstelle der schaukelnden Wiege dient. Wenn erst das Rippenwerk hergestellt ist, schreitet die Arbeit rasch fort, so schwierig es dem Vogel zuletzt auch wird, noch einen Halm mehr zwischen die bereits verbauten einzuschieben. Nachdem das Nest vollendet ist, schlüpft das Weibchen aus und ein, um innen nachzubessern, wo es nötig scheint. Unmittelbar darauf, manchmal schon, ehe das Nest vollendet ist, beginnt es zu legen. Das Männchen baut währenddem, selbst wenn das Weibchen bereits brütet, noch eifrig fort. Solange es arbeitet, befindet es sich in größter Aufregung, nimmt die wunderbarsten Stellungen an, bewegt zitternd die Flügel und singt ohne Unterbrechung. Ist das Nest endlich vollendet, so nimmt es ein zweites in Angriff, zerstört vielleicht auch dieses wieder, um mit den Baustoffen ein drittes zu errichten, ohne das eine wie das andere zu benutzen.
Das Gelege besteht aus drei bis fünf Eiern von zwanzig bis fünfundzwanzig Millimeter Länge und dreizehn bis sechzehn Millimeter Dicke, die auf grünem Grunde braun gefleckt sind. In manchen, den geschilderten ganz gleichen Nestern fand ich jedoch Eier, die der Größe nach den eben beschriebenen zwar gleich waren, anstatt der grünen aber eine weiße Grundfarbe zeigten. Auch Heuglin gibt an, daß die Webervögeleier von Weiß durch Rötlich zu Grün abändern. Das Weibchen brütet allein, übernimmt auch alle Elternsorgen. Nach vierzehntägiger Bebrütung entschlüpfen die Jungen; drei Wochen später sind sie ausgeflogen, kehren anfänglich aber unter Führung der Mutter immer wieder ins Nest zurück, bis sie endlich Selbständigkeit erlangt haben. Der Vater bekümmert sich nicht um sie.
Es ist ein hübsches Schauspiel, Webervögel am Neste zu beobachten. Ihre Regsamkeit ist, wenn die Weibchen brüten, und noch mehr, wenn die Jungen heranwachsen, ungemein groß. Von Minute zu Minute beinahe kommt das Weibchen angeflogen, hängt sich unten an das Nest an und steckt den Kopf durch den Eingang, um die hungrige Brut zu atzen, ohne eigentlich ins Nest einzutreten. Da nun ein Nest dicht neben dem andern hängt, gleicht der ganze Baum wirklich einem Bienenstock. Fortwährend kommen einige, fortwährend fliegen andere wieder dahin.
Im Käfig halten sich alle Webervögel vortrefflich, schreiten auch, wenn man sie gesellschaftsweise in einen größeren Raum bringt und mit geeigneten Baustoffen versieht, regelmäßig zur Fortpflanzung.
*
Die Viehweber ( Textor) unterscheiden sich von den Edelwebern durch bedeutendere Größe. Im Ostsudan habe ich den Alektoweber ( Textor alecto) kennengelernt. Seine Länge beträgt fünfundzwanzig, die Breite sechsunddreißig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge neun Zentimeter. Das Gefieder ist einfarbig, mattglänzend schwarz, das Kleingefieder aber an der Wurzel weiß, welche Färbung hier und da zur Geltung kommt, das Auge braun, der Schnabel horngelb, der Fuß schmutziggrau.
Eine zweite Art der Sippe, der Viehweber ( Textor dinemelli), ist merklich kleiner, nur zwanzig Zentimeter lang. Kopf und Unterseite sind weiß, der Mantel, die Schwingen und der Schwanz schokoladebraun, alle Federn lichter gesäumt, ein kleiner Fleck am Flügelbuge, der Bürzel und die Schwanzdecken aber scharlachrot, die Zügel endlich schwarz. Der Schnabel ist unrein schwarzblau, der Fuß dunkelblau.
Der Alektovogel bewohnt ganz Mittelafrika, der Viehweber das Innere des Erdteils und Habesch. Ersterer wird in Süd- und Ostafrika durch nahe Verwandte, den Büffel- und Mittelweber, vertreten, deren ich aus dem Grunde Erwähnung tun muß, als sich die nachstehende Lebensbeschreibung zum Teil auf sie bezieht.
Die Viehweber zählen zu den auffallendsten Mitgliedern ihrer Familie. Sie verleugnen die Sitten und Gewohnheiten der Verwandten nicht, erinnern jedoch in mehr als einer Hinsicht an die Drosseln; sie sind Webervögel, ihre Nester aber haben mit denen unserer Elster mehr Ähnlichkeit als mit den zierlichen Bauten, die ihre Verwandten aufführen. Alle Arten leben vorzugsweise auf Viehweiden, am liebsten in der Nähe von Herden, meist in Gesellschaft von Glanzstaren und Madenhackern. Vom Büffelweber sagt A. Smith folgendes: »Erst als wir nördlich über den fünfundzwanzigsten Grad südlicher Breite gelangt waren, trafen wir diesen Vogel, und wie die Eingeborenen versichern, kommt er auch selten weiter südlich vor, aus dem einfachen Grunde, weil dort die Büffel seltener sind. Wo wir ihn antrafen, fanden wir ihn stets in Gesellschaft der Büffel, auf deren Rücken er saß und zwischen denen er umherflog. Er hüpfte auf den Tieren herum, als ob er ein Madenhacker wäre, und bekümmerte sich nur um seine Nahrung, die vorzugsweise aus den Zecken bestand, die sich an die Büffel festgesetzt hatten. Dies lehrte uns die Eröffnung ihrer Magen zur Genüge. Auf den Boden kamen sie, um den Kot der Büffel zu durchsuchen. Nächst dem Dienst, den sie den Büffeln durch Ablesen gedachter Schmarotzer erweisen, nützen sie noch dadurch, daß sie ihre Freunde warnen, wenn irgend etwas Verdächtiges sich zeigt. Dann erheben alle Büffel die Köpfe und entfliehen. Die Büffelweber besuchen nur Büffel, und diese haben keinen andern Wächter, während die Madenhacker dem Nashorn gehören.« Den Alektovogel habe ich zwar nicht auf den Büffeln beobachtet, zweifle jedoch nicht, daß auch er dem Herdenvieh Ostsudans unter Umständen die gleichen Dienste leistet. Er gehört übrigens nicht unter die häufigen Vögel des Landes. Ich habe ihn erst südlich des sechzehnten Grades der nördlichen Breite und nicht oft gefunden. Wo er vorkommt, bildet er Gesellschaften; einzeln sieht man ihn nicht. Die Trupps sind nicht so zahlreich wie die der Edelweber, immerhin aber noch ziemlich stark, wie man am besten nach der Anzahl der Nester einer Ansiedlung schließen kann. Ich zählte auf einzelnen Bäumen drei, sechs, dreizehn und achtzehn solcher Nester. Es gehört aber auch schon ein ziemlich großer Baum dazu, um so viel dieser sonderbaren Gebäude zu tragen. Jedes Nest ist nämlich ein für die Größe des Vogels ungeheurer Bau von mindestens einem Meter im Durchmesser. Es besteht aus Reisern und Zweigen, zumal aus denen der Garat-Mimose, die trotz ihrer Dornen benutzt werden. Diese Zweige legt und flicht der Vogel zu Astgabeln, aber so wirr untereinander und so unordentlich zusammen, daß man beinahe bis in das Innere der Nestkammer blicken kann. Von außen sieht das Nest kratzborstig aus. Ein Eingang führt in das Innere. Er ist im Anfang so groß, daß man bequem mit der Faust eindringen kann, verengert sich aber mehr und mehr und geht endlich in einen Gang über, der gerade für den Vogel passend ist. Der innere Teil des Nestes ist mit feinen Würzelchen und mit Gras ausgefüllt. Heuglin gibt an, daß die Nester zuweilen noch viel größer seien, nämlich zwei bis drei Meter Länge und einen bis anderthalb Meter Breite und Höhe erreichen können. In einem solchen Haufen sind dann drei bis acht Nester angelegt; jedes einzelne ist in der beschriebenen Weise mit feinem Grase und Federn ausgefüttert und enthält drei bis vier sechsundzwanzig Millimeter lange, zwanzig Millimeter dicke, sehr feinschalige Eier, die auf weißlichem Grunde mit größeren und kleineren, grauen und lederbraunen Punkten und Flecken gezeichnet sind. Ein solcher Nestbaum wird nur zu gewissen Zeiten des Jahres von einer überaus lärmenden Gesellschaft bewohnt. In der Nähe Khartums beobachtete ich, daß der schwarze Weber zu Anfang der Regenzeit, also zu Ende August, brütet. In der Sahara nistet er im April. Ich weiß nicht, ob die Viehweber während der übrigen Zeit des Jahres ebensoviel Lärm verursachen wie während der Brutzeit. Die Ansiedlungen, die ich kennenlernte, machten sich schon von weitem durch das Geschrei der Vögel bemerklich. Die Stimme ist sehr laut und verschiedenartig. Während weniger Minuten, die ich unter einem Baum verweilte, schrieb ich mir folgende Laute nieder. Eines der Männchen begann: »Ti, ti, terr, terr, zerr, zäh«, das andere antwortete: »Gai, gai, zäh«, ein drittes ließ den Ton »Guik, guik, guk, guk, gäh« vernehmen. Andere schrien: »Gü, gü, gü, gü, gäh«, und einige spannen nach Kräften. Es ging zu wie bei einem Bienenschwarm. Die einen kamen, die andern gingen, und es schien beinahe, als hätten sich fast alle ausgeflogenen Jungen auf dem Baum versammelt; denn mit den wenigen Nestern stimmte die erhebliche Menge der Vögel nicht überein.
Der Alektovogel klettert meisterhaft, läuft rasch und behend und fliegt leicht, viel schwebend, jedoch ziemlich langsam und mit auffallend hoch getragenen Fittichen dahin. Sein Wesen ist friedfertig, sein Hang zur Geselligkeit nicht geringer als bei seinen Verwandten. Im Käfig verträgt er sich mit allen Vögeln, die ihn nicht behelligen, dauert bei einfacher Nahrung trefflich aus und schreitet unter geeigneter Pflege ebenfalls zur Fortpflanzung.
*
Wenn in Südnubien die grüne Durrah, die jeden bebaubaren Streifen der Nilufer bedeckt, der Reife sich naht, kann man ein prachtvolles Schauspiel gewahren. Einfacher, zwitschernder Gesang richtet die Aufmerksamkeit nach einem bestimmten Teile des Feldes hin, und hier sieht man auf einem der höchsten Fruchtkolben, einem leuchtenden Flämmchen vergleichbar, einen prachtvollen Vogel sitzen und unter lebhaften Bewegungen sich hin- und herdrehen. Er ist der Sänger, dessen Lied man vernahm. Der einfache Ton findet bald Echo in dem Herzen anderer, und hier und da huscht es empor, über das ganze Feld verteilt es sich, Dutzende, ja vielleicht Hunderte der brennendroten Tierchen erscheinen in der Höhe und werden dem Grün zum wunderbarsten Schmuck. Es hat den Anschein, als wollte jeder der Sänger, der emporstieg, die Pracht seines Gefieders von allen Seiten zeigen. Er hebt die Flügeldecken, dreht und wendet sich, brüstet sich förmlich im Strahle der Sonne. Ebenso schnell, wie er gekommen, verschwindet er wieder, aber nur, um wenige Minuten später von neuem emporzusteigen. Noch heute stehen in meiner Erinnerung die auftauchenden und schwindenden Glühpunkte auf dem dunkelgrünen Halmenmeer leuchtend vor mir.
Der Vogel, von dem ich rede, ist der Feuerweber, Feuerfink oder Orangevogel ( Pyromelana franciscana), den ich zu einer gleichnamigen Unterfamilie ( Euplectinae) stellen möchte. Er und seine Sippschaftsverwandten kennzeichnen sich mehr als durch andere Merkmale durch ihr Gefieder, das im Hochzeitskleide eigentümlich weichfederig oder sammetartig beschaffen und mit Ausnahme der Flügel und Steuerfedern schwarz und feuerrot gefärbt ist. Außer der Paarungszeit tragen alle Feuerweber, die Männchen wie die Weibchen oder Jungen, ein ungemein bescheidenes sperlingsfarbiges Kleid; gegen die Brutzeit hin aber verändert sich das Gefieder des Männchens vollständig, und zwar nicht bloß hinsichtlich der Färbung, sondern auch hinsichtlich der Beschaffenheit der Federn. Diese sind dann nicht allein weich und sammetartig, sondern auch in der Steuergegend förmlich zerschlissen und dabei von auffallender Länge. Nur die Schwung- und Steuerfedern bewahren sich das gewöhnliche Gepräge. Im Hochzeitskleide ist der männliche Feuerfink auf Oberkopf, Wangen, der Brust und dem Bauch sammetschwarz, im übrigen brennend scharlachzinnoberrot, auf den Flügeln dunkelbraun mit fahlbrauner Zeichnung, die dadurch entsteht, daß alle Federränder bedeutend lichter gefärbt sind als die Federmitte. Die Schwanzdeckfedern erreichen in diesem Kleid eine so bedeutende Länge, daß sie die wirklichen Steuerfedern beinahe verdecken. Der Augenstern ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß bräunlichgelb. Das Weibchen ist sperlingsfarben auf der Oberseite, blaß gelblichbraun auf der Unterseite, an der Kehle und am Bauch am lichtesten. Ein gelber Streifen zieht sich über das Auge. Schnabel und Fuß sind hornfarben. Die Länge beträgt zwölf, die Breite neunzehn, die Fittichlänge sechs, die Schwanzlänge vier Zentimeter.
Der Feuerfink bewohnt alle Durrah- und Dohhenfelder wasserreicher Gegenden, von Mittelnubien an bis in das tiefste Innere Afrikas. Er zieht bebaute Gegenden unter allen Umständen den unbewohnten vor und findet sich nur im Notfall in rohrartigen Gräsern. Ein Durrahfeld ist das Paradies, aus dem er sich schwer vertreiben läßt. Hier lebt er mehr nach Art der Rohrsänger als nach der anderer Webervögel. Geschickt klettert er, wie jener, an den Halmen auf und nieder, gewandt schlüpft er durch das Schilfgras am Boden, und wie der Rohrsänger verbirgt er sich bei Gefahr in dem Dickicht der Halme. Erst nachdem die Felder abgeerntet sind, die ihm während der Brutzeit Herberge gaben, streift er, wie andere seiner Familie, im Lande umher.
Man kann nicht sagen, daß der Feuerfink eigentliche Ansiedlungen bilde; wohl aber muß man auch ihm Geselligkeit nachrühmen. Obgleich die Männchen sich gegenseitig zum Gesang anfeuern und wie verliebte Hähne sich balzend auf den Durrahspitzen wiegen, geraten sie doch selten oder nie in Streit. Es herrscht unter ihnen Wetteifer der harmlosesten Art; sie vergnügen sich gegenseitig mehr, als sie sich erzürnen. Die Nester sind ebenfalls kunstreich zusammengewebt, aber doch viel leichtfertiger gebaut als die anderer Webervögel. Sie bestehen auch aus Grashalmen, werden aber nicht aufgehängt, sondern in kleine versteckte oder gänzlich von hohem Gras umgebene Büsche zwischen die Stengel der Durrah oder selbst in das hohe Gras gebaut. Nach Gestalt und Größe weichen sie sehr voneinander ab. Einige sind rundlich, andere sehr gestreckt; doch darf man im Durchschnitt ihre Länge zu achtzehn bis zwanzig, ihren Querdurchmesser zu zehn bis zwölf Zentimeter annehmen. Die Wandungen sind gitterartig und so locker zusammengefügt, daß man die drei bis sechs himmelblauen, sechzehn Millimeter langen, zwölf Millimeter dicken Eier durchschimmern sieht. Nicht selten findet man zehn bis zwölf solcher Nester auf dem Raume eines Ar. Ich glaube, daß das Weibchen allein brütet, kann dies mit Sicherheit jedoch nicht behaupten und kenne auch die Brutdauer nicht. Nur so viel vermag ich zu sagen, daß die Jungen ausgeflogen sind, bevor die Durrah eingeerntet wird, und daß nach dem Ausfliegen Alte und Junge sich zu großen Scharen zusammenschlagen und jetzt oft zur Landplage werden. Dann sind die armen Nubier, die jeden fruchtbaren Schlammstreifen benutzen und bebauen müssen, genötigt, gegen dieselben Vögel, die bis dahin ihren Feldern zum prächtigsten Schmuck gereichten, Wachen aufzustellen, deren Tätigkeit durch die Feuerfinken fortwährend rege gehalten wird.
Der Feuerfink kommt häufig lebend auf unsern Tiermarkt, wird aber von Nichtkundigen hier oft übersehen, weil er nur wenige Monate im Jahr sein Prachtkleid anlegt. Im Käfig hält man ihn beim gewöhnlichsten Futter ohne alle Mühe und sieht ihn unter geeigneter Pflege auch zur Fortpflanzung schreiten.
*
In der letzten Unterfamilie vereinigen wir die Widavögel oder Witwen ( Viduinae), mittelgroße Webervögel, die sich vor allen übrigen dadurch auszeichnen, daß während der Brutzeit einige, in der Regel vier, Schwanzfedern eine eigentümliche Gestalt erhalten und eine unverhältnismäßige Länge erreichen. Nach der Brutzeit verlieren sie diesen Hochzeitsschmuck vollständig und legen dann auch ein unscheinbares Kleid an.
Alle Witwen sind in Afrika zu Hause, und die meisten verbreiten sich weit über den Erdteil, doch besitzen ebensowohl der Süden wie der Westen und Osten ihre eigentümlichen Arten. Sie erinnern mehr als andere Webervögel an die Ammern. Während der Brutzeit leben sie paarweise; nach der Brutzeit und Mauser schlagen sie sich in starke Flüge zusammen. Die Männchen ändern je nach ihrem Kleid ihr Benehmen. Wenn sie im Hochzeitskleid prangen, nötigt sie der lange und schwere Schwanz zu eigentümlichen Stellungen und Bewegungen. Im Sitzen lassen sie die langen Federn einfach herabhängen; im Gehen aber müssen sie dieselben hoch tragen, und deshalb stelzen sie den Schwanz dann ein wenig, während sie dies sonst nicht tun. Den größten Einfluß übt der Schwanz auf ihren Flug aus. Er hindert sie an den raschen Bewegungen, die sie sonst zeigen; sie schleppen denselben mit ersichtlicher Mühe durch die Luft und werden bei einigermaßen starkem Wind durch ihn ungemein aufgehalten. Sobald sie gemausert haben, bewegen sie sich leicht und behend nach anderer Webervögel Art, durch wechselseitiges Zusammenziehen und Ausbreiten der Schwingen, wodurch eine bogenförmige Fluglinie entsteht. Die meisten Arten scheinen Erdfinken zu sein, die am Boden ihre hauptsächlichste Nahrung finden. Man sieht sie hier nach Art anderer Verwandten sich beschäftigen, um die ausgefallenen Grassämereien, ihr hauptsächliches Futter, und nebenbei Kerbtiere aufzulesen. Während der Brutzeit halten sich namentlich die Männchen mehr auf Bäumen auf und suchen hier nach Nahrung umher; denn der lange Schwanz hindert sie auch während ihrer Mahlzeit.
Die Brutzeit fällt mit dem Frühling ihrer Heimat zusammen, bald nachdem das Männchen sein Hochzeitskleid angelegt hat. Im Sudan brüten sie zu Ende des August; in den abessinischen Gebirgen in unsern Frühlingsmonaten. Die Nester ähneln denen der Webervögel, sind aber doch leicht kenntlich.
Das Kleid der männlichen Paradieswitwe ( Vidua paradisea) ist schwarz; ein breites Halsband, die Halsseiten und der Kropf sind orangezimmetrot, die übrigen Unterteile blaß rostgelb, die Schwingen dunkelbraun, außen fahlbraun gesäumt. Der Augenring hat schwarzbraune, der Schnabel schwarze, der Fuß braune Färbung. Das Weibchen ist sperlingsfarbig, auf dem Kopf fahl, mit zwei schwarzen Scheitelstreifen und schwarzem Zügel, auf der Brust roströtlich; die schwarzen Schwingen sind rostfarben gesäumt. Die Länge des Vogels, mit Ausschluß der langen Schwanzfedern, beträgt fünfzehn, mit diesen dreißig, die Breite fünfundzwanzig, die Fittichlänge acht, die Länge der äußeren Schwanzfedern sechs Zentimeter.
Die Paradieswida bewohnt Mittelafrika, und zwar vorzugsweise die dünn bestandenen Wälder der Steppe. Den Ortschaften nähert sie sich nicht gern, obgleich sie auch keinen Grund hat, den Menschen und sein Treiben zu meiden. In baumreichen Gegenden Mittelafrikas trifft man sie überall, während der Fortpflanzungszeit paarweise, sonst in kleinen Gesellschaften oder selbst in größeren Flügen. Ihr Prachtkleid trägt sie während der Regenzeit, etwa vier Monate lang. Die Mauser geht ungemein rasch vonstatten, und namentlich die großen Schwanzfedern wachsen sehr schnell. Vier Monate später sind sie bereits gänzlich abgenutzt, und mit Beginn der Dürre fallen sie aus. Der Gesang, den das Männchen, solange es sein Hochzeitskleid trägt, zum besten gibt, ist einfach, entbehrt jedoch nicht aller Anmut. Anderen ihrer Art oder Verwandtschaft gegenüber zeigt sich die Paradieswida auch während der Fortpflanzungszeit ziemlich friedfertig. Das Nest habe ich nicht gefunden, kenne auch keine verläßliche Beschreibung desselben.
Gefangene Paradieswidas gelangen regelmäßig in unsere Käfige, dauern mehrere Jahre aus, sind anspruchslos, schreiten im Gebauer nur äußerst selten zur Fortpflanzung.
*
Einer auf Helgoland vorgekommenen Art zuliebe mögen auch die Waldsänger ( Sylvicolidae) erwähnt sein. Man betrachtet diese Vögel gewöhnlich als die amerikanischen Vertreter unserer Sänger. Im Vergleich mit diesen zeichnet sie der stets merklich stärkere Schnabel aus. Alle Arten erreichen nur geringe Größe. Die Waldsänger zählen zu den Amerika eigenen Familien, verbreiten sich über den ganzen Norden des Erdteils, bewohnen auch Mittelamerika, dehnen ihren Wohnkreis jedoch nicht weit jenseits des Wendekreises aus. Ihre Lebensweise entspricht im wesentlichen dem Tun und Treiben unserer Sänger.
Die auf Helgoland beobachtete Art der Familie ist der Grünwaldsänger ( Dendroica virens), Vertreter der Waldsänger im engeren Sinn ( Dendroica), die die artenreichste Sippe der ganzen Familie bilden. Die Oberseite, ein Strich durchs Auge und die Ohrgegend sind olivengelbgrün, ein breiter Zügel-, ein Augen- und ein Bartstreifen vom Mundwinkel abwärts nebst den Halsseiten hochgelb, Kinn, Kehle und Kropf, einen breiten Schild bildend, tiefschwarz, die übrigen Unterteile weiß, schwach gelblich angeflogen, die Seiten mit breiten schwarzen Längsstreifen geziert, Schwingen und Schwanzfedern braunschwarz mit bleifarbenen, auf den Armschwingen sich verbreiternden Außensäumen. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß hornbraun. Beim Weibchen und jungen Männchen sind die Federn an Kinn und Kehle am Ende weiß gesäumt, wodurch das Schwarz mehr oder weniger verdeckt wird. Die Länge beträgt dreizehn, die Fittichlänge sieben, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.
Erst die neuzeitlichen Forschungen haben einigermaßen Aufschluß über Verbreitungskreis und Lebensweise des Grünwaldsängers gegeben. Der zierliche Vogel bewohnt den größten Teil der östlichen Vereinigten Staaten und wandert im Winter bis Mittelamerika und Westindien hinab. Seine Aufenthaltsorte sind ungefähr die unserer Grasmücken oder Laubsänger. Wie einzelne Arten jener und die meisten dieser Sippe siedelt er sich, aus seiner Winterherberge kommend, mit Vorliebe in höheren Baumkronen an, den stillen Wald oder die Pflanzungen in unmittelbarer Nähe bewohnter Gebäude bevölkernd. Erst spät im Jahre, kaum vor Beginn der Mitte des Mai, erscheint er in seinem Brutgebiet, verweilt dafür ziemlich lange im Lande und unternimmt, wenigstens im Norden seines Wohnkreises, mit Eintritt des Herbstes mehr oder minder ausgedehnte Wanderungen. Gelegentlich dieser letzteren, und zwar am neunzehnten Oktober 1858, war es, daß er auf Helgoland erlegt wurde. Während seines Zuges gesellt er sich zu andern seiner Art oder Verwandten; am Brutplatze dagegen lebt er streng paarweise und vertreibt andere seinesgleichen eifersüchtig aus seiner Nähe. In seinem Wesen und Gebaren ähnelt er unsern Laubsängern. Unruhig, beweglich und gewandt schlüpft und hüpft er durch das Gezweige; nach Meisenart turnt und klettert er, und wie ein Laubsänger folgt er vorübersummenden Kerbtieren nach. Trotz alledem findet er noch immer Zeit, sein kleines Liedchen zum besten zu geben. Die amerikanischen Forscher bezeichnen ihn als einen guten Sänger und erwähnen, daß man ihn nicht allein zu jeder Tageszeit, sondern fast während des ganzen Sommers vernimmt. Seine Nahrung besteht aus allerlei Kerbtieren und deren Larven, während des Herbstes auch aus verschiedenen Beeren.
Ein Nest, das Nuttall am 8. Juni untersuchte, war auffallenderweise in einem niedrigen, verkrüppelten Wacholderbusch aus zarten Baststreifen des Busches und andern Pflanzenfasern erbaut und mit weichen Federn ausgelegt; in der Regel aber findet man die Nester nur auf hohen Bäumen und dann auch meist aus andern Stoffen zusammengesetzt. Verschiedene, die der Sammler Welch untersuchte, standen auf Hochbäumen eines geschlossenen Forstes, waren klein, dicht und fest zusammengefügt und bestanden aus feinen Rindenstreifen, Blatteilen und Pflanzenstengeln, die, gut zusammen- und mit wenigen feinen Grashalmen verflochten, die Außenwandung bildeten, während die innere Mulde weich und warm mit seidiger Pflanzenwolle ausgekleidet zu sein pflegte. Die vier Eier, deren Längsdurchmesser etwa zwanzig und deren Querdurchmesser etwa vierzehn Millimeter beträgt, sind auf weißem oder rötlichem Grund mit bräunlichen und purpurbraunen Flecken und Tüpfeln ziemlich gleichmäßig, wie üblich aber am dickeren Ende am dichtesten gezeichnet. Als Nuttall dem von ihm gefundenen Neste sich näherte, blieb das brütende Weibchen bewegungslos in einer Stellung sitzen, daß man es für einen jungen Vogel hätte ansehen können, stürzte sich aber später auf den Boden herab und verschwand im Gebüsch. Das Männchen befand sich nicht in der Nähe des Nestes, trieb sich vielmehr in einer Entfernung von ungefähr einer englischen Viertelmeile von letzterem im Walde umher und ließ dabei seinen einfachen, gedehnten, etwas kläglichen Gesang ertönen, dessen Hauptstrophen von Nuttall mit »Di, di, teritsidé« wiedergegeben wird.
*
Die Webervögel Amerikas sind die Stärlinge ( Icteridae), Vögel von Krähen- bis Finkengröße, mit ziemlich weichem, glänzendem Gefieder, in dem Schwarz, Gelb und Rot vorherrschend sind. Die Stärlinge herbergen ausschließlich in Amerika, zu mehr als vier Fünftel im Süden und der Mitte des Erdteils, jedoch auch im Norden bis zum Polarkreise. Sie vertreten die altweltlichen Stare, ähneln aber auch den Raben und ebenso gewissen Finken. Alle Arten sind gesellig, munter, beweglich und sangfertig. Sie bewohnen und beleben die Waldungen, nähren sich von kleinen Wirbel-, Kerb- und Muscheltieren, Früchten und Sämereien, und machen sich oft verhaßt, oft wieder sehr nützlich. Ihre Nester, die denen der Webervögel an Zierlichkeit nicht nachstehen, sie vielleicht noch übertreffen, werden meist siedelweise an Bäumen aufgehängt.
In der ersten Unterfamilie vereinigen wir die Haufenvögel ( Agelainae), zu denen die kleinsten Arten der Gesamtheit zählen. Einer der häufigsten und verhaßtesten Vögel Nordamerikas, der Bobolink oder, wie unsere Händler sagen, der Paperling ( Dolichonyx oryzivorus), verdient an erster Stelle genannt zu werden, weil er halb Fink halb Stärling zu sein scheint. Er vertritt die Sippe der Reisstärlinge ( Dolichonyx). Die Länge des Paperlings beträgt achtzehn, die Breite neunundzwanzig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Im Hochzeitskleid sind Ober- und Vorderkopf, die ganze Unterseite sowie der Schwanz des Männchens schwarz; der Nacken ist bräunlichgelb, der Oberrücken schwarz, jede Feder aber breit gelb gesäumt. Die Schultergegend und der Bürzel sind weiß mit gelbem Schimmer, die Schwingen und Flügeldeckfedern schwarz, aber sämtlich gelb gesäumt. Das Auge ist braun, der Oberschnabel dunkelbraun, der Unterschnabel bläulichgrau, der Fuß lichtblau. Das etwas kleinere Weibchen ist auf der Oberseite licht gelblichbraun mit dunkleren Schaftstrichen auf den Federn, auf der Unterseite blaß graugelb, an den Seiten ebenfalls gestreift, die Zügelgegend braun, ein Streifen über dem Auge gelb. Die Schwingen und die Steuerfedern sind bedeutend lichter als beim Männchen. Diesem Kleid ähnelt das Männchen in seiner Wintertracht, und auch die Jungen stimmen im wesentlichen damit überein; jedoch sind bei ihnen alle Farben blasser und graulicher.
Der Paperling ist in Nordamerika ein Sommervogel, der sehr regelmäßig erscheint und wegzieht. Auf seiner Reise nach Süden berührt er Mittelamerika und namentlich Westindien, vielleicht auch die nördlichen Länder Südamerikas; doch scheint er nicht bis nach Brasilien vorzudringen. Im Staate Neuyork trifft er zu Anfang des Mai in größeren und kleineren Trupps ein, die sich bald durch neue Zuzüge vermehren und nach kürzester Zeit das ganze Land im buchstäblichen Sinn des Wortes erfüllen. Wie Audubon sagt, ist es unmöglich, ein von diesen Vögeln nicht bewohntes Feld aufzufinden. Dem Unbeteiligten gewährt die Beobachtung des von allen Landleuten bitter gehaßten Paperlings Vergnügen. Die Geselligkeit der Tiere wird auch während der Brutzeit nicht aufgehoben; ein Paar wohnt und brütet dicht neben dem andern. Das Nest wird auf oder hart über dem Boden ohne große Sorgfalt, jedoch immer zwischen Gras oder Getreidehalmen angelegt und selbstverständlich zum Mittelpunkte des Wohngebietes eines Paares. Während nun die Weibchen sich dem Fortpflanzungsgeschäfte hingeben, treiben sich die Männchen im neckenden Wetteifer über dem Halmenwald umher. Eines und das andere erhebt sich singend in die Luft und schwingt sich hier in eigentümlichen Absätzen auf und nieder. Das Lied des einen erregt alle übrigen, und bald sieht man eine Menge aufsteigen und vernimmt von jedem die anmutig heitere Weise. Mit Recht rühmen die Nordamerikaner den Gesang dieses Vogels; er genügt selbst dem verwöhnten Ohr eines deutschen Liebhabers. Die Töne sind reich an Wechsel, werden aber mit großer Schnelligkeit und anscheinender Verwirrung ausgestoßen und so eifrig fortgesetzt, daß man zuweilen den Gesang von einem halben Dutzend zu vernehmen glaubt, während doch nur ein einziger singt. Eine Vorstellung kann man sich nach Wilson von diesem Gesange machen, wenn man auf einem Pianoforte rasch nach einander verschiedene Töne, hohe und tiefe durcheinander, ohne eigentliche Regel anschlägt. Aber die Wirkung des ganzen ist gut. Recht häufig singt das Männchen übrigens auch im Sitzen und dann unter lebhafter Begleitung mit den Flügeln, nach Art unsers Stares. In seinen Bewegungen zeigt sich der Paperling als sehr gewandter Vogel. Sein Gang auf dem Boden ist mehr ein Schreiten als ein Hüpfen, sein Flug leicht und schön. Zudem versteht er es, in seinem Halmenwald auf- und niederzuklettern, trotz eines Rohrsängers.
In den letzten Tagen des Mai findet man die vier bis sechs etwa zweiundzwanzig Millimeter langen, sechzehn Millimeter dicken, auf bräunlichgelbem oder bläulichem Grund mit schwarzbraunen Flecken und Schnörkeln gezeichneten Eier im Nest. Jedes Paar brütet, falls ihm die ersten Eier nicht geraubt werden, nur einmal im Jahr. Die Jungen werden hauptsächlich mit Kerbtieren aufgefüttert, wachsen rasch heran, verlassen das Nest und schlagen sich sodann mit andern ihrer Art in zahlreiche Flüge zusammen. Nunmehr zeigt sich der Paperling von seiner unliebenswerten Seite. Der anmutige Gesang ist beendet, die schmucke Tracht der männlichen Vögel bereits im Wechsel begriffen; das Paar hat keinen festen Standort mehr und streift im Lande auf und nieder. Jetzt beginnen die Verwüstungen. Die Vögel fliegen von Feld zu Feld, fallen in ungeheueren Schwärmen ein, fressen die noch milchigen Körner des Getreides ebenso gern wie die bereits gereiften und fügen wegen ihrer ungeheueren Menge den Landleuten wirklich erheblichen Schaden zu. Jedes Gewehr wird jetzt gegen sie in Bereitschaft gesetzt; Tausende und Hunderttausende werden erlegt, jedoch vergeblich; denn die Verwüstungen währen demungeachtet fort. Man vertreibt die Vögel höchstens von einem Feld, um sie in das andere zu jagen. Sobald sie ihr Werk im Norden vollendet haben, fallen sie in die südlichen Pflanzungen ein. So treiben sie sich wochenlang umher, bei Tag in den Feldern hausend, nachts Rohrwälder zum Schlafen erwählend. Dann wandern sie allmählich weiter nach Süden hinab.
Im Käfig geht der Paperling ohne weiteres an das Futter, ist bald ebenso lustig und guter Dinge wie im Freien, klettert, turnt, singt nach Behagen, dauert aber nur dann einige Jahre aus, wenn man ihn knapp hält.
*
Fast ebenso häufig wie der Paperling ist der Rotflügel, Vertreter der Sippe der Sumpftrupiale ( Agelaius). Im Hochzeitskleide ist der männliche Rotflügel ( Agelaius phoeniceus) tief schwarz, auf der Schulter prächtig scharlachrot, die größte Reihe der oberen Flügeldeckfedern zimmetgelbbraun, der Augenring dunkelbraun, der Schnabel wie der Fuß endlich bläulichschwarz. Die Länge beträgt zweiundzwanzig, die Breite fünfunddreißig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Das Weibchen ist auf der Oberseite schwärzlichbraun, auf der Unterseite graulichbraun, jede Feder hier mehr oder weniger gelblichgrau gesäumt; die Kehle und die Wangen sind auf lichtgraufahlem Grunde dunkel in die Länge gestrichelt.
Auch der Rotflügel ist über ganz Nordamerika verbreitet, wo er vorkommt, häufig, im Norden der Vereinigten Staaten regelmäßiger Brutvogel, im Süden nur zeitweilig massenhaft auftretender Wintergast. In seiner Lebensweise hat er die größte Ähnlichkeit mit dem Paperling. Auch der Rotflügel wird seiner Schönheit halber oft in Gefangenschaft gehalten, verlangt wenig, singt fleißig, ist ewig munter und in Tätigkeit. Einen Gesellschaftsbauer belebt er in der anmutigsten Weise.
*
Die bekannteste Art der Sippe der Kuhstärlinge ( Molobrus) ist der berühmte oder berüchtigte Kuhvogel ( Molobrus pecoris). Kopf und Hals sind rußbraun; das ganze übrige Gefieder ist bräunlichschwarz, auf der Brust bläulich, auf dem Rücken grün und blau glänzend; der Augenring ist dunkelbraun; der Schnabel und die Füße sind bräunlichschwarz. Die Länge beträgt neunzehn, die Breite dreißig, die Fittichlänge elf, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Das Weibchen ist etwas kleiner und ziemlich gleichmäßig rußbraun, auf der Unterseite etwas lichter als auf der oberen.
Der Kuhvogel ist ebenfalls über den größten Teil Nordamerikas verbreitet und wenigstens in einzelnen Gegenden sehr häufig. Er lebt hauptsächlich auf sumpfigen Strecken, gern aber nebenbei auf Weiden, zwischen Rindern und Pferden. Seine Schlafplätze wählt er sich im Gebüsch oder im Röhricht an Flußufern. Im Norden der Vereinigten Staaten erscheint er zu Ende des März oder im Anfang des April in kleinen Flügen. Zu Ende des September verläßt er das Land wieder, gewöhnlich in Gesellschaft mit andern Vögeln. Seine Nahrung ist wesentlich dieselbe, die seine Verwandten verzehren. Unseren Staren ähnelt er darin, daß auch er oft von dem Rücken des Viehes die Schmarotzer abliest, die sich dort festgesetzt haben.
Dies alles würde nach dem Vorhergegangenen besondere Erwähnung kaum nötig erscheinen lassen, zeichnete sich der Kuhvogel nicht anderweitig wesentlich aus. Er und alle übrigen Genossen seiner Sippe brüten nicht selbst, sondern vertrauen ihre Eier fremder Pflege an, mißachten auch, wie unser Kuckuck, Schranken der Ehe und leben in Vielehigkeit. »Beobachtet man eine Anzahl dieser Vögel während der Brutzeit«, sagt Potter, »so kann man sehen, wie das Weibchen seine Gefährten verläßt, unruhig umherfliegt und schließlich an einem geeigneten Orte, von wo aus es das Tun und Treiben der andern Vögel wahrnehmen kann, geraume Zeit verweilt. Als ich einmal ein Weibchen in dieser Weise suchen sah, beschloß ich, womöglich das Ergebnis zu erfahren, stieg zu Pferde und ritt ihm langsam nach. Ich verlor es zuweilen aus dem Gesicht, bekam es jedoch immer bald wieder zu sehen. Es flog in jedes dichte Gebüsch, durchspähte mit der größten Sorgfalt alle Stellen, wo die kleineren Vögel gewöhnlich bauen, schoß zuletzt pfeilschnell in ein dichtes Gebüsch von Erlen und Dornsträuchen, verweilte hier fünf bis sechs Minuten und kehrte dann zu seiner Gesellschaft auf dem Felde zurück. Im Dickicht fand ich das Nest eines Erdwaldsängers oder Gelbkehlchens ( Geothlypis trichas) und in ihm ein Ei des Kuhvogels neben einem andern des rechtmäßigen Besitzers. Als der Kuhvogel längs der einen Seite der Landzunge dahinflog, begab er sich in das lichte Laubwerk einer kleinen Zeder und kehrte zu wiederholten Malen zurück, ehe er es über sich vermochte, den Ort zu verlassen. Bei genauerer Untersuchung fand ich einen Ammerfinken auf dem Neste sitzen; in dieses würde der Kuhvogel sich eingestohlen haben, wäre der Besitzer abwesend gewesen. Jenes Gelbkehlchen kehrte, als ich mich noch in der Nähe der angegebenen Stelle befand, zurück und flog pfeilschnell in sein Nest, verließ es aber sogleich wieder, verschwand und kam wenige Minuten später in Gesellschaft des Männchens zurück. Beide zwitscherten mit großer Lebhaftigkeit und Unruhe eine halbe Stunde lang.«
Das Ei ist, wie bei dem Kuckuck, kleiner, als man, von der Größe des Vogels schließend, vermuten möchte, etwa fünfundzwanzig Millimeter lang, sechzehn Millimeter dick und auf blaßblaugrauem Grunde, am dichtesten gegen das dickere Ende hin, mit umberbraunen Flecken und kurzen Strichen bezeichnet. Nach Audubon legt der Kuhvogel niemals mehr als ein Ei in ein Nest, zweifelsohne ihrer aber mehrere im Verlaufe der Brutzeit. Nach ungefähr vierzehntägiger Bebrütung schlüpft der junge Vogel aus, und nunmehr benehmen sich Pflegeeltern und Pflegekind genau ebenso, wie bei Beschreibung des Kuckucks geschildert wurde.
*
Eine zweite Unterfamilie umfaßt die Gilbvögel oder Trupiale ( Icterinae). Sie unterscheiden sich von den vorhergehenden durch beträchtlichere Größe, sowie durch reiches Gefieder von vorherrschend gelber Färbung. Die Weibchen weichen wenig von den Männchen ab, und die Jungen haben niemals die ammerartige Zeichnung des Gefieders wie die Mitglieder der vorhergehenden Gruppe. Die Gilbvögel bewohnen vorzugsweise die südliche Hälfte Amerikas, ohne jedoch im Norden zu fehlen. Ihre Gesellschaften beleben die Gebüsche und Wälder, und ihre oft sehr reichhaltigen Lieder erfreuen den Ansiedler wie den Jäger inmitten des Waldes. Ihre Nahrung besteht aus Kerbtieren und Früchten. Sie sind Erbauer äußerst künstlicher Nester, die oft in großer Anzahl auf einem und demselben Baume aufgehängt werden. Fast alle Arten empfehlen sich als Stubenvögel durch Schönheit ihres Gefieders, lebhaftes Betragen und reichhaltigen Gesang.
Unter den nordamerikanischen Arten der Unterfamilie verdient der Baltimorevogel oder Baltimoretrupial ( Icterus baltimore) als der bekannteste zuerst erwähnt zu werden. Er vertritt die artenreiche Sippe der Trupiale ( Icterus). Kopf, Hals, Kinn und Kehle, Mantel, Schultern, Flügel und die beiden mittelsten Schwanzfedern sind tiefschwarz, Oberflügeldecken, Bürzel, Oberschwanzdeckgefieder und die übrigen Unterteile feurig orange. Der Augenring ist braun, der Schnabel schwärzlich bleigrau, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt zwanzig, die Breite dreißig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge acht Zentimeter.
Das Brutgebiet des Baltimorevogels umfaßt die Oststaaten Nordamerikas, von Kanada an bis zu den westlichen Hochebenen. Von hier aus wandert er im Winter bis Westindien und Mittelamerika hinab. Nach Audubon ist er an geeigneten Orten sehr häufig, wogegen er andere nur auf dem Zuge berührt. Hügelige Landschaften scheinen ihm vor allen zuzusagen. Er ist ein Sommervogel, der mit Beginn des Frühlings paarweise im Lande eintrifft und dann baldmöglichst zur Fortpflanzung schreitet. Sein Nest wird, je nachdem das Land, in dem der Vogel wohnt, heißer oder kälter ist, verschieden ausgestattet, immer aber an einem schlanken Zweige angehängt und sehr künstlich gewebt. In den südlichen Staaten Nordamerikas besteht es nur aus sogenanntem »spanischen Moose« und ist so locker gebaut, daß die Luft überall leicht hindurchdringen kann; das Innere enthält auch keine wärmenden Stoffe, ja der Bau wird sogar auf der Nordseite der Bäume angebracht. In den nördlichen Staaten hingegen wird es an Zweigen aufgehängt, die den Strahlen der Sonne ausgesetzt sind, und innen mit den wärmsten und feinsten Stoffen ausgekleidet. Der bauende Vogel fliegt zum Boden herab, sucht sich geeignete Stoffe, heftet das Ende derselben mit Schnabel und Klauen an einen Zweig und flicht alles mit großer Kunst durcheinander. Gelegentlich des Nestbaues wird der Baltimorevogel übrigens zeitweilig lästig. Die Frauen haben dann auf das Garn zu achten, das sie bleichen wollen; denn jener schleppt alle Faden, die er erlangen kann, seinem Neste zu. Man hat oft Zwirnssträhne oder Knäuel mit Seidenfaden in seinem Nestgewebe gefunden.
Nachdem der Bau fertig ist, legt das Weibchen vier bis sechs Eier, die ungefähr fünfundzwanzig Millimeter lang, sechzehn Millimeter dick und auf blaßgrauem Grunde mit dunkleren Flecken, Punkten und Strichen gezeichnet sind. Nach vierzehntägiger Bebrütung entschlüpfen die Jungen; drei Wochen später sind sie flügge. Dann brütet, wenigstens in den südlichen Staaten, das Paar wohl noch einmal im Laufe des Sommers. Bevor die Jungen ausfliegen, hängen sie sich oft an der Außenseite des Nestes an und schlüpfen aus und ein wie junge Spechte. Hierauf folgen sie ihren Eltern etwa vierzehn Tage lang und werden während der Zeit von ihnen gefüttert und geführt. Sobald die Maulbeeren und Feigen reifen, finden sie sich auf den betreffenden Bäumen ein, wie sie früher auf den Kirsch- und andern Fruchtbäumen erschienen, und dann können sie ziemlich bedeutende Verwüstungen anrichten. Im Frühjahr hingegen nähren sie sich fast ausschließlich von Kerbtieren, die sie entweder von Zweigen und Blättern ablesen oder fliegend, und zwar mit großer Behendigkeit, verfolgen. Schon frühzeitig im Jahre treten sie ihre Wanderung an. Sie reisen bei Tage in hoher Luft, meist einzeln, unter laut tönendem Geschrei und mit großer Eile. Erst gegen Sonnenuntergang senken sie sich nach geeigneten Bäumen hernieder, suchen hastig etwas Futter, schlafen, frühstücken und setzen dann ihre Reise fort.
Die Bewegungen sind zierlich und gleichmäßig. Der Flug ist gerade und anhaltend, der Gang auf dem Boden ziemlich geschickt. Seine größte Fertigkeit entfaltete der Vogel im Gezweige der Bäume; hier klettert er mit den Meisen um die Wette.
Seiner Schönheit halber hält man den Baltimorevogel häufig im Käfig. Der Gesang ist zwar einfach, aber äußerst angenehm wegen der Fülle, der Stärke und des Wohllautes der drei oder vier, höchstens acht oder zehn Töne.
*
Die Stare ( Sturnidae) sind mittelgroße, gedrungen gebaute, kurzschwänzige, aber ziemlich langflügelige Vögel mit kopflangem, geradem, schlankem, nach der Spitze zu gleichmäßig verschmächtigtem Schnabel und mittelhohen, ziemlich starken, mit breiten Schildern bekleideten Füßen, ziemlich reichhaltigem, aber hartem, in der Färbung sehr verschiedenem Gefieder. Die Stare sind eine in hohem Grade bezeichnende Vogelgruppe, die in jedem Teil der östlichen Halbkugel auftritt. Wie ihre neuweltlichen Vertreter, die Stärlinge, ungemein gesellige Vögel, vereinigen sie sich nicht allein außer, sondern auch während der Brutzeit zu größeren oder kleineren Gesellschaften, die alle Geschäfte gemeinschaftlich verrichten. Sie gehen schrittweise, etwas wackelnd, aber doch rasch und gut, fliegen leicht, mit behenden Flügelschlägen, rasch und rauschend und bewegen sich auch im Gezweige oder im Röhricht mit viel Geschick. Alle Arten sind lebhafte, unruhige, ununterbrochen beschäftigte Vögel, die nur kurze Zeit ruhen und auch dann noch irgendwelche Tätigkeit vornehmen. Ihre Nahrung besteht aus Kerbtieren, Würmern und Schnecken, nebenbei auch in Früchten und andern Pflanzenteilen; doch werden sie niemals schädlich. Das Nest, ein großer unregelmäßiger Bau, wird in Höhlungen von Bäumen, Felsen, Gemäuern usw. angelegt. Die Anzahl der Eier eines Geleges schwankt zwischen vier und sieben. Alle Arten halten die Gefangenschaft leicht und dauernd aus; einzelne werden in ihr zu den ergötzlichsten Vögeln, die man überhaupt gefangen halten kann.
Unser allbekannter Star, die Sprehe oder Spreu ( Sturnus vulgaris), ist je nach Alter und Jahreszeit verschieden gefärbt und gezeichnet. Das Kleid des alten Männchens ist im Frühling schwarz mit grünem und purpurfarbigem Schiller, welche Färbung auf den Schwingen und dem Schwanze der breiten, grauen Ränder wegen lichter erscheint; einzelne Federn des Rückens zeigen graugelbliche Spitzenflecke. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß rotbraun. Gänzlich verschieden ist die Tracht nach beendeter Mauser. Dann endigen alle Federn des Nackens, Oberrückens und der Brust mit weißlichen Spitzen, und das ganze Gefieder erscheint deshalb gepunktet. Der Schnabel erhält zugleich eine dunklere Färbung. Das Weibchen ähnelt dem Männchen, ist aber auch im Frühlingskleide stärker gefleckt als dieses. Die Jungen sind dunkelbraungrau, in der Gesichtsgegend am lichtesten; ihr Schnabel ist grauschwarz, ihr Fuß bräunlichgrau. Die Länge beträgt zweiundzwanzig, die Breite siebenunddreißig, die Fittichlänge zehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Das Weibchen ist kleiner.
Im Süden Europas vertritt den Star ein ihm sehr nahestehender Verwandter, der Schwarzstar oder Einfarbstar ( Sturnus unicolor). Dieser unterscheidet sich durch eigentümliche Bildung der Kopf-, Brust- und Nackenfedern, die sehr lang und schmal sind, sowie durch die Zeichnung; denn das matt schieferfarbene, schwach metallisch glänzende Gefieder ist fast gänzlich ungefleckt. Der junge Vogel ähnelt seinen Verwandten im Jugendkleide, ist aber immer dunkelbräunlich. Nach Angabe der südeuropäischen Forscher ist der einfarbige Star etwas größer als der unsrige. Er findet sich in Spanien, im südlichen Italien, in der Ukraine, in Kaukasien und einem großen Teil Asiens. Sein Leben stimmt, soviel wir jetzt wissen, im wesentlichen mit dem unseres deutschen Vogels überein.
Von Island und den Färinseln an wird der Star im größten Teil Europas wenigstens zeitweilig gefunden; denn er ist keineswegs überall Standvogel. So erscheint er in allen südlichen Provinzen Spaniens und ebenso in Süditalien und Griechenland nur während der Wintermonate, ist jedoch in den Pyrenäen und in den südlichen Alpen noch Brutvogel. Er bevorzugt ebene Gegenden und in diesen Auwaldungen, läßt sich aber auch in Gauen, die er sonst nur auf dem Zuge berührt, fesseln, sobald man ihm zweckentsprechende Brutkasten herrichtet. Lenz hat ihn im Thüringer Walde heimisch gemacht und binnen wenigen Jahren ein Starenheer von mehreren Hunderttausenden in das Feld gestellt. Unter unseren Zugvögeln erscheint der Star am frühesten und bleibt bis tief in den Spätherbst hinein. Seine Reisen dehnt er höchstens bis Nordafrika aus; in Algerien und Ägypten ist er in jedem Winter als regelmäßiger Gast zu finden. Die Hauptmasse bleibt bereits in Südeuropa wohnen und treibt sich hier während des Winters mit allerhand andern Vögeln, insbesondere Raben und Drosseln, im Lande umher. Wenn er meint, daß die Heimat ihm wieder Nahrung geben könne, macht er sich auf die Reise, und so sieht man ihn bei uns regelmäßig schon vor der Schneeschmelze. Bei den in der Regel milden Wintern Norddeutschlands bleiben nicht selten auch Stare über Winter in ihrer Brutheimat. Herausgeber.
Es gibt vielleicht keinen Vogel, der munterer, heiterer, fröhlicher wäre als der Star. Wenn er bei uns ankommt, ist das Wetter noch recht trübe; Schneeflocken wirbeln vom Himmel herunter, die Nahrung ist knapp, und die Heimat nimmt ihn höchst unfreundlich auf. Dessenungeachtet singt er schon vom ersten Tage an heiter und vergnügt sein Lied in die Welt hinein und setzt sich dazu, wie gewohnt, auf die höchsten Punkte, wo das Wetter ihm von allen Seiten beikommen kann. Wer ihn kennt, muß ihn liebgewinnen, und wer ihn noch nicht kennt, sollte alles tun, ihn an sich zu fesseln. Er wird dem Menschen zu einem lieben Freunde, der jede ihm gewidmete Sorgfalt tausendfach vergilt.
Sofort nach der Ankunft im Frühjahr erscheinen die Männchen auf den höchsten Punkten des Dorfes oder der Stadt, auf dem Kirchturm oder auf alten Bäumen, und singen hier unter lebhaften Bewegungen der Flügel und des Schwanzes. Der Gesang ist nicht viel wert, mehr ein Geschwätz als ein Lied, enthält auch einzelne unangenehme, schnarrende Töne, wird aber mit so viel Lust und Fröhlichkeit vorgetragen, daß man ihn doch recht gern hört. Bedeutendes Nachahmungsvermögen trägt wesentlich dazu bei, die Ergötzlichkeit des Gesanges zu vermehren. Alle Laute, die in einer Gegend hörbar werden: der verschlungene Pfiff des Pirols wie das Kreischen des Hähers, der laute Schrei des Bussards wie das Gackern der Hühner, das Klappern einer Mühle oder das Knarren einer Tür oder Windfahne, der Schlag der Wachtel, das Lullen der Heidelerche, ganze Strophen aus dem Gesange der Schilfsänger, Drosseln, des Blaukehlchens, das Zwitschern der Schwalben und dergleichen: sie alle werden mit geübtem Ohr aufgefaßt, eifrigst gelernt und dann in der lustigsten Weise wiedergegeben. Mit dem ersten Grauen des Tages beginnt der Star zu singen, fährt damit ein paar Stunden fort, läßt sich, nachdem er sich satt gefressen, zeitweilig wieder hören und hält nun, immer mit andern vereinigt, abends noch einen länger währenden Gesangsvortrag.
Anfang März regt sich die Liebe. Das Männchen wendet jetzt alle Liebenswürdigkeit auf, um das Weibchen zu unterhalten, fliegt ihm überallhin nach, jagt sich unter großem Geschrei mit ihm herum und betritt es endlich auf der Erde. Die Bruthöhlung ist mittlerweile, nicht immer ohne Kampf, eingenommen worden und erhält jetzt eine passende Ausfütterung. In Laubwaldungen benutzt der Star Baumhöhlungen aller Art; in Ermangelung dieser natürlichen Brutstellen siedelt er sich in Gebäuden an; am häufigsten aber bezieht er die von den Menschen ihm angefertigten Brutkästchen: ausgehöhlte Stücke Baumschaft von fünfzig bis sechzig Zentimeter Höhe und zwanzig Zentimeter Durchmesser, die oben und unten mit einem Brettchen verschlossen und unsern der Decke mit einer Öffnung von fünf Zentimeter Durchmesser versehen wurden, oder aus Brettern zusammengenagelte Kasten ähnlicher Gestalt, die auf Bäumen aufgehängt, auf Stangen oder an Hausgiebeln befestigt werden. Die Unterlage des liederlichen Nestes besteht aus Stroh und Grashalmen, die innere Auskleidung aus Federn von Gänsen, Hühnern und andern großen Vögeln; im Notfall behilft sich der Star aber auch mit Stroh oder Heu und im Walde mit verschiedenen Flechten allein. Gegen Ende des April findet man hier das erste Gelege, fünf bis sechs längliche, achtundzwanzig Millimeter lange, zwanzig Millimeter dicke, etwas rauhschalige, aber schön glänzende Eier von lichtblauer Farbe, die vom Weibchen allein ausgebrütet werden. Sobald die Jungen dem Ei entschlüpft sind, haben beide Eltern so viel mit Futterzutragen zu tun, daß dem Vater wenig Zeit zum Singen übrigbleibt; ein Stündchen aber weiß er sich dennoch abzustehlen. Deshalb sieht man auch während dieser Zeit gegen Abend die ehrbaren Familienväter zusammenkommen und singend sich unterhalten. Drei bis vier Tage unter Geleit der Eltern genügen den Jungen, sich selbständig zu machen. Sie vereinigen sich dann mit andern Nestlingen und bilden nunmehr schon ziemlich starke Flüge, die ziellos im Lande umherschweifen. Die Eltern schreiten währenddem zur zweiten Brut und suchen, wenn auch diese endlich glücklich ausgekommen, die ersten Jungen in Gesellschaft der zweiten auf. Von nun an schlafen sie nicht mehr an den Brutstellen, sondern entweder in Wäldern oder später im Röhricht der Gewässer. »Meilenweit«, schildert Lenz sehr richtig, »ziehen sie nach solchen Stellen hin und sammeln sich abends, von allen Seiten her truppweise anrückend. Ist endlich zu Ende des August das Schilfrohr und der Rohrkolben in Flüssen, Teichen, Seen hoch und stark genug, so ziehen sie sich nach solchen Stellen hin, verteilen sich bei Tage meilenweit und sammeln sich abends zu Tausenden, ja zu Hunderttausenden an, schwärmen stundenlang, bald vereint, bald geteilt, gleich Wolken umher, lassen sich abwechselnd auf den Wiesen oder auf dem Rohre nieder und begeben sich endlich bei eintretender Nacht schnurrend, zwitschernd, pfeifend, singend, kreischend, zankend zur Ruhe, nachdem ein jeder sein Plätzchen auf einem Halme erwählt und erkämpft und durch seine gewichtige Person den Halm niedergebogen hat. Bricht der Halm unter der Last, so wird mit großem Lärm emporgeflogen und dann wieder mit Lärm ein neuer gewählt. Tritt eine allgemeine Störung durch einen Schuß und dergleichen ein, so erhebt sich die ganze Armee tosend mit Saus und Braus gen Himmel und schwirrt dort wieder eine Zeitlang umher. Kommt das Ende des September heran, so treiben die Scharen ihr geselliges, lustiges Leben weiter so fort; aber die alten Paare gehen jetzt an ihre Nester zurück, singen da morgens und abends, als wäre gar kein Winter vor der Tür, verschwinden aber aus Deutschland und ziehen samt der lieben Jugend nach Süden, sobald die ersten starken Fröste eintreten oder der erste Schnee die Fluren deckt. Ist die Witterung günstig, so bleiben sie bis zur letzten Woche des Oktober oder zur ersten des November; dann geht aber die Reise unaufhaltsam fort.« In der Winterherberge leben sie wie daheim. Ich habe sie im Januar von den Türmen der Domkirche zu Toledo und in Ägypten von dem Rücken der Büffel herab ihr Lied vortragen hören.
Der Star richtet zwar in Weinbergen erheblichen, in Kirschpflanzungen und Gemüsegärten dann und wann nicht unmerklichen Schaden an, nützt aber im übrigen so außerordentlich, daß man ihn als den besten Freund des Landwirts bezeichnen darf. »Bei keinem Vogel«, sagt Lenz, »läßt sich so bequem beobachten, wieviel Nutzen er tut, als bei dem Star. Ist die erste Brut ausgekrochen, so bringen die Alten in der Regel vormittags alle drei Minuten Futter zum Neste, nachmittags alle fünf Minuten, macht jeden Vormittag in sieben Stunden einhundertvierzig fette Schnecken (oder statt deren das Gleichwertige an Heuschrecken, Raupen und dergleichen), nachmittags vierundachtzig. Auf die zwei Alten rechne ich die Stunde wenigstens zusammen zehn Schnecken, macht in vierzehn Stunden hundertvierzig; in Summa werden also von der Familie täglich dreihundertvierundsechzig fette Schnecken verzehrt. Ist dann die Brut ausgeflogen, so verbraucht sie noch mehr; es kommt nun auch die zweite Brut hinzu, und ist auch diese ausgeflogen, so besteht jede Familie aus zwölf Stück, und frißt dann jedes Mitglied in der Stunde fünf Schnecken, so vertilgt die Starenfamilie täglich achthundertvierzig Schnecken. Ich habe in meinen Giebeln, unter den Simsen, an den nahe bei meinen Gebäuden stehenden Bäumen zusammen zweiundvierzig Nistkästen für Stare. Sind diese alle voll, und ich rechne auf jeden jährlich eine Familie von zwölf Stück, so stelle ich allein von meiner Wohnung aus jährlich eine Menge von fünfhundertvier Staren ins Feld, die täglich ein Heer von fünfunddreißigtausendzweihundertachtzig großen, dicken, fetten Schnecken niedermetzelt und verschluckt.« Ich will diese Berechnung weder bestätigen noch bestreiten, aber ausdrücklich erklären, daß ich mit Lenz vollkommen einverstanden bin. Der Weinbergbesitzer ist gewiß berechtigt, die zwischen seine Rebstöcke einfallenden Stare rücksichts- und erbarmungslos zu vertreiben, der Gärtner, der seltene Zier- oder gewinnbringende Nutzpflanzen durch sie gefährdet sieht, nicht minder, sie zu verscheuchen; der Landwirt aber tut sicherlich sehr wohl, wenn er den Star hegt und pflegt und ihm der obigen Angabe genau entsprechende Wohnungen schafft; denn keinen andern nutzbringenden Vogel kann er so leicht ansiedeln und in beliebiger Menge vermehren wie ihn, der glücklicherweise mehr und mehr erkannt und geliebt wird.
Ein nahrungsuchender Star ist eine allerliebste Erscheinung. Geschäftig läuft er auf dem Boden dahin, ruhelos wendet er sich bald nach dieser, bald nach jener Seite, sorgsam durchspäht er jede Vertiefung, jede Ritze, jeden Grasbusch. Dabei wird der Schnabel mit so viel Geschick und in so vielseitiger Weise gebraucht, daß man seine wahre Freude haben muß an dem Künstler, der ein so einfaches Werkzeug so mannigfach zu benutzen weiß. An gefangenen Staren, die einen mit Rasenstücken belegten Gesellschaftsbauer bewohnten, habe ich beobachtet, daß sie Grasbüsche allerorten auf das genaueste durchsuchen, indem sie ihren geschlossenen Schnabel zwischen die dichtstehenden Halme einführen, ihn dann so weit als möglich spreizen und sich so Raum schaffen für die tastende Zunge, die nunmehr verwendet werden kann. In derselben Weise werden auch Ritzen durchstöbert und unter Umständen vergrößert. Was dem Auge entgeht, spürt die Zunge aus, was heute nicht gefunden wurde, deckt morgen den Tisch.
Unsere größeren Falkenarten, namentlich Habichte und Sperber, ebenso Krähen, Elstern und Häher, auch Edelmarder, Wiesel, Eichhorn und Siebenschläfer, sind schlimme Feinde der Stare. Erstere gefährden die Alten oder Flugbaren, letztere die noch unbehilflichen Jungen, die sie aus den Nesthöhlen hervorziehen, so mutvoll die Alten sie auch verteidigen. Doch gleicht die starke Vermehrung des Vogels alle etwa erlittenen Verluste bald wieder aus, und auch seine Klugheit mindert die Gefahren. So hält er sich z. B., wenn er im Felde Nahrung sucht, in Gesellschaft von Krähen und Dohlen auf, macht sich deren Wachsamkeit baldmöglichst zunutze und entflieht bei Ankunft eines Raubtiers, namentlich eines Raubvogels, während dieser von den mutigen Krähen angegriffen wird. Vor den Nachstellungen des Menschen sichert ihn glücklicherweise seine Liebenswürdigkeit und mehr noch sein wenig angenehmes, ja kaum genießbares Fleisch. In Gefangenschaft hält man ihn seltener als er verdient. Er ist anspruchslos wie wenige andere Vögel, sehr klug, äußerst gelehrig, heiter, lustig, zu Spiel und Neckerei geneigt, lernt Lieder nachpfeifen und Worte nachsprechen, schließt sich seinem Pfleger innig an, dauert fast ein Menschenalter im Käfig aus und vereinigt so viele treffliche Eigenschaften wie kaum ein anderer Stubenvogel ähnlichen Schlages.
*
Der nächste Verwandte der Stare, der Europa bewohnt, ist der Rosenstar ( Pastor roseus), Vertreter der Sippe der Hirtenstare ( Pastor), die in Südasien zahlreich vertreten ist. Das Gefieder ist auf dem Kopfe, woselbst es einen langen, hängenden Nackenschopf bildet, und dem Halse, vorderseits bis zur Brust, hinterseits bis zum Anfange des Mantels herab, schwarz, tief violett metallisch schimmernd, auf Flügeln, Schwanz, unteren und oberen Schwanzdecken nebst den Unterschenkeln schwarz, stahlgrün scheinend, übrigens blaß rosenrot, der Schnabel rosenrot, unten mit scharf abgesetzter Wurzelhälfte, der Fuß rötlichbraun. Beim Weibchen sind alle Farben matter wie auch die rosenroten Teile bräunlichweiß verwaschen, die unteren Deckfedern breit weißlich gerandet. Die jungen Vögel sind graulichrostfahl, unterseits heller, auf Kinn, Kehle und Bauch weißlich, ihre Schwingen und Deckfedern dunkelbraun, außen rostbräunlich gesäumt; der Schnabel ist gelblichbraun, an der Spitze dunkel. Die Länge beträgt einundzwanzig bis dreiundzwanzig, die Breite neununddreißig bis zweiundvierzig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.
Der Rosenstar gehört zu den Zigeunervögeln, weil auch er in manchen Jahren in gewissen Gegenden massenhaft auftritt, in andern wiederum hier gänzlich fehlt, obgleich dem Anschein nach alle Bedingungen wesentlich dieselben geblieben sind. Als Brennpunkt seines Verbreitungsgebietes haben wir die innerasiatischen Steppen anzusehen; von ihnen aus erweitert sich der regelmäßige Wohnkreis einerseits bis Südrußland und die Donautiefländer, anderseits bis Kleinasien, Syrien, nach Osten endlich bis in die Mongolei und China. Seine Brutstätten verlassend, wandert der Vogel allwinterlich nach Indien, ohne jedoch von Mesopotamien aus durch Persien seinen Weg zu nehmen, besucht auch, jedoch nicht alljährlich, Griechenland und Italien, Afrika dagegen nur äußerst selten. Nun aber geschieht es, daß er zuweilen, und zwar gewöhnlich im Sommer um die Brutzeit, sein Verbreitungsgebiet weit überschreitet und nicht allein in der Richtung seiner Zugstraßen, sondern strahlenförmig nach verschiedenen Seiten hin weiterzieht. Bei dieser Gelegenheit erscheint er in allen Teilen Italiens und Griechenlands, überhaupt auf der ganzen Balkanhalbinsel, in den Donautiefländern und in Ungarn, auch wohl in allen übrigen Kronländern Österreichs, ebenso in Deutschland, der Schweiz, in Frankreich, Holland, Belgien, Dänemark, Großbritannien, ja selbst auf den Färinseln. Stölker hat sich die Mühe nicht verdrießen lassen, sein zeitweiliges Vorkommen in der Schweiz und Deutschland zusammenzustellen, und als Ergebnis gewonnen, daß unser Zigeunervogel binnen hundert Jahren, vom Jahre 1774 bis 1875, erwiesenermaßen sechzehnmal in der Schweiz und siebenunddreißigmal in Deutschland vorgekommen ist. Ein besonders zahlreicher Schwarm durchflog im Jahre 1875 halb Europa, überschwemmte fast alle Kronländer Österreichs und ebenso die meisten Länder und Provinzen Deutschlands, obgleich er hier nicht allerorten beobachtet wurde, erschien endlich in zahlreicher Menge in Italien, hauptsächlich in der Provinz Verona, siedelte sich daselbst fest an, brütete und verschwand spurlos wieder. Da, wo der Vogel regelmäßiger auftritt, wie beispielsweise in Südrußland, Kleinasien, Syrien, kommt er aus seiner Winterherberge in der ersten Hälfte des Mai an, verweilt am Brutplatze aber nur bis zum Anfang des August, verschwindet und zieht nun langsam der Winterherberge zu, in der er gegen Ende des September oder Oktober einzutreffen und bis zum März zu verweilen pflegt.
Da ich auf meiner letzten Reise nach Sibirien und Turkestan in den Steppen der letztgenannten Provinz den Rosenstar wiederholt, an einzelnen Stellen auch in namhafter Menge, gesehen habe, vermag ich aus eigener Anschauung über sein Auftreten in der Heimat zu sprechen. Wer den Vogel genau beobachtet, wird ihn liebgewinnen; denn er ist voll Leben und in jeder seiner Bewegungen wie in seinem ganzen Wesen anmutig. Sein Betragen erinnert allerdings in vieler Beziehung an das Gebaren unseres deutschen Stars, weicht jedoch in andrer Hinsicht wesentlich davon ab. Wie der Star läuft er nickend auf dem Boden einher, alles durchspähend, alles untersuchend, fliegt ebenso, wie unser Haus- und Gartenfreund, nach kurzem Laufen auf und über die vor ihm nach Nahrung suchenden Schwarmgenossen hinweg, um vor ihnen wieder einzufallen, und bringt dadurch selbst in den auf dem Boden laufenden Trupp mehr Leben. Er fliegt auch ganz ähnlich wie der Star, nur daß seine Schwärme in der Luft nicht so dicht geschlossen sind und der Flug nicht so stürmisch dahinwogt. Mehr als durch seine Bewegung unterscheidet er sich aber durch sein Wesen überhaupt. Er ist viel unruhiger als unser Star, durchschwärmt täglich ein sehr weites Gebiet, erscheint im Laufe des Tages zu wiederholten Malen auf denselben Plätzen, hält sich hier aber immer nur kurze Zeit auf, durchsucht in der geschilderten Weise eine Strecke, erhebt sich und fliegt weiter, um vielleicht erst in einer Entfernung von mehreren Kilometern dasselbe Spiel zu beginnen. Von Zeit zu Zeit, zumal in den Nachmittagsstunden, schwärmt der ganze Flug ein Viertelstündchen und länger in hoher Luft umher, nach Art der Bienenfresser Kerbtiere fangend; hierauf läßt er sich wieder auf den Boden nieder und sucht so eifrig, als ob er in der Höhe nicht das geringste gefunden. Von der eigentümlichen Pracht seines Gefieders bemerkt man im Fluge wenig; das Rosenrot, das sich vom Boden leuchtend abhebt, verbleicht im Fluge zu lichteren Tönen, die man eher schmutzig fahlweiß als rosenrot nennen möchte. Gegen Abend sammeln sich wahrscheinlich mehrere Flüge; denn man sieht sie dann in dichtem Gewimmel, zu vielen Hunderten vereinigt, auf bestimmten Plätzen umherfliegen oder auf hervorragenden Punkten in der Steppe, meist Felsengraten, so dichtgedrängt nebeneinandersitzen, daß ein Schuß von uns nicht weniger als fünfundzwanzig von ihnen in unsere Gewalt brachte. Kurze Zeit später fliegen sie ihren Schlafplätzen zu, in der Steppe Weidendickichten, mit denen sie, in Ermangelung höherer Baumkronen, sich begnügen müssen. Zu solchen Schlafplätzen strömen sie um Sonnenuntergang gleichzeitig mit Rötel- und Rotfußfalken von allen Seiten herbei; während die Falken aber vor dem Aufbäumen noch längere Zeit im spielenden Fluge sich gefallen, verschwinden die herankommenden Rosenstare ohne Zaudern zwischen dem Grün der Weiden. Kein lautes Geschrei wie von unseren Staren, kein längeres Geschwätz wird nach dem Einfallen vernommen; still und geräuschlos, wie sie angeflogen kamen, gehen sie auch zur Ruhe, und ob sie sich gleich zu Tausenden ihrer Art gesellen sollten. In dieser Schweigsamkeit finde ich einen erheblichen Unterschied zwischen ihnen und den so nah verwandten Staren, und ebenso glaube ich das Geräuschlose des Fluges besonders hervorheben zu müssen, weil es mit jener Schweigsamkeit vollständig im Einklänge steht. Dem eben Gesagten entspricht, daß man den Lockton, ein sanftes »Swit« oder »Hurbi«, nur selten vernimmt, ebenso, daß sie im Singen viel weniger eifrig sind als unsere Stare. Ihr Gesang, den ich namentlich von den von mir gepflegten Käfigvögeln oft gehört habe, ist nichts anderes als ein ziemlich rauhes Geschwätz, in dem die erwähnten Locktöne noch die wohllautendsten, alle übrigen aber knarrend und kreischend sind, so daß das Ganze kaum anders klingt als »Etsch, retsch, ritsch, ritz, scherr, zirr, zwie, schirr, kirr« usw., wobei »Ritsch« und »Schirr« am häufigsten erklingen.
Kerbtiere allerlei Art, insbesondere große Heuschrecken und Käfer, außerdem Beeren und Früchte, bilden die Nahrung der Rosenstare. Als Vertilger der mit Recht gefürchteten Wanderheuschrecke erweisen sie sich so nützlich, daß Tataren und Armenier bei ihrem Erscheinen noch heutigen Tages Bittgänge veranstalten, weil sie die Vögel als Vorläufer bald nachrückender Heuschreckenschwärme ansehen. Nach Ansicht der Türken tötet jeder Rosenstar erst neunundneunzig Heuschrecken, bevor er eine einzige verzehrt, was tatsächlich wohl nichts anderes heißen mag, als daß der Vogel mehr umbringt, als er frißt. Leider läßt er es hierbei nicht bewenden, sondern fällt, sobald seine Jungen groß geworden sind, verheerend in Obstgärten, insbesondere in Maulbeerpflanzungen und Weinbergen, ein und wird deshalb bei Smyrna im Mai »Heiliger«, im Juli dagegen »Teufelsvogel« genannt. Auch in seiner Winterherberge verfährt er nicht anders als in der Heimat. Während er hier wie dort den Herden, deren Nähe er stets aufsucht, insofern dient, als er den Tieren die lästigen Schmarotzer abliest, richtet er in den Reisfeldern Indiens oft so arge Verwüstungen an, daß man genötigt ist, seinetwegen Schutzwachen aufzustellen.
Bei der Wahl des Brutgebietes ist Vorhandensein von Wasser eine der ersten Bedingungen; in der Steppe findet man daher um die Brutzeit Rosenstare so gut als ausschließlich in der Nähe von Flüssen, Bächen oder Seen. Gesellig wie immer, scharen sich an den Brutplätzen meist ungeheuere Schwärme, Tausende und Abertausende, so daß es bald ebensowohl an passenden Nistgelegenheiten wie an Schlafplätzen mangelt. Selbstgegrabene Höhlungen, allerlei Spalten und Löcher im Felsgeklüfte oder Gemäuer, ebenso, obschon seltener, Baumhöhlen dienen zur Brutstätte. Da aber die passenden Plätze bald besetzt sind, werden auch Holzstöße, Steine oder Reisig benutzt und viele Nester irgendsonstwo, gleichviel, ob an einer geschützten oder ungeschützten, überdachten oder oben offenen Stelle angelegt. Ein Nest steht dicht neben dem andern; keines aber ist mit irgendwelcher Sorgfalt hergerichtet; und da außerdem allerlei Raubtiere Brutplätze oft besuchen und das wirre Genist noch mehr auseinanderreißen, um zu den Eiern oder Jungen zu gelangen, sieht solcher Brutplatz wüster aus als irgendeine andere Nistansiedlung der Vögel. Von den Hunderttausenden, die im Jahr 1875 Süd- und Westeuropa überschwemmten, wurden diejenigen, die sich um Villafranca ansiedelten, durch Betta trefflich beobachtet. Ihm danken wir ein sehr lebhaftes Bild des Betragens am Brutplatz. Es war am 3. Juni, als etwa zwölf- bis vierzehntausend der fremden Gäste anlangten, um sofort von den Mauern der Veste Besitz zu ergreifen und die dort brütenden Stare, Schwalben, Sperlinge und Tauben zu vertreiben. Diejenigen, die keinen Platz mehr fanden, besetzten die Dächer der angrenzenden Häuser und verdrängten auch hier deren regelmäßige Nistgäste. Doch brüteten in einzelnen Gebäuden Stare und Rosenstare einträchtig neben- und untereinander. Jene, die im Umkreis der Veste verblieben, begannen sofort mit der Reinigung aller in den Mauern befindlichen Löcher und Spalten, beseitigten jedes Hindernis, indem sie Steine, auch solche von größerem Gewicht, Scherben, Holzwerk, Stroh, Schädel und andere von hier verendeten oder umgebrachten Tieren herrührende Gerippteile herabwarfen und nunmehr aus Reisern und Stroh, Heu, Gras usw. ihre Nester erbauten. Am 17. Juni waren die aus fünf bis sechs weißgrünlichen, etwa achtundzwanzig Millimeter langen, zweiundzwanzig Millimeter dicken Eiern bestehenden Gelege vollständig, am 14. Juli aber die Jungen bereits flügge. Während der Brutzeit waren auch die Männchen außerordentlich geschäftig, sangen oder schwatzten vom frühesten Morgen an und flogen beständig ab und zu. Unter den erheiterndsten Stellungen und wechselseitigem Heben und Senken der Federhaube, fortwährend streitend und hadernd, versetzte eines dem andern ernstlich gemeinte Hiebe mit dem Schnabel. Für die Weibchen, die das Nest nicht verließen, zeigten die Männchen warme Zuneigung, fütterten sie mit großer Sorgfalt und verteidigten sie auf das beste. Gegen Abend verließen fast alle Männchen die Niststelle und begaben sich nach den einige Kilometer von Villafranca entfernten Umgebungen von Custoza und Santa Lucia dei Monti, um dort auf den hohen Bäumen zu übernachten. Die Jungen wurden von beiden Eltern reichlich mit Nahrung, größtenteils Heuschrecken, versorgt, und es war äußerst fesselnd zu sehen, wie die außerordentliche Menge von Rosenstaren in Flügen von zehn, zwanzig bis vierzig zu diesem Zweck sich auf die näher und weiter gelegenen Felder begab, um vereint mit gewonnener Beute zu den Jungen zurückzukehren. Am 12. Juli in der Frühe wurde ein allgemeiner Ausflug aufs Land unternommen, und abends kehrten nur einige Alte zurück. Am 13. nachmittags sah man die Rosenstare in großer Anzahl auf den im Garten der Festung befindlichen Obstbäumen versammelt, und am 14. fand die allgemeine Abreise statt.
*
Die zweite Unterfamilie begreift die Glanzstare oder Glanzdrosseln ( Lamprotornithinae) in sich, gedrungen gebaute Vögel mit prachtvoll glänzendem Gefieder. Die Glanzstare bewohnen Afrika, Südasien und Australien, besonders zahlreich den erstgenannten Erdteil, beleben die verschiedensten Örtlichkeiten, sind höchst gesellig, lebhaft, munter, dreist und geschwätzig, nähren sich ebenso von pflanzlichen wie von tierischen Stoffen, gehen rasch, mehr schreitend als hüpfend, fliegen leicht, gewandt, wenn auch etwas schleppend, singen eifrig aber schlecht, brüten in Höhlungen oder großen, liederlich zusammengetragenen Kuppelnestern und legen fünf bis sechs gefleckte Eier.
Wohl die bekannteste Art der Sippe der Schweifglanzstare (Lamprotornis), der größten Glieder der Unterfamilie, ist der Erzglanzstar ( Lamprotornis aeneus). Die Länge beträgt fünfzig, die Fittichlänge neunzehn, die Schwanzlänge dreißig Zentimeter. Kopf, Kinn und Oberkehle sind schwarz, goldig schimmernd, Oberteile und Schwingen dunkel metallischgrün, die Oberflügeldeckfedern durch einen kleinen, matt sammetschwarzen Fleck geziert, Kehlmitte, Bürzel, Oberschwanzdecken, Unterteile und die Steuerfedern dunkel purpurviolett, das ganze Gefieder überhaupt herrlich glänzend. Das Auge ist hellgelb; der Schnabel und die Füße sind schwarz.
West-, Mittel-, Ost- und Südafrika sind das Vaterland dieses Prachtvogels. Ich habe in meinen Tagebüchern wenig über ihn niedergeschrieben, weil ich glaubte, daß er hinlänglich bekannt wäre. Soviel mir erinnerlich, haben wir ihn nur in den Urwaldungen getroffen, und zwar höchstens in kleinen Familien. Die Paare oder die Trupps leben viel auf dem Boden und bewegen sich hier ganz nach Art unserer Elstern; die Ähnlichkeit wird namentlich dadurch eine auffallende, daß der Erzglanzstar seinen prächtigen Schwanz ganz wie die Elster nach oben gestelzt trägt. Fremdartigen Erscheinungen gegenüber zeigt sich der schöne Vogel höchst mißtrauisch, ist auch da scheu, wo er den Menschen nur von seiner guten Seite kennengelernt hat. Doch naht er sich zuweilen den Ortschaften; ich erinnere mich, ihn manchmal unmittelbar neben den letzten Strohhütten einzelner Walddörfer gesehen zu haben. Seine Bewegungen sind leicht und zierlich, einigermaßen schleppend, jedoch keineswegs unkräftig. Der lange Schweif wird in der beschriebenen Weise getragen, wenn der Vogel auf dem Boden umherhüpft, senkrecht herabfallend dagegen, wenn er, im Gezweige sitzend, tieferer Ruhe sich hingibt. Die Stimme ist rauh und kreischend, dabei aber so eigentümlich, daß man sie schwerlich mit einer andern uns bekannten verwechseln kann; der Gesang, den man außer der Mauserzeit bis zum Überdruß vernimmt, ist nichts anderes als eine unendliche Wiederholung und Vertonung der gewöhnlichen Stimmlaute oder ein Kreischen, Krächzen, Knarren und Quietschen ohne Ende. Unsere Elster vermag, wenn sie plaudert, einen Begriff des Liedes eines Erzglanzstares zu geben, verfügt aber über einen bei weitem größeren Tonschatz als letzterer.
Obwohl ich während meines Aufenthaltes in Afrika niemals ein Nest des Erz- oder eines andern Schweifglanzstares gefunden habe, glaube ich doch nicht fehlzugehen, wenn ich auch ihn zu den Höhlenbrütern zähle und annehme, daß die freistehenden Nester, von denen Verreaux und Heuglin berichten, nur Notbehelfe sind. Die Brutzeit fällt in Nordostafrika in den August, hier wie im übrigen Verbreitungsgebiete in die Regenzeit, die den Frühling in das Land bringt. Während die Fortpflanzung ihn beschäftigt, ist der Erzglanzstar lebhafter als je, schwatzt, krächzt, pfeift und kreischt vom frühen Morgen bis zum späten Abend, nur in den Mittagsstunden kurze Ruhe sich gönnend, und beginnt mit andern Männchen seiner Art, nicht minder auch mit verschiedenen andersartigen Vögeln, Zank und Streit. Wahrscheinlich hilft das Männchen dem Weibchen die Eier zu zeitigen, sicherlich, die Jungen aufzufüttern. Letztere sieht man, laut Heuglin, nach dem Ausfliegen dichtgedrängt auf einem Zweige sitzen, während die Eltern, Nahrung suchend, emsig von Ast zu Ast fliegen oder auf dem Boden umherlaufen, auch wohl mit ihresgleichen und andern Vögeln hadern.
Die Nahrung besteht in Kerbtieren, Sämereien und Früchten aller Art. Erstere werden vom Boden abgelesen und im Fluge gefangen, selbst aus einem Aas hervorgezogen, letztere gesammelt und gepflückt, wo immer möglich.
Dank der Leichtigkeit, gefangene Glanzstare zu ernähren, erhalten wir auch den Erzglanzstar nicht selten lebend. Bei guter Pflege dauert er viele Jahre im Käfig aus, schreitet wohl auch zur Fortpflanzung.
*
Glanzstare im engeren Sinne ( Lamprocolius) heißen die kurzschwänzigen Arten der Unterfamilie. In Nordostafrika lebt ziemlich häufig der Stahlglanzstar, »Wordit« der Abessinier ( Lamprocolius chalybaeus). Seine Länge beträgt siebenundzwanzig, die Breite sechsundvierzig, die Fittichlänge vierzehn, die Schwanzlänge neun Zentimeter. Das Gefieder ist, mit Ausnahme eines schwach angedeuteten Fleckes in der Ohrgegend und der Deckfedern des Unterarmes, tief und dunkel stahlgrün, jede der Arm- und größten Oberflügeldeckfedern am Ende durch einen rundlichen sammetschwarzen Fleck geziert. Die Färbung zeigt einen wundervollen Glanz und Schimmer und schillert in verschiedener Beleuchtung in einer mit Worten kaum auszudrückenden Weise. Zwischen Männchen und Weibchen bemerkt man keinen Unterschied; die Jungen aber sind nur auf der Oberseite metallisch grün und auf der unteren dunkel bräunlichgrau, fast glanzlos.
Der Glanzstar bewohnt die dichten Waldungen der Flußtäler wie die dünner bestandenen der Steppe oder des Gebirges von ganz Nordostafrika, kommt aber auch in Senegambien vor. Im abessinischen Hochland steigt er, laut Heuglin, bis zu dreitausend Meter unbedingter Höhe empor. Er lebt gewöhnlich paarweise; nur nach der Brutzeit bildet er kleine Flüge. Diese treiben sich ebensowohl im dichtesten Gebüsche wie auf den über die Ebene zerstreuten Felsblöcken herum. Die Stahlglanzstare sind munter und regsam, wie alle ihre Familienverwandten, halten sich viel auf dem Boden und in niederen Gebüschen, gegen Abend aber auch in höheren Bäumen auf. Der eigentümliche Flug macht sie dem geübten Auge in jeder Entfernung kenntlich. Er entspricht so recht den sammetnen Flügeln, ist weich wie diese, zwar ziemlich leicht, aber nicht schnell, eher schleppend. Der Lauf ist sehr rasch, mehr sprung- als schrittweise, fördernd und rastlos. Über andere Begabungen läßt sich nicht viel Rühmenswertes sagen. Der Gesang ist kaum als solcher zu bezeichnen, weil nicht viel mehr als eine beständige Wiederholung des mißtönenden und kreischenden Locktones und dazwischen eingefügtes Knarren und Krächzen. Gleichwohl verzeiht man dem Vogel alle Mißklänge, die er mit unvergleichlicher Ausdauer vernehmen läßt. Sein Wesen steht mit seinem prachtvollen Gefieder im Einklang. Er hält sich stets sorgfältig rein, mischt sich nicht unter andere Vögel, nicht einmal gern unter seine Sippschaftsgenossen und ist, mit alleiniger Ausnahme der Mittagsstunden, ununterbrochen in Tätigkeit. So erwirbt er sich auch dann noch die Teilnahme, wenn man von der Pracht des Gefieders absieht; diese Pracht aber ist so groß, daß man immer von neuem wieder zur Bewunderung hingerissen wird. Wenn man durch das Düster des Waldes geht, geschieht es wohl manchmal, daß plötzlich ein heller Schimmer in die Augen fällt, vergleichbar einem Sonnenstrahl, der von einer spiegelnden Metall- oder Glasfläche zurückgeworfen wird. Der Schimmer ist wirklich nichts anderes als der vom Gefieder abprallende Sonnenschein; denn wenn man den Glanzstar aufgefunden hat, kann man gewahren, daß er bei günstiger Beleuchtung mit jeder Bewegung einen Sonnenstrahl zurückspiegelt. Gleich nach dem Tode verliert das Gefieder den größten Teil seiner Schönheit; seine volle Pracht zeigt es nur, solange der Vogel lebt, solange er sich in der glühenden afrikanischen Sonne bewegt.
Nach Heuglin fällt die Brutzeit in die Monate Juli bis September. Als Brutplätze werden meist Affenbrotbäume, Christusdornen und Akazien gewählt. Oft stehen sechs bis acht Nester auf einem und demselben Baum, je nach Umständen drei bis zehn Meter über dem Boden. Grobe, dürre, schwarze Reiser, unordentlich zusammengeschichtet, bilden den sehr umfangreichen Außenbau, Gras, Federn, Wolle und dergleichen die saubere Auskleidung der kleinen, tief im Inneren gelegenen Brutkammer. Die drei Eier sind etwa sechsundzwanzig Millimeter lang und auf heller oder dunkler bläulichgrünem Grund mit einzelnen blaugrauen und violettbraunen Punkten und Flecken gezeichnet. Nach langjährigen Beobachtungen an gefangenen Glanzstaren muß ich bemerken, daß vorstehende Beschreibung nicht erschöpfend ist. Wahrscheinlich erbaut sich auch der Stahlglanzstar nur im Notfalle freistehende Nester, nistet vielmehr, ebenso wie andere seiner Sippe, regelmäßig in Baumhöhlungen, deren Inneres, er in der geschilderten Weise auskleidet. Die Eier werden, wie es scheint, von beiden Eltern bebrütet, die Jungen vom Männchen wie vom Weibchen großgefüttert. Sie entfliegen dem Nest in einem fast glanzlosen Federkleide, erhalten jedoch die volle Pracht und allen Glanz des Alterskleides binnen wenigen Wochen, und zwar durch Verfärbung, nicht durch Mauser.
Bei den abessinischen Sängern und Dichtern spielt der Stahlglanzstar eine bedeutsame Rolle; denn ihm schreibt man, mehr den Eifer als die Schönheit des Liedes würdigend, die Erfindung des Gesanges zu. Gleichwohl hält den Vogel in Nordostafrika niemand im Käfig. Er gelangt auch seltener als seine Verwandten lebend zu uns; doch habe ich ihn einige Male gepflegt und gefunden, daß er sich kaum von letzterwähnten unterscheidet. Wie dieser dauert er bei guter Pflege trefflich aus, schreitet auch, wenn man seine Lebensbedingungen erfüllt, zur Fortpflanzung.
*
Die Hirtenglanzstare ( Notauges) unterscheiden sich von den vorstehend beschriebenen Arten nur durch etwas schlankeren Schnabel, höhere Beine, kürzeren Schwanz und buntes Gefieder. Der Prachtglanzstar ( Notauges superbus) erreicht eine Länge von einundzwanzig und eine Breite von etwa siebenunddreißig Zentimeter; die Fittichlänge beträgt einhundertundsechzehn, die Schwanzlänge fünfundsechzig Millimeter. Oberkopf und Nacken sind schwarz, schwach goldig schimmernd, die Oberteile stahlgrün, Kehle, Vorderhals und Kropf blaugrün, die übrigen, durch ein schmales, weißes Querband von der dunklen Oberbrust getrennten Unterteile schön zimmetbraun, die Unterflügel und Schwanzdecken wie üblich mit runden sammetartigen Flecken geziert, die zwei Querbinden bilden. Das Auge ist weiß, der Schnabel und der Fuß sind schwarz.
Das Verbreitungsgebiet dieses prachtvollen Vogels beschränkt sich, soviel bekannt, in Ostafrika vom achten Grad nördlicher bis zum siebenten Grad südlicher Breite. Über seine Lebensweise fehlen eingehende Beobachtungen; doch läßt sich aus den bekannt gewordenen schließen, das dieselbe der eines weiter nördlich vorkommenden Verwandten, des Erzbauchglanzstares ( Notauges chrysogaster), im wesentlichen gleicht. Beide Arten sind Hirtenvögel, die, falls immer möglich, den Rinder- und Schafherden folgen oder mindestens da, wo jene geweidet haben, sich umhertreiben. Ein Flug dieser Vögel durchstreift nach meinen Beobachtungen während des Tages ein ziemlich weites Gebiet, bald auf verschiedenen Bäumen sich sammelnd, bald wieder laufend sich zerstreuend. In den Früh- und Abendstunden setzt sich die ganze Schar auf einen der höheren Bäume nieder, und die Männchen singen nach Starenart von dort herab ihr Morgen- oder Abendlied. Während des Mittags verbergen sie sich still im Gezweig der Bäume, in den übrigen Stunden des Tages schweifen sie rastlos umher. Ihr Gang ist der unserer Drossel, und dieser ähneln sie auch darin, daß sie bei Verfolgung immer auf kleine Strecken dahinfliegen, in einem Busch sich bergen, hier den Verfolger abwarten und wieder davoneilen, wenn derselbe naht. Solange sie Nahrung suchen, ist die ganze Gesellschaft nicht einen Augenblick lang ruhig. Alles lärmt und schreit durcheinander, und auch während des Fliegens noch schreien sämtliche Glieder eines Fluges, und nicht eben in der ansprechendsten Weise, laut auf. Ihre Regsamkeit läßt sie bald bemerklich werden; sie wissen sich jedoch mit Vorsicht dem Schützen geschickt zu entziehen und werden, wenn sie sich verfolgt sehen, bald sehr scheu. Die Nahrung der Hirtenglanzstare ist zwar im wesentlichen dieselbe wie bei andern Arten der Unterfamilie, aber doch insofern verschieden, als beide vorzugsweise Kerbtieren nachjagen, die durch die Herden herbeigelockt werden.
Über die Fortpflanzungsgeschichte des Prachtglanzstares mangeln zurzeit noch Berichte; die Nester des Erzbauchglanzstares dagegen fand Heuglin in der Steppe und beschreibt sie ganz ebenso wie jene des Stahlglanzstares. Im September und Oktober findet man in ihnen drei oder vier fünfundzwanzig Millimeter lange, achtzehn Millimeter dicke, feinschalige, auf grünlichblauem oder spangrünem Grunde mit zahlreichen, gegen das stumpfe Ende hin dichter stehenden graublaulichen, violettbraunen und rostbraunen Flecken gezeichnete Eier.
*
Durch ein schuppiges Gefieder unterscheidet sich der Schuppenglanzstar ( Pholidauges leucogaster), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Pholidauges), von seinen Verwandten. Die ganze Oberseite und der Hals bis zur Brust herab sind purpurblau, wundervoll ins Violette schimmernd, Brust und Bauch hingegen weiß, die Schwingen schwärzlichbraun, nach außen hin violett gerandet. Alle dunklen Stellen des Gefieders schillern bei gewisser Beleuchtung in kupferfarbigem Metallglanze. Die Farbe der Iris ist lebhaft braun, der Schnabel und der Fuß sind schwarz. Die jungen Vögel sind auf der Oberseite heller und dunkler braun gebändert, auf der Unterseite auf rötlichweißem Grund braun gestrichelt. Die Länge des Männchens beträgt neunzehn, die Breite dreiunddreißig, die Fittichlänge elf, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.
Der Schuppenglanzstar verbreitet sich über ganz Mittelafrika und einen Teil Westarabiens, bewohnt vorzugsweise gebirgige Gegenden und findet sich in Habesch noch bis zu dritthalbtausend Meter unbedingter Höhe, hier und da vielleicht noch höher. Ich habe ihn erst auf meiner zweiten afrikanischen Reise in den dünnbestandenen Wäldern, die die Gehänge und den Fuß des nordöstlichen Gebirgswalles von Habesch bedecken, kennengelernt. Hier lebt der überaus prachtvolle Vogel in zahlreichen Familien, und zwar in der Tiefebene so gut wie in der Höhe, scheint sich jedoch vom Gebirge selbst nicht weit zu entfernen. Es ist ein echter Baumvogel, der nur selten auf den Boden herabkommt und hier immer äußerst kurze Zeit verweilt. In den Nachmittagsstunden sammelt auch er sich, wie unser Star, auf gewissen Lieblingsbäumen; aber er singt hier nicht, wie er überhaupt ein ziemlich stiller Gesell genannt werden muß. Man hört minutenlang nicht einen einzigen Ton von ihm. Die Familien bestehen aus sechs bis zwanzig Stück.
Selbst in dem an schön gefiederten Vögeln so reichen Abessinien fällt der Schuppenglanzstar wegen der Pracht seiner Färbung auf. Namentlich wenn er fliegt, spielt das Sonnenlicht in wunderbarer Weise mit dem herrlichen Blau seines Rückens. Wenn man den Vogel zum ersten Male und fliegend sieht, ist man nicht imstande, seine eigentliche Färbung zu erkennen. Die Oberseite erscheint kupferrot, mit einem schwachen Schein ins Veilchenfarbene, nicht aber blau, wie sie doch wirklich ist. Nur zuweilen und bloß auf Augenblicke sieht man, daß dies auf Sinnestäuschung beruht; aber man ist dann geneigt, gerade die blaue Farbe als die durch besondere Beleuchtung hervorgebrachte und sozusagen uneigentliche anzusehen. Man staunt, wenn man den Vogel herabgeschossen hat und ihn in der Hand hält; er erscheint dann so ganz anders als früher.
Der Flug ist sehr leicht und zierlich, dabei äußerst rasch und behend, der Lauf ein drosselartiges Hüpfen, wie denn überhaupt der Vogel mich vielfach an unsere Rotdrossel erinnert hat. Aber er sucht sich mehr die Höhe als die Tiefe auf und fliegt, aufgeschreckt, immer zunächst den höchsten Bäumen zu, nicht, gleich den Drosseln, im Gebüsch fort. Wie es scheint, bevorzugt er die dem Wasser nahe gelegenen Bäume allen übrigen. An dem einmal gewählten Standort hält er sehr fest; bei Mensa zum Beispiel sahen wir ihn bei jeder Jagd so ziemlich auf denselben Bäumen über dem Wasser. Zur Zeit unsers Aufenthaltes waren die Jungen bereits vermausert und die Alten im Hochzeitskleid; doch fand ich, aller Bemühungen ungeachtet, kein Nest und vermochte auch nichts Sicheres über das Fortpflanzungsgeschäft zu erfahren. Heuglin dagegen berichtet, daß er im Juli halbflügge Junge beobachtet habe. Über das Nest scheint auch ihm nichts bekannt geworden zu sein.
*
Vielleicht ist es richtig, hier eine kleine australische Vogelgruppe einzureihen, die bald zu den Pirolen, bald zu den Paradiesvögeln gestellt, bald endlich als Kern einer besonderen Familie aufgefaßt worden ist. Die Laubenvögel ( Tectonarchinae), die ich meine, nur in Australien heimische Vögel, erreichen ungefähr die Größe unserer Dohle und kennzeichnen sich durch dicken, wenig hakigen Schnabel, mittelhohe, starke Füße, ziemlich lange Flügel und mittellangen, gerade abgeschnittenen oder seicht ausgebuchteten Schwanz.
Die bekannteste Art der Unterfamilie ist der Laubenvogel ( Ptilonorhynchus holosericeus), Vertreter einer nur aus ihm selbst bestehenden Sippe. Das wie Atlas glänzende Gefieder des alten Männchens ist tief blauschwarz; die Vorder- und Armschwingen, Flügeldeck- und Steuerfedern sind sammetschwarz, an der Spitze blau. Das Auge ist hellblau bis auf einen schmalen roten Ring, der den Stern umgibt, der Schnabel lichtbläulich hornfarben, an der Spitze gelb, der Fuß rötlich. Das Weibchen ist auf der Oberseite grün, an den Flügeln und auf dem Schwanz dunkel gelbbraun, auf der Unterseite gelblichgrün, jede Feder hier mit dunkelbraunen Mondflecken nahe der Spitze, wodurch eine schuppige Zeichnung entsteht. Die Jungen ähneln dem Weibchen. Die Länge beträgt etwa sechsunddreißig, die Fittichlänge achtzehn, die Schwanzlänge zwölf Zentimeter.
Gould hat uns über die Lebensweise des Atlasvogels ziemlich genau unterrichtet. Sein Vaterland ist der größte Teil des australischen Festlandes, sein Lieblingsaufenthalt das üppige, dicht beblätterte Gestrüppe der parkähnlich bestandenen Gebiete des Innern wie der Küstenländer. Er lebt ständig an einem und demselben Ort, streicht in einem kleinen Umkreis hin und her, vielleicht in der Absicht, reichlichere Nahrung sich zu verschaffen. Im Frühjahr Australiens trifft man ihn paarweise, im Herbst in kleinen Flügen, dann oft in Flußbetten, namentlich da, wo sich Gebüsche auf einem Uferstreifen zur Wassergrenze hinabziehen. Die Nahrung besteht vorzugsweise aus Körnern und Früchten, nebenbei wohl auch Kerbtieren. Während des Fressens ist er so wenig scheu, daß er sich bequem beobachten läßt, sonst äußerst wachsam und vorsichtig. Die alten Männchen sitzen auf einem Baumwipfel und warnen, sobald sich etwas Verdächtiges zeigt, ihre auf dem Boden oder im Gezweig beschäftigten Familienmitglieder durch ihren hellen Lockton, dem bei Erregung ein rauher, unangenehmer Gurgelton folgt. Unter den Trupps sieht man immer nur wenige ausgefärbte Männchen; es scheint daher, daß diese erst spät ihr volles Kleid erhalten.
Das Merkwürdigste in der Lebensweise der Atlasvögel ist der Umstand, daß sie sich zu ihrem Vergnügen laubenartige Gewölbe erbauen, in denen sie sich umhertreiben. Gould lernte diese Gebäude zuerst im Museum zu Sydney kennen, wohin eines durch einen Reisenden gebracht worden war, nahm sich vor, der Sache auf den Grund zu kommen, und beobachtete nun längere Zeit die Tiere bei ihrer Arbeit. »Bei Durchstreifung der Zedergebüsche des Liverpoolkreises«, so erzählt er, »fand ich mehrere dieser Lauben oder Spielplätze auf. Sie werden gewöhnlich unter dem Schutze überhängender Baumzweige im einsamsten Teil des Waldes, und zwar stets auf dem Boden, angelegt. Hier wird aus dicht durchflochtenem Reisig der Grund gebildet und seitlich aus feineren und biegsameren Reisern und Zweigen die eigentliche Laube gebaut. Die Stoffe sind so gerichtet, daß die Spitzen und Gabeln der Zweige sich oben vereinigen. Auf jeder Seite bleibt ein Eingang frei. Besonderen Schmuck erhalten die Lauben dadurch, daß sie mit grellfarbigen Dingen aller Art verziert werden. Man findet hier buntfarbige Schwanzfedern verschiedener Papageien, Muschelschalen, Schneckenhäuser, Steinchen, gebleichte Knochen usw. Die Federn werden zwischen die Zweige gesteckt, die Knochen und Muscheln am Eingang hingelegt. Alle Eingeborenen kennen diese Liebhaberei der Vögel, glänzende Dinge wegzunehmen, und suchen verlorene Sachen deshalb immer zunächst bei gedachten Lauben. Ich fand am Eingang einen hübsch gearbeiteten Stein von vier Zentimeter Länge nebst mehreren Läppchen von blauem, baumwollenem Zeug, die die Vögel wahrscheinlich in einer entfernten Niederlassung aufgesammelt hatten. Die Größe der Lauben ist sehr verschieden.«
Noch ist es nicht vollkommen erklärt, zu welchem Zwecke die Atlasvögel solche Gebäude aufrichten. Die eigentlichen Nester sind sie gewiß nicht. Wie es scheint, werden die Lauben während der Paarungs- und Brütezeit zum Stelldichein benutzt und wahrscheinlich mehrere Jahre nacheinander gebraucht. Coxen berichtet, daß er gesehen habe, wie die Vögel, und zwar die Weibchen, eine Laube, die er zerstört, wiederhergestellt haben. Der »alte Buschmann« erzählt, daß sie in dichten Teesträuchern und anderm Gebüsch, gewöhnlich in Vertiefungen unweit ihrer Lauben, brüten; doch scheinen die Eier bis zur Stunde noch nicht bekannt zu sein. »Wenn das alte Männchen erlegt wird, findet das Weibchen sofort einen andern Gefährten; ich habe von einer Laube kurz nacheinander drei Männchen weggeschossen.«
Auch in der Gefangenschaft bauen die Vögel ihre Lauben. Strange, ein Liebhaber zu Sydney, schreibt an Gould: »Mein Vogelhaus enthält jetzt auch ein Paar Atlasvögel, von denen ich hoffte, daß sie brüten würden, als sie in den beiden letzten Monaten anhaltend beschäftigt waren, Lauben zu bauen. Beide Geschlechter besorgen die Aufrichtung der Lauben; aber das Männchen ist der hauptsächlichste Baumeister. Es treibt zuweilen sein Weibchen überall im Vogelhause herum; dann geht es zur Laube, hackt auf eine bunte Feder oder ein großes Blatt, gibt einen sonderbaren Ton von sich, sträubt alle Federn und rennt rings um die Laube herum, in welche endlich das Weibchen eintritt. Dann wird das Männchen so aufgeregt, daß ihm die Augen förmlich aus dem Kopfe heraustreten. Es hebt unablässig einen Flügel nach dem andern, pickt wiederholt auf den Boden und läßt dabei ein leichtes Pfeifen vernehmen, bis endlich das Weibchen gefällig zu ihm geht und das Spiel zunächst beendet wird.«
*
Der Kragenvogel ( Chlamydodera maculata), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Chlamydodera), erreicht eine Länge von achtundzwanzig Zentimeter, sein Fittich mißt sechzehn, der Schwanz zwölf Zentimeter. Die Federn des Oberkopfes und der Gurgelgegend sind schön braun, die Oberkopffedern silbergrau an der Spitze, die ganze Oberseite, die Flügel und der Schwanz tiefbraun, alle Federn durch einen runden, braungelben Spitzenfleck gezeichnet, die Vorderschwingen innen weiß gerandet, die Schwanzfedern bräunlichgelb gespitzt, die Unterteile graulichweiß, die seitlichen Federn durch schwache, hellbraune Zickzacklinien quergestreift. Ein schönes Nackenband von verlängerten pfirsichblütroten Federn bildet eine Art Fächer. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel und der Fuß sind braun. Die alten Vögel unterscheiden sich wenig, die Jungen durch das Fehlen des Fächers.
Die Kragenvögel bewohnen ausschließlich das Innere Australiens und hier zahlreich niedere Gebüschzüge an den Rändern der Ebenen, sind aber sehr scheu und werden deshalb von den Reisenden gewöhnlich nicht bemerkt. Dem Kundigen verraten sie sich durch einen rauhen, unangenehm scheltenden Lockton, den sie hören lassen, wenn sie, durch irgend etwas gestört, sich aus dem Staube machen wollen. Dann pflegen sie sich auf die höchsten Wipfelzweige vereinzelter Gebüsche zu setzen, die Umgegend zu überspähen und sich hierauf demjenigen Ort zuzuwenden, der ihnen am geeignetsten scheint. Am sichersten erlegt man sie bei der Tränke, namentlich während der Zeit der Dürre, die ihnen keine Wahl läßt.
Später fand Gould auch ihre Lauben auf. Diese finden sich an ähnlichen Orten, sind noch künstlicher und noch mehr ausgeschmückt, länger und bogiger als die der Atlasvögel, manche über einen Meter lang, bestehen äußerlich aus Reisig, das mit langen Grashalmen schön belegt ist, und werden innen überaus reich und mannigfaltig ausgeschmückt. Man findet zweischalige Muscheln, Schädel, Knochen kleiner Säugetiere und dergleichen. Zur Befestigung der Gräser und Zweige werden Steine benutzt und sehr künstlich geordnet. Sie liegen vom Eingang an jederseits so auseinander, daß zwischen ihnen Fußstege entstehen, während die Sammlung der Schmucksachen vor beiden Eingängen einen Haufen bilden. Bei einzelnen Lauben fand man vor jedem Eingange fast einen halben Scheffel von Knochen, Muscheln und dergleichen. Diese Gebäude waren wahrscheinlich seit mehreren Jahren benutzt worden. Aus der Entfernung der Lauben von den Flüssen, die die Muscheln geliefert haben mußten, konnte der Forscher schließen, daß die Vögel ihre Schmucksachen unter Umständen meilenweit herbeischleppen. Im Aussuchen der Stoffe scheinen sie sehr wählerisch zu sein; denn sie nehmen nur solche, die abgebleicht und weiß oder farbig sind. Gould überzeugte sich, daß die Lauben von mehreren Kragenvögeln zum Stelldichein benutzt wurden; denn als er sich einst verborgen vor einem der Gebäude auf die Lauer legte, schoß er kurz nacheinander zwei Männchen, die aus demselben Eingang hervorgelaufen kamen.
Coxen fand im Dezember ein Nest mit drei Jungen. Es ähnelte in seiner Gestalt dem der gemeinen europäischen Drossel, war tief napfförmig, aus dürren Reisern erbaut, leicht mit Federn und seinen Gräsern belegt und stand auf kleinen Zweigen einer Akazie über einem Wasserpfuhl.
*
Die Madenhacker ( Buphaginae) unterscheiden sich von allen übrigen Staren namentlich durch den Bau ihres Schnabels und ihrer Füße, nicht unwesentlich aber auch durch ihre Lebensweise. Der Madenhacker ( Buphaga erythrorhyncha), die bekannteste Art dieser Unterfamilie, ist oberseits olivenbraun, an den Kopfseiten, dem Kinn und der Kehle heller, unterseits licht rostgelblichfahl gefärbt; die Schwingen und Unterflügeldeckfedern sind dunkelbraun. Die Iris und ein nackter Ring ums Auge sind goldgelb; der Schnabel ist lichtrot, der Fuß braun. Die Länge beträgt einundzwanzig, die Breite dreiunddreißig, die Fittichlänge elf, die Schwanzlänge neun Zentimeter. Das Verbreitungsgebiet des Madenhackers umfaßt ganz Mittelafrika. Im Bogoslande traf ich ihn häufig an, vermag daher aus eigener Anschauung über seine Lebensweise zu berichten.
Man sieht die Madenhacker in kleinen Gesellschaften zu sechs bis acht Stück, und zwar ausschließlich in der Nähe größerer Säugetiere, ohne die sie, wie es scheint, gar nicht zu leben vermögen. Sie folgen den Herden der werdenden Rinder oder Kamele, finden sich aber auch auf einzelnen von diesen ein und lassen sich gewöhnlich auf einem und demselben Tiere nieder. Aus den Berichten der südafrikanischen Reisenden erfahren wir, daß sie in gleicher Weise wie den Herdentieren Elefanten und Nashörnern ihre Dienste widmen. Ich habe das Freundschaftsverhältnis zwischen ihnen und dem Nashorn bereits erwähnt. Nach Levaillant besuchen sie auch Antilopen, also wahrscheinlich alle größeren Säugetiere überhaupt. Sie widmen ihre Tätigkeit namentlich solchen Herdentieren, die wunde Stellen haben und deshalb die Fliegen herbeilocken. Daher hassen sie die Abessinier, die glauben, daß sie durch ihr Picken die aufgeriebene Stelle reizen und die Heilung verhindern; es sind aber vorzugsweise die Larven verschiedener Biesfliegen, die sich unter der Haut der Tiere eingebohrt haben, und die bluterfüllten Zecken, die sie herbeiführen. Erstere wissen sie aus ihren Schlupfwinkeln hervorzuziehen, letztere von allen Stellen des Leibes abzulesen. Gesunde Säugetiere, die sie von Jugend auf kennen, verraten nicht, daß die Schmarotzerei der Vögel ihnen lästig werde, behandeln die Madenhacker vielmehr mit wirklicher Freundschaft und lassen sie gewähren, gleichviel wie sie es treiben, ohne auch nur mit dem Schwanze nach ihnen zu schlagen; Tiere hingegen, die sie nicht kennen, gebärden sich wie unsinnig, wenn sie plötzlich den Besuch der in bester Absicht erscheinenden Vögel erhalten. So erzählt Anderson, daß eines Morgens die Ochsen seines Gespannes in den lächerlichsten Sätzen und in der wildesten Unordnung davonrasten, weil ein Schwarm Madenhacker sich auf ihnen niederließ. Schwerer verletzte, zumal arg wundgedrückte Pferde, Esel oder Kamele, deren Wunden zu heilen beginnen, suchen sich ebenfalls von den Madenhackern zu befreien und diese, freilich meist erfolglos, durch rasches Laufen, Zucken mit der Haut, Peitschen mit dem Schwanze und Wälzen auf der Erde zu vertreiben, und sie mögen in der Tat empfindlich von ihnen gequält, die Heilung ihrer Wunden vielleicht auch gehemmt werden.
Ein mit Madenhackern bedecktes Pferd oder Kamel gewährt einen lustigen Anblick. Ehrenberg sagt sehr richtig, daß die Vögel an den Tieren herumklettern wie die Spechte an den Bäumen. Der Madenhacker weiß jede Stelle an dem Körper auszunutzen. Er hängt sich unten am Bauche zwischen den Beinen an, steigt an diesen kopfunterst oder kopfoberst herab, setzt sich auf den Rücken, auf die Nase, kurz, sucht so recht buchstäblich den ganzen Leib ab. Fliegen und Bremsen nimmt er geschickt vom Fell weg, Maden zieht er unter der von ihm gespaltenen Haut hervor. Aber er mag arbeiten wie er will, die Tiere verharren ganz ruhig, weil sie wissen, daß der augenblickliche Schmerz nur zu ihrem Besten ist.
Der Madenhacker seinerseits vertraut übrigens auch nur dem Tier; vor dem Menschen nimmt er sich sehr in acht. Bei Annäherung eines solchen, und namentlich eines Fremden, klettert die ganze Gesellschaft, die an dem Tiere saß, rasch zu der Firste des Rückens empor, setzt sich fest und schaut nun vorsichtig dem Ankömmling entgegen. Alle, die ich beobachtete, ließen mich nicht näher als vierzig Schritte an sich herankommen. Gewöhnlich erheben sie sich schon viel früher, steigen zuerst in die Höhe, streichen mit leichtem Fluge, die Flügel weit ausgebreitet, oft auf ziemliche Strecken weg und kehren in einem größeren Bogen wieder zurück. Wenn sie Gefahr vermuten, setzen sie sich aber dann nicht nochmals auf ein Tier, sondern immer auf hochgelegene Punkte, namentlich auf Steinblöcke. Auf Bäumen habe ich sie nie gesehen. Daß wildlebende Tiere sich nach und nach gewöhnen, auf die Warnung des Madenhackers zu achten, ist sehr erklärlich.