
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Geier (Vulturidae), deren Gesamtheit wir als Familie auffassen, sind die größten aller Raubvögel. Der Schnabel ist länger oder mindestens ebensolang als der Kopf und gerade, nur vor der Spitze des Oberschnabels hakig herabgebogen. Ein eigentlicher Zahn fehlt immer, wird aber, wie bei den Adlern, durch eine hervorspringende Ausbuchtung der Schneide des Oberkiefers ersetzt. Bei einigen Arten kommen Hautwucherungen, namentlich kammartige Erhöhungen, auf dem Schnabel vor. Die Füße sind kräftig, die Zehen jedoch schwach, die Nägel kurz, wenig gebogen und immer stumpf, so daß die Fänge als Angriffswerkzeug wenig Bedeutung haben. Die Flügel sind außerordentlich groß, dabei aber breit und meist sehr abgerundet. Der Schwanz ist mittellang, zugerundet oder stark abgestuft und aus steifen Federn gebildet. Der Schlund erweitert sich zu einem Kropfe von beträchtlicher Größe, der gefüllt wie ein Sack aus dem Halse hervortritt.
Wir nennen die Geier unedle Raubvögel, falsch aber würde es sein, wollten wir unedel mit unvollkommen für gleichbedeutend halten. In gewisser Hinsicht müssen die Geier als sehr hochstehende Vögel angesehen werden. Ihre Begabungen sind teilweise ausgezeichnet. Sie halten sich lässig, auf dem Boden sitzend sehr niedrig, tragen die Flügel abstehend vom Leibe und ordnen das Gefieder nur selten mit einiger Sorgfalt; gehen zwar nicht anmutig, aber ziemlich leicht, meist schrittweise und fliegen langsam, aber mit ungemeiner Ausdauer. Ihre Sinne wetteifern an Schärfe mit denen anderer gefiederter Räuber; ihr Gesicht namentlich reicht in Fernen, von denen wir kaum eine Vorstellung gewinnen; ihr Gehör, der nächstdem am höchsten entwickelte Sinn, ist sehr gut, ihr Geruch sicherlich schärfer als bei anderen Raubvögeln, ihr Geschmack, ungeachtet der schmutzigen Nahrungsstoffe, die sie zu sich nehmen, keineswegs verkümmert und ihr Gefühl nicht wegzuleugnen. Sie sind scheu, selten jedoch wirklich vorsichtig, jähzornig und heftig, aber nicht unternehmend und noch viel weniger kühn, gesellig, allein keineswegs friedfertig, bissig und böswillig, dabei aber feig. Sie lernen nach und nach gefährliche Menschen oder Tiere von ungefährlichen unterscheiden, gewinnen aber selten wirkliche Anhänglichkeit an ein anderes Geschöpf. Immer zeigen sie sich plump und roh in ihrem Auftreten. Eine merkwürdige Beharrlichkeit in dem, was sie einmal begonnen, ist ihnen eigen. Ihr Wesen ist ein Gemisch von den verschiedenartigsten und scheinbar sich widersprechenden Eigenschaften. Man ist versucht, sie als ruhige und stille Vögel anzusehen, während genauere Beobachtung doch ergibt, daß sie zu den leidenschaftlichsten aller Raubvögel gezählt werden müssen.
Erst wenn man die Art und Weise des Nahrungserwerbs der Geier kennt, lernt man sie verstehen. Der Name Raubvogel verliert bei ihnen einen Teil seiner Bedeutung. Wenige von ihnen und auch diese wahrscheinlich bloß ausnahmsweise, greifen lebende Tiere an, in der Absicht, sie zu töten; für gewöhnlich sammeln sie einfach das auf, was ein günstiger Zufall ihnen überliefert. Sie bestatten die Leichen, die sie finden, oder räumen den Unrat weg, den sie erspähen. Weil aber der Zufall nicht immer sich ihnen günstig zeigt und sie demzufolge oft tagelang Mangel leiden müssen, gebärden sie sich beim Anblicke einer Beute, als müßten sie sich unter allen Umständen für gehabte Entbehrungen entschädigen und für kommende versorgen.
Vögel, die sich ebenso ernähren, können nur in warmen oder in gemäßigten Gürteln der Erde hausen. Der reiche Süden zeigt sich freigebiger als der Norden, liefert auch den Geiern so viel, daß sie sich durchs Leben schlagen können. Mit Ausnahme Neuhollands beherbergen alle Erdteile Geier. Die Alte Welt ist reicher an ihnen als die Neue, und die hier lebenden Arten sind außerdem noch hinsichtlich ihres Vorkommens weit mehr beschränkt als jene der östlichen Erdhälfte. Einige finden sich in annähernd gleich großer Menge in Europa, Asien und Afrika oder werden hier mindestens durch nahestehende Verwandte vertreten. Man begegnet ihnen in den heißen durchglühten Ebenen wie über den höchsten Zinnen der Gebirge der Erde. Sie sind es, die, soviel bis jetzt bekannt, höher als alle anderen Vögel im Luftmeer emporsteigen; sie sind befähigt, die großartigsten Veränderungen des Luftdruckes ohne Beschwerde zu ertragen. Einige Arten nehmen im Gebirge ihren Stand und verlassen dasselbe nur ausnahmsweise, während andere wiederum ebene Gegenden in größerer Menge bewohnen als die Hochgebirge. Von einem eigentlichen Standorte ist übrigens bei ihnen kaum zu reden. Ihre ungeheueren Flugwerkzeuge befähigen sie, und die Eigentümlichkeit ihres Nahrungserwerbes nötigt sie, weitere Strecken zu durchstreifen, als irgendein anderer Raubvogel sie durchfliegt. Bloß während der Fortpflanzungszeit bindet sie die Sorge um ihre Brut an ein und dasselbe Gebiet; während des übrigen Jahres führen sie mehr oder weniger ein Wanderleben. Mit vollster Wahrheit kann man von ihnen sagen, daß sie überall und nirgends zu finden sind. Sie erscheinen plötzlich massenhaft in Gegenden, wo man tage- und wochenlang nicht einen einzigen von ihnen wahrnahm, und verschwinden ebenso spurlos wieder, als sie gekommen. Die Nähe der menschlichen Wohnungen meiden nur einzelne Geier; andere finden gerade hier das tägliche Brot mit größerer Leichtigkeit als in Gegenden, in denen der Mensch, sozusagen, noch nicht zur Herrschaft gelangt ist. Für die Ortschaften Südasiens, Afrikas und Südamerikas sind gerade diese Raubvögel bezeichnende Erscheinungen.
Es wird die Lebensweise der Geier anschaulich machen, wenn ich einzelne von ihnen handelnd auftreten lasse. Ich darf dies um so eher tun, als ich die Geier nicht bloß in der Gefangenschaft, sondern auch in ihrem Freileben beobachtet habe und oft genug Zeuge ihres Auftretens gewesen bin.
Am südlichen Saume der Wüste liegt ein verendetes Kamel. Die Beschwerden der Wüstenreise haben es erschöpft; es erreichte, obgleich der Treiber ihm am vorigen Tage seine Last abnahm und es ledig neben den befrachteten Arbeitsgenossen einhergehen ließ, den Nil nicht mehr, sondern brach, vollständig entkräftet, auf Nimmerwiederaufstehen zusammen. Sein Herr ließ es, nachdem er mit nicht verhehltem Kummer über den durch seinen Tod erlittenen Verlust von ihm geschieden ist, unberührt liegen, weil sein Glaube ihm verbietet, das geringste von einem gestorbenen oder nicht unter den üblichen Gebräuchen getöteten Tiere zu verwenden.
Am nächsten Morgen liegt der Leichnam noch unversehrt auf seinem fahlen Sterbebette. Da erscheint ein Rabe über dem nächsten Bergesgipfel. Sein scharfes Auge erspäht das Aas; er schreit und nähert sich mit rascheren Flügelschlägen, kreist einige Male um das gefallene Tier, senkt sich dann herab und betritt, in nicht allzugroßer Entfernung von demselben den Boden, nähert sich ihm nunmehr rasch und umgeht es mehreremal mit bedächtigem Spähen. Andere Raben folgen seinem Beispiele, und bald ist eine ansehnliche Gesellschaft dieser allgegenwärtigen Vögel versammelt. Nunmehr finden sich auch andere Fleischfresser ein. Der überall vorhandene Schmarotzermilan und der kaum minder häufige Schmutzgeier ziehen Kreise über demselben, ein Raubadler nähert sich, mehrere Kropfstörche drehen in schwindelnder Höhe ihre Schraubenlinien über dem auch ihnen winkenden Gerichte. Aber noch fehlen die Vorleger der Speise. Die zuerst angekommene Gesellschaft nagt allerdings hier und da an dem gefallenen Tiere; dessen dicke Lederhaut ist jedoch den schwachen Schnäbeln viel zu fest, als daß sie sich größere Bissen abreißen könnten. Nur das eine nach oben gekehrte Auge konnte von einem Schmutzgeier aus seiner Höhle gezogen werden. Doch die Zeit, in der auch die großen Glieder der Familie auf Nahrung ausfliegen, kommt allmählich heran. Es ist zehn Uhr geworden; sie haben nun ausgeschlafen und ausgeträumt und einer nach dem andern die Schlafplätze verlassen. Zuerst waren sie niedrig längs des Gebirges hingestrichen; da sie aber nichts Genießbares ersehen konnten, stiegen sie in der Luft empor und erhoben sich zu einer unabsehbaren Höhe. In dieser ziehen sie ihre Kreise weiter; einer folgt dem andern wenigstens mit den Blicken, steigt oder fällt mit ihm, wendet sich wie der Vorgänger nach dieser oder jener Seite. Von seinem Standpunkte aus kann er ein ungeheueres Gebiet sozusagen mit einem Blicke überschauen, und das Auge ist so wundervoll scharf, daß ihm kaum etwas entgeht. Der Geier, der das Gewimmel in der Tiefe erblickt, gewinnt damit sofort ein klares Bild und erkennt, daß er das Gesuchte gefunden. Nunmehr läßt er sich zunächst in einigen Schraubenwindungen tiefer herab, untersucht die Sache näher und zieht, sobald er sich überzeugt, plötzlich die gewaltigen Flügel ein. Sausend stürzt er hunderte, vielleicht tausend Meter hernieder und würde zerschmettert werden, wenn er nicht rechtzeitig noch die Schwingen halb wieder ausbreitete, um den Fall aufhalten und die Richtung regeln zu können. Bereits in ziemlicher Entfernung von dem Boden strecken die schwerleibigen Arten die Ständer lang aus und senken sich sodann, noch immer außerordentlich rasch, schief nach unten hernieder, wogegen die leichter gebauten anscheinend mit der Gewandtheit und Zierlichkeit eines Falken herniederkommen und durch verschiedene Schwenkungen, die sie wechselseitig heben und senken, die Wucht des Falles zu mildern wissen. Von der Trägheit und Unbehülflichkeit, die die Geier sonst an den Tag zu legen scheinen, ist jedoch nicht das geringste mehr zu bemerken; sie überraschen im Gegenteil durch eine Gewandtheit, die man ihnen niemals zugetraut hätte.
Dem ersten Ankömmling folgen alle übrigen, die sich innerhalb gewisser Grenzen befinden, rücksichtslos nach. Das Herabstürzen des ersteren ist für sie das Zeichen zur Mahlzeit. Sie eilen jetzt von allen Seiten herbei und lassen sich auf eigene Untersuchungen nicht mehr ein. Man hört im Laufe einer Minute wiederholt das sausende Geräusch, das sie beim Herabstürzen verursachen und sieht von allen Richtungen her rasch sich vergrößernde Körper herniederfallen, obgleich man wenige Minuten vorher die fast drei Meter klafternden Vögel auch nicht einmal als Pünktchen wahrgenommen hatte. Jetzt stört die Tiere nichts mehr. Sobald einer von ihnen an der Tafel sitzt, scheuen sie keine Gefahr; nicht einmal ein sichtbarer Jäger vertreibt sie. Sogleich nach Ankunft am Boden eilen sie mit wagerecht vorgestrecktem Halse, erhobenem Schwanze und halb ausgebreiteten, schleppenden Flügeln auf das Aas zu, und nunmehr bestätigen sie ihren Namen; denn Vögel, die gieriger wären als sie, kann es nicht geben. Es gibt für sie keine Rücksicht mehr. Das kleinere Gesindel macht mit Ehrfurcht Platz; unter gleichstarken Arten erhebt sich wütender Kampf und Streit. Von ihrem Arbeiten ein rechtes Bild zu gewinnen, ist schwer; das Gewimmel, das Streiten, Zanken, Kämpfen dabei läßt sich kaum schildern. Zwei bis drei Schnabelhiebe der starkschnäbeligen Geier zerreißen die Lederhaut des Aases, einige mehr die Muskellagen, während die leichter bewaffneten Arten ihren langen Hals, soweit sie können, in die Höhlen einschieben, um zu den Eingeweiden zu gelangen. Mit gieriger Hast wühlen sie zwischen diesen umher, und einer sucht den andern fortwährend zu verdrängen, zu überbieten. Leber und Lunge werden selten herausgerissen, vielmehr in der Höhle selbst aufgefressen, die Därme hingegen herausgezogen, durch schwer zu beschreibendes Zurückhüpfen weiter und weiter herausgefördert und dann nach wütendem Kampfe mit andern stückweise verschlungen. Beständig stürzen noch hungrige Geier von oben herab unter die bereits schmausenden, in der bestimmten Absicht, sie womöglich von der köstlichen Tafel zu vertreiben, und wiederum gibt es neuen Kampf, neues Lärmen, Beißen und ingrimmiges Gezwitscher. Die schwächeren Gäste sitzen, während die großen Herren speisen, entsagend um die Gruppe, sind aber höchst achtsam auf den Hergang, weil sie wissen, daß ihnen von jenen doch zuweilen ein Bröcklein zugeworfen wird, natürlich ohne deren Willen, bloß in der Hitze des Gefechtes. Adler und Milane schweben auch wohl in der Höhe über der schmausenden Gesellschaft auf und nieder und stürzen sich, als ob sie auf fliegende Beute stoßen wollten, zwischen sie hinein, ergreifen mit den Fängen ein eben von den Geiern losgearbeitetes Fleischstück und entführen es, bevor letztere noch Zeit haben, dem Frevel zu steuern.
Ein kleines Säugetier wird von solcher freßwütigen Tischgesellschaft binnen wenigen Minuten bis auf den Schädel verzehrt; sogar von einem Rinde oder Kamele bleibt nach einer einzigen Mahlzeit wenig übrig. Die Gesättigten entfernen sich nur mit Widerstreben von der Tafel.
Nicht überall und immer verläuft eine Geiermahlzeit so, wie ich eben geschildert. Schon in Südeuropa und noch mehr in ganz Afrika stellen sich da, wo Geier in der Nähe bewohnter Ortschaften ein Aas aufzuräumen haben, auf diesem noch andere hungrige Gäste ein. In allen südlichen Ländern sind die Hunde teilweise auf Aasnahrung angewiesen, und die wirklich herrenlosen unter ihnen können sich buchstäblich nur dann einmal satt fressen, wenn sie Aas fanden. Im tieferen Innern Afrikas treten zu den Hunden noch die Marabus. Ihnen gegenüber haben die Geier oft schwere Kämpfe zu bestehen; der nagende Hunger aber macht sie dreist und den Gegnern furchtbar. Auch die größten Hunde werden vertrieben, so sehr sie knurren und die Zähne fletschen; denn jeder Geier erkennt in ihnen einen gefährlichen Beeinträchtiger des Gewerbes. Selbst der bissige Hund vermag gegen die Geier nichts auszurichten. Wenn wirklich einer seiner Bisse ihm glückte, traf er höchstens eine der ausgebreiteten Schwingen, ohne den Vogel zu schädigen, wogegen dieser wie eine Schlange seinen Hals vorwirft und der gewaltige Schnabel da, wo er auftrifft, eine blutige Wunde zurückläßt. Anders verhält es sich mit den Marabus. Sie lassen sich von den Geiern nicht vertreiben, sondern schmettern mit ihren Keilschnäbeln rechts und links unter die Menge, bis diese ihnen Platz macht.
Unter Umständen kostet es den Geiern besondere Mühe, ihrer Mahlzeit sich zu versichern. Nach einer mündlichen Mitteilung Behns, welche durch Jerdon bestätigt wird, sind sie in Indien nicht selten auch die Bestatter der menschlichen Leichen. Die armen Hindu, nicht imstande, die Kosten zu erschwingen, welche die Verbrennung eines ihrer Toten erfordert, begnügen sich, den Leichnam auf ein Strohlager zu betten und dieses anzuzünden, damit der Gestorbene des reinigenden Feuers wenigstens nicht gänzlich entbehre. Dann werfen sie den Toten, dessen Haut nur eben versengt ist, in den heiligen Ganges und überlassen es diesem, ihn dem Meere zuzutragen. Mit fortschreitender Verwesung treiben die Leichname auf der Oberfläche des Gewässers dahin und werden nunmehr den Geiern zugänglich. Einer oder der andere läßt sich auf den schwimmenden Körper nieder, hält sich mit ausgebreiteten Schwingen im Gleichgewicht und beginnt zu fressen.
Bei quälendem Hunger mögen die Geier dann und wann auch lebende Tiere, namentlich erkranktes Herdenvieh, angreifen; wie es scheint, bevorzugen jedoch alle Arten Aas oder wenigstens Knochen jeder anderen Nahrung. Obenan stellen sie das Aas der Säugetiere; doch verschmähen sie auch die Leichen der Vögel, Lurche und Fische nicht. Die kleineren Arten sind genügsamer als die größeren. Einzelne scheinen lange Zeit ohne Aas auskommen zu können: sie nähren sich von Knochen, andere hauptsächlich von dem Kote der Menschen oder dem Miste der Tiere und erjagen nebenbei Kerfe und kleine, täppische Wirbeltiere.
Nach beendigter Mahlzeit entfernen sich die Geier ungern weit von ihrer Tafel, bleiben vielmehr stundenlang in der Nähe der Walstatt sitzen und warten hier den Beginn der Verdauung ab. Geraume Zeit später begeben sie sich zur Tränke, und bringen auch hier wieder mehrere Stunden zu. Sie trinken viel und baden sich sehr oft. Freilich ist letzteres kaum einem Vogel nötiger, als ihnen; denn wenn sie von ihrem Tische aufstehen, starren sie von Schmutz und Unrat; zumal die langhälsigen sind oft über und über blutig. Ist auch die Reinigung glücklich besorgt, so bringen sie gern noch einige Stunden in trägster Ruhe zu, setzen sich dabei entweder auf die Fußwurzeln und breiten die Schwingen aus, in der Absicht, sich von der Sonne durchwärmen zu lassen, oder legen sich platt auf den Sand nieder. Der Weg zum Schlafplatze wird erst in den Nachmittagsstunden angetreten. Ihre Nachtruhe nehmen sie entweder auf Bäumen oder auf steilen Felsenvorsprüngen, sehr gern namentlich auf Felsgesimsen, die weder von oben noch von unten her Zugang gestatten.
Der Flug wird durch einige rasch aufeinanderfolgende und ziemlich hohe Sprünge eingeleitet; hierauf folgen mehrere ziemlich langsame Schläge mit den breiten Fittichen. Sobald die Vögel aber einmal eine gewisse Höhe erreicht haben, bewegen sie sich fast ohne Flügelschlag weiter, indem sie durch verschiedenes Einstellen der Flugwerkzeuge sich in einer wenig geneigten Ebene herabsenken oder aber von dem ihnen entgegenströmenden Winde wieder heben lassen. So schrauben sie sich, anscheinend ohne alle Anstrengung, in die ungeheueren Höhen empor, in denen sie dahinfliegen, wenn sie größere Strecken zurücklegen wollen. Ungeachtet dieser scheinbaren Bewegungslosigkeit ihrer Flügel ist der Flug ungemein rasch und fördernd.
In früherer Zeit hat man angenommen, daß es der Geruchssinn wäre, der die Geier bei Auffindung des Aases leite: meine Beobachtungen, die durch die Erfahrungen anderer Forscher vollste Bestätigung finden, haben mich jedoch belehrt, daß die Geier auch auf Aas herabkommen, das noch gänzlich frisch ist und keinerlei Ausdünstung verbreiten kann, daß sie auch bei starkem Luftzuge von allen Richtungen der Windrose herbeifliegen, sobald einer von ihnen ein Aas erspäht hat, auf einem verdeckten Aase dagegen erst dann erscheinen, wenn dasselbe von den Raben und Aasgeiern aufgefunden worden ist und deren Gewimmel sie aufmerksam gemacht hat. Ich glaube deshalb mit aller Bestimmtheit behaupten zu dürfen, daß das Gesicht der vorzüglichste und wichtigste ihrer Sinne, daß es das Auge ist, das ihr Leben ermöglicht.
Die Geier horsten vor Beginn des Frühlings ihrer betreffenden Heimatsländer, demgemäß in Europa in den ersten Monaten unseres Jahres. Nur diejenigen Arten, die selten vorkommen, gründen einzeln einen Horst; alle übrigen bilden Siedelungen. Sie erwählen eine geeignete Felswand oder einen entsprechenden Wald, und hier ist dann jeder passende Platz besetzt. Einige Arten horsten nur auf Felsen, andere bloß auf Bäumen, andere endlich auf dem flachen Boden. Die meisten dulden innerhalb ihrer Ansiedelung gänzlich verschiedene Vögel, Störche z.B., ohne sie irgendwie zu belästigen. Der Horst selbst ist, wenn er auf Bäumen steht, ein gewaltiger Bau, der im ganzen anderen Raubvögelhorsten entspricht. Armdicke Knüppel bilden die Unterlage, feineres Reisig den Mittelbau, schwache Zweige und dünne Wurzeln, die sehr oft mit Tierhaaren untermischt und regelmäßig mit solchen ausgekleidet werden, die Nestmulde. Steht er dagegen auf dem Boden einer Felshöhle oder eines Felsenvorsprunges, so ist er meist kaum noch Horst zu nennen. Das Gelege enthält ein bis zwei Eier von rundlicher Gestalt, rauhem Korn und graulicher oder gelblicher Grundfarbe, die durch dunklere Schalenflecke, Punkte, Tüpfel und Schmitzen bezeichnet sind. Es ist wahrscheinlich, daß beide Geschlechter abwechselnd brüten; von einzelnen Arten weiß ich bestimmt, daß es der Fall ist. Wie lange die Brutzeit währt, hat man noch nicht ermittelt. Das Junge entschlüpft in einem wolligen Daunenkleide dem Ei, ist häßlich und hilflos im hohen Grade und braucht mehrere Monate, bevor es fähig wird, selbständig seine Wege durchs Leben zu wandeln. Beide Eltern lieben es sehr und verteidigen es gegen schwächere Feinde, nicht aber ernstlich auch gegen den Menschen. Anfänglich wird der kleinen Mißgestalt halb verfaultes und im Kropfe der Eltern verdautes Aas in den Rachen gespien, später kräftigere Kost in Menge zugetragen. Ihre Freßlust übertrifft, falls dies möglich, noch die Gier der ausgewachsenen Vögel. Nach dem Ausfliegen bedarf der junge Geier einige Wochen lang der Pflege, Führung und Lehre seiner Eltern; bald aber lernt er es, sich ohne diese zu behelfen, und damit ist der Zeitpunkt gekommen, wo angesichts eines Aases alle verwandtschaftlichen Gefühle ihr Ende erreichen.
Manche Gegner behelligen, wenig Feinde gefährden die Geier. Schmarotzer plagen sie; Adler, Falken, Krähen und andere geflügelte Quälgeister der Raubvögel stoßen auf sie herab und ärgern sie, sobald sie ihrer ansichtig werden; auf dem Aase kommen sie mit Hunden und Marabus in Streit. Der Mensch befehdet die großen Räuber, deren Nutzen er überall erkennt, nur dann, wenn sie vom Pfade der Tugend abweichen und, anstatt Totengräber zu bleiben, auch einmal andern Räubern ins Handwerk pfuschen. Der Hindu sieht in ihnen, weil sie die Leichname seiner Toten verzehren, unzweifelhaft heilige Wesen; der Innerafrikaner läßt sie einfach gewähren, obwohl er sie keineswegs von jedem Verdachte an irgendwelchen Übeltaten freispricht.
Alle Geier sind harte Vögel, die auch unserer strengsten Winterkälte trotzen können, weil sie gewohnt sind, bei ihrem Auf- und Niedersteigen die verschiedensten Wärmegrade zu ertragen, die mit dem gemeinsten Futter sich begnügen, und wenn sie eine Zeitlang gut genährt wurden, tage-, ja wochenlang ohne Nahrung ausdauern, daher leicht in Gefangenschaft zu halten. Weitaus die meisten werden, auch wenn sie als alte Vögel unter die Herrschaft des Menschen kamen, bald zahm. Ihre Gleichgültigkeit hilft ihnen über so manches Elend, wie die Gefangenschaft es mit sich bringt, leicht hinweg. Einzelne freilich sehen längere Zeit in ihrem Wärter einen Feind, dem sie gelegentlich tückisch ihre Kraft fühlbar zu machen suchen. Unterhaltend werden die Geier, wenn man sie in einem geräumigen Käfige mit andern großen Raubvögeln zusammenbringt. Zwar sitzen sie auch jetzt noch den größten Teil des Tages über still und ruhig auf dem einmal gewählten Platze; doch fehlt es einer so bunten Gesellschaft selten an Gelegenheit zu Taten und Handlungen. Namentlich die Fütterung bringt kaum beschreibliche Aufregung hervor. Mit allen Waffen wird gekämpft und zu jedem Mittel gegriffen, um sich des besten Bissens zu bemächtigen. Doch geht es auch hier wie überall: der mächtigste und gewandteste hat das größte Recht und beherrscht und übervorteilt die andern. Vor allem sind es die Gänsegeier, die sich bemerklich machen. Das Gefieder gesträubt, den langen Hals eingezogen, sitzen sie mit funkelnden Augen vor dem Fleische, ohne es anzurühren, aber augenscheinlich bedacht, es gegen jeden anderen zu verteidigen. Der zusammengekröpfte Hals schnellt wie ein Blitz vor und nach allen Seiten hin, und jeder ihrer Genossen fürchtet sich, einen ihm zugedachten Biß zu erhalten. In solchen Augenblicken hat das Gebaren der Gänsegeier täuschende Ähnlichkeit mit der Art und Weise, wie eine Giftschlange sich zum Bisse anschickt. Ihre Unverschämtheit entrüstet selbstverständlich die andern in hohem Grade und wird Ursache zu sehr heftigen Kämpfen. Nicht selten wird einer ohne seinen Willen mitten in das Kampfgewühl gezogen; die ganze Rotte fliegt, flattert und wälzt sich über ihn her, und er hat große Not, wieder davonzukommen. Daß ein solches Gefecht nicht ohne lebhaftes Zischen, kicherndes und gackerndes Schreien, Schnappen mit dem Schnabel und Fuchteln mit den Flügeln vorübergeht, daß es mit andern Worten einen Höllenlärm erregt, braucht nicht erwähnt zu werden. In solchen Augenblicken gewährt eine Geiergesellschaft im Käfige ein höchst unterhaltendes und fesselndes Schauspiel.
*
Die Edelfalken unter den Geiern oder die edelsten Mitglieder der Familie sind die Bartgeier ( Gypaëtus). Sie zeichnen sich nicht bloß vor allen übrigen Arten ihrer Gruppe, sondern auch vor allen Raubvögeln überhaupt durch auffallend gestreckten Leibesbau aus. Ihr Kopf ist groß, lang, vorn platt, hinten etwas gewölbt, der Hals kurz, der Flügel sehr lang und spitzig, die dritte Schwinge in ihm die längste, der sehr lange, zwölffedrige Schwanz stufig und keilförmig, der Schnabel groß und lang, die Oberkinnlade an der Wurzel sattelförmig eingebuchtet, gegen die Spitze hin aufgeschwungen, scharfhakig herabgekrümmt, an der Schneide zahnlos; die untere Kinnlade gerade, der Fuß kurz und verhältnismäßig schwach, der Fang mittellang und sehr schwach, mit starken, aber wenig gekrümmten und ziemlich stumpfen Nägeln bewehrt, das Gefieder reich und großfedrig. Die Schnabelwurzel umgeben nach vorn gerichtete Borstenbüschel, die die Wachshaut bedecken und auch den Unterschnabel teilweise einhüllen; den Kopf bekleiden daunen- und borstenartige, kurze, den Hals dagegen große Federn; das übrige Gefieder liegt etwas knapper an, verlängert sich aber namentlich an den Hosen noch bedeutend und bedeckt die Fußwurzeln bis gegen die Zehen hinab.
Der Bart- oder Lämmergeier ( Gypaëtus barbatus) ist, nach eigenen Messungen spanischer Stücke, 1 bis 1,15 Meter lang, 2,4 bis 2,67 Meter breit; die Fittichlänge beträgt 79 bis 82, die Schwanzlänge 48 bis 55 Zentimeter. Erstere Maße gelten für das Männchen, letztere für das Weibchen; die einen wie die andern aber dürften, wie bei allen großen Vögeln, nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen sein. Das Gefieder des alten Vogels ist auf Stirn, Scheitel und an den Kopfseiten gelblichweiß, durch die borstenartigen Federn dunkler gezeichnet, auf Hinterkopf und Hinterhals schön rostgelb, auf dem Rücken, dem Bürzel, den Oberflügel- und Oberschwanzdeckfedern dunkelschwarz mit weißlichen Schäften und hellerer Schafteinfassung, vorn mit gelblichen Spitzenflecken. Die Schwingen und Steuerfedern sind schwarz, auf der Innenfahne aschgrau, die Schäfte weißlich. Der ganze Unterkörper ist hoch rostgelb, an den Vorderhalsfedern am dunkelsten, an den Seiten der Oberbrust und an den Hosen mit einzelnen braunen Seitenflecken gezeichnet, über die Brust verläuft ein Kranz von weißgelben, schwarz gefleckten Federn. Von der Schnabelwurzel an durch das Auge zieht sich ein schwarzer Zügelstreifen, der am Hinterhaupt sich umbiegt, sich aber nicht ganz mit dem der andern Seite vereinigt, also nur einen unvollständigen Kranz bildet. Das Auge ist silberweiß, die äußere Augenhaut mennigrot, die Wachshaut bläulichschwarz, der Schnabel horngrau, an der Spitze schwarz, der Fuß bleigrau. Beim jungen Vogel ist das Auge aschgrau, der Schnabel hornblau, auf der Firste und an der Spitze des Unterschnabels dunkler, der Fuß schmutzig hellgrün, bläulich schimmernd, die Wachshaut bläulichschwarz. Sehr junge Vögel sind oberseits, einige weiß gefleckte Federn am Oberrücken ausgenommen, schwarzbraun, auf Hals und Kopf fast schwarz, unterseits hell rostbraun. Erst nach wiederholtem Federwechsel geht das Jugendkleid in das der alten Vögel über.
Der Bartgeier ist weit verbreitet. In Europa bewohnt er die Alpen und die Hochgebirge Siebenbürgens, einzeln auch den Balkan und die Pyrenäen sowie alle höhern Gebirge der drei südlichen Halbinseln und endlich den Kaukasus. In Asien verbreitet er sich über sämtliche Hochgebirge vom Altai an bis zu den chinesischen Rand- und Mittelgebirgen und von hier wie dort bis zum Sinai, den Gebirgen Südarabiens und dem Himalaja. In den schweizerischen, deutschen und österreichischen Alpen ist er gänzlich ausgerottet oder mindestens in einem Menschenalter erweislich nicht mehr vorgekommen; doch mag er einzelne Gebirgszüge Südtirols dann und wann vielleicht noch besuchen. Auf der Balkanhalbinsel fehlt er keinem höhern Gebirgszuge. In Afrika beschränkt sich sein Wohngebiet auf den Nordrand des Erdteiles, insbesondere den Atlas und den Djebel Ataka nebst Umgegend. Im Nilgebirge läßt er sich sehr selten, im Niltal selbst nur ausnahmsweise einmal sehen.
Mehr als jedes andere Mitglied seiner Familie, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Kondore, darf der Geieradler als ein Bewohner der höchsten Gebirgsgürtel angesehen werden. Doch ist dieser Ausspruch nur so zu verstehen, daß er zwar die Höhe liebt, die Tiefe aber durchaus nicht meidet. Sturm und Wetter, Eis und Schnee lassen ihn gleichgültig; aber auch die in tieferen Lagen südlicher Gebirge regelmäßig herrschende Hitze ficht ihn nicht ersichtlich an, um so weniger, als ihm bei seinem Dahinstürmen selbst die heißen Lüfte Kühlung zufächeln müssen, und er imstande ist, jederzeit belästigender Schwüle zu entgehen und seine Brust in dem reinen Äther der kalten Höhe zu baden. Da, wo er in der Tiefe, ungefährdet durch den Menschen, und mühelos Nahrung findet, siedelt er sich auch in niederen Lagen des Gebirges an, wogegen er in der Regel die höchsten übergletscherten oder schneeumlagerten Berggipfel nicht verläßt.
In den Morgenstunden sieht man ihn, nach meinen Erfahrungen, selten oder nicht; erst anderthalb Stunden nach Sonnenaufgang etwa beginnt er sein Gebiet zu durchstreifen, und spätestens um fünf Uhr nachmittags zieht er seinem Schlafplatze wieder zu. Beide Gatten des Paares fliegen in nicht allzugroßer Entfernung voneinander längs hauptsächlichsten Zügen des Gebirges dahin, gewöhnlich in einer Höhe von nicht mehr als etwa fünfzig Meter über dem Boden. Sie folgen dem Gebirgszug seiner ganzen Länge nach, kehren an der Spitze eines auslaufenden Berges auch wohl um und suchen, in gleicher Weise dahinstreichend, die andere Seite ab. Unterbrechen Quertäler den Hauptzug, so werden diese in derselben Höhe, die der Vogel bisher innegehalten hatte, überflogen, selten aber sogleich mit durchsucht; über Talkesseln dagegen kreist er meist längere Zeit. Findet sein scharfes Auge nichts Genießbares auf, so steigt er empor und sucht, ganz in derselben Weise die Berggipfel und Hochebenen ab; erweist sich auch hier seine Umschau vergeblich, so streicht er in die Ebene hinaus. Ein gerade in seinem Zug begriffener Bartgeier läßt sich nicht gern durch etwas aufhalten. Ich habe gesehen, daß einer so nahe an den bewohnten Gebäuden einer Einsiedelei vorüberflog, daß man ihn von dem Fenster aus hätte mit Schrot herabschießen können. Auch vor Menschen scheut er sich durchaus nicht, schwebt, wenn er Futter sucht, im Gegenteil oft auf wenige Meter vor einem vorüber. Auch streichend fliegt der Bartgeier äußerst schnell, unter laut hörbarem Rauschen seines Gefieders, dahin, ohne jeden Flügelschlag, und seine Gestalt erscheint dabei so zierlich, daß es ganz unmöglich ist, ihn mit irgendeinem Geier oder Adler zu verwechseln. Nur Unkundige können ihn für einen Schmutzgeier ansehen. Ich bin oft versucht worden, den fernfliegenden Bartgeier für einen – Wanderfalken zu halten, wenn ich, von der Falkengestalt getäuscht, mich augenblicklich nicht an die schnellen Flügelschläge des Edelfalken erinnerte. Gurney sagt ungefähr dasselbe: »Der Flug ähnelt so sehr dem größerer Falken, daß ich überrascht und förmlich getäuscht war, als ich den ersten herabgeschossen und einen Geier in den Händen hatte.« Beim Fliegen läßt er seinen Blick nach allen Seiten schweifen, bis er etwas entdeckt hat; dann beginnt er sofort seine Schraubenlinien über dem Gegenstand zu drehen; sein Genosse vereinigt sich sogleich mit ihm, und beide verweilen nun, oft lange kreisend, über einer Stelle, bevor sie ihre Wanderung fortsetzen. Zeigt sich das gefundene der Mühe wert, so lassen sie sich allgemach tiefer hernieder, setzen sich endlich auf dem Boden und laufen nun wie Raben auf das Gesuchte zu. Beim Fußen wählt der Bartgeier stets erhabene Punkte, am liebsten vorstehende Felszacken oder wenigstens Felsplatten. Man erkennt, daß ihm das Ausfliegen schwer wird und er deshalb vorzieht, beim Abstreichen gleich eine gewisse Höhe zu haben, um von hier aus ohne Flügelschlag sich weiter fördern zu können; denn wenn er einmal schwebt, ist der geringste Luftzug genügend, ihn in jede beliebige Höhe emporzuheben. Im Hochgebirge von Habesch steigt er, laut Heuglin, zuweilen so hoch in die Lüfte, daß er dem schärfsten Auge nur noch als kleiner Punkt im blauen Äther erscheint. Auf Felsen, die dies gestatten, sitzt er ziemlich aufrecht, gewöhnlich aber wagerecht, wie der lange Schwanz es bedingt. Der Gang ist verhältnismäßig gut, schreitend, nicht hüpfend. So selten er die Gesellschaft seinesgleichen aufzusuchen scheint, so wenig meidet er die anderer größerer Raubvögel, ohne sich jedoch jemals näher mit ihnen zu befassen. Unbekümmert um sie, gleichsam als ob sie nicht vorhanden wären, zieht er seine Straße, und selbst wenn er unter ihnen horstet, tritt er niemals mit ihnen in irgendwelche Verbindung. Selbst mit dem Steinadler verträgt er sich, aber er beachtet ihn ebensowenig wie irgendein anderes Mitglied seiner Zunft oder Ordnung, vorausgesetzt, daß er von übermütigen Räubern angegriffen wird. Aber auch in diesem Falle fliegt er, ohne Abwehr zu versuchen oder Vergeltung zu üben, wie vorher seinen Weg weiter.
»Unsere Stubengelehrten«, so berichtet Heuglin, »schildern den Bartgeier als stolzen Räuber, der mutig große Säugetiere, ja selbst den Menschen angreift und in den Abgrund zu stoßen sucht. Wir haben Gelegenheit gehabt, diesen Vogel durch längere Zeit alltäglich in nächster Nähe zu beobachten, haben viele Dutzende von ihnen erlegt und untersucht und zu unserm Erstaunen gefunden, daß seine Nahrung fast ausschließlich in Knochen und andern Abfällen von Schlachtbänken besteht, daß er gefallene Tiere und menschliche Leichen angreift, daß er aber nur im Notfall selbst jagt; denn selten glückt es ihm, einen Hasen oder eine verirrte oder kranke Ziege wegzufangen. Rabenartig umherschreitend, auch seitwärts hüpfend, sieht man ihn zuweilen auf den grünen Matten des Hochlandes auf die dort überaus zahlreichen Ratten lauern. In der Haltung hat er nichts mit den eigentlichen Geiern gemein, eher noch manches mit dem Schmutzgeier, namentlich was seine Bewegungen auf der Erde anbelangt. Morgens mit Tagesgrauen verläßt er die Felsen, auf denen er ruht, schweift rasch und weit über Felder, Wiesen und Dörfer zu Tal, oft so blitzschnell, daß man deutlich das sturmartige, fast metallisch klingende Rauschen seines Gefieders vernimmt, kreist dann um Marktplätze, wo gewöhnlich geschlachtet wird, oder folgt mit vielen andern Aasvögeln den Lagern und Heereszügen. So war er während der ersten Monate unseres Aufenthaltes in den Bogosländern nicht beobachtet worden bis zur Ankunft abessinischer Truppen, mit denen er auch wieder verschwand. Während der Feldzüge des Königs Theodor gegen die Gala fanden sich Dutzende dieser Vögel als stetige Begleiter des Heeres ein.«
Krüper gebraucht folgende Worte: »Hört man den Namen Lämmergeier aussprechen, so erinnert man sich unwillkürlich an den kühnsten Räuber in der Vogelwelt und schaudert zusammen, so gebrandmarkt stellt sich der Vogel vor das geistige Auge. Ist der Lämmergeier denn auch wirklich ein den Herden und Menschen Furcht und Schrecken einflößendes und so schädliches Tier, oder ist er ohne sein Zutun in den Ruf gekommen, den er in wissenschaftlichen Schriften und Köpfen erhalten hat? In Arkadien, wo die Gebirge nicht sehr hoch sind, beginnt sein Gebiet unmittelbar am Meere. Was raubt denn dort in der Ebene dieser gefährliche Nachbar? Sucht er dort die Lämmer, Ziegen oder sogar die Rinder auf, um sie zu verspeisen? Man sieht ihn zuweilen in nicht großer Höhe am Fuße eines gebüschreichen Berges kreisen, den Kopf nach unten gerichtet, spähend, plötzlich herabfliegen und verschwinden. Sicherlich macht er in diesem Augenblick eine Beute, gewiß, er hat eine Ziege – nein, er hat nur eine Schildkröte gefunden, die seinen Hunger stillen oder seinen Jungen wohlschmecken soll. Um zu dem Fleisch der Schildkröte zu gelangen, wirft er dieselbe aus der Höhe auf einen Felsen, damit sie zerschellt. Der Engländer Simpson, der den Geieradler in Algerien beobachtete, bestätigt die Angabe und erzählte mir, daß jeder Vogel einen Felsen habe, auf dem er die Schildkröten zertrümmere. Am vierzehnten Mai 1861 besuchte ich den Horst eines Lämmergeiers. Unten an der Felswand lag eine große Menge von Schildkröten sowie verschiedene Knochen.«
»Seine Nahrung«, schreibt mir mein in Spanien lebender Bruder Reinhold nach zwanzigjährigen Beobachtungen, »besteht in Knochen, Aas und lebenden Tieren. Auf frisches Luder sah ich ihn nie fallen, wohl aber, ohne dieses und die bereits schmausenden Raben, Milane und Geier zu beachten, niedrig darüber wegstreichen. Er zieht unter solchen Umständen vielleicht einige Kreise über dem Aas, nimmt am Schmaus jedoch keinen Anteil. Auf meinen Geierjagden habe ich ihn täglich beobachten können. Oft zog er nur sechs oder acht Meter über dem Aas weg, umkreiste es vielleicht drei- oder viermal, ließ sich aber, mochte das Aas noch unangerührt liegen oder von schmausenden Geiern umringt sein, niemals weder auf ihm, noch auf einem in der Nähe befindlichen Felsen nieder. Vier und fünf Tage nacheinander habe ich von früh bis nachmittags auf ihn angestanden, weder auf sich einfindende Geier noch Adler geschossen, um ihn nicht zu verscheuchen, stets aber vergeblich seiner geharrt. In den Gebirgen Mittelspaniens, Sierra de Guadarrama, de Avila, de Gredos z. B., hält man ihn allerdings für einen gewaltigen Räuber; ich selbst aber habe ihn nie ein lebendes Tier ergreifen, so sogar über Ziegenherden hinwegstreichen sehen, ohne daß er die Absicht bekundet hätte, auch nur auf ein Zicklein zu stoßen. Ob etwas Wahres an der Lilford gewordenen Mitteilung südspanischer Jäger ist, daß er Bergsteinböcke über die Felsen jage und sich, nachdem die Geier das Fleisch gefressen, mit deren Knochen nähre, lasse ich dahingestellt sein. In seinem Horste habe ich noch mit Wolle bekleidete Schafe und Lammsbeine gefunden, die dafür sprechen, daß er diese Tiere lebend ergriffen hat, da der spanische Hirt so leicht kein Tier den Geiern überläßt, ohne ihm vorher das Fell abgezogen zu haben.«
Nach so vielen, fast in jeder Beziehung unter sich übereinstimmenden Berichten wird es schwer, die Erzählungen für wahr zu halten, die über die Stärke, Kühnheit und Raubsucht desselben Vogels von den schweizerischen Forschern gegeben worden sind. Hierher gehören die Geschichten Steinmüllers, daß ein Bartgeier versuchte, einen Ochsen von einem Felsen herabzustürzen, daß ein anderer einen einjährigen Ziegenbock, ungeachtet der Gegenwehr seines Herrn, durch die Lüfte davontrug, nachdem er den Besitzer in die Flucht geschlagen hatte, daß ein dritter eine fünfzehn Pfund schwere Ziege aus der Luft herabfallen ließ, ein vierter eine siebenundzwanzig Pfund schwere Eisenfalle auf ein gegenüberliegendes, hohes Gebirge schleppte, ein fünfter von einem Fuchs, den er geschlagen hatte, in der Luft getötet wurde, ein sechster ein Kind in Gegenwart seiner Eltern aufhob und entführte, ein siebenter sogar ein dreijähriges Mädchen, Anna Zurbuchen, vierzehnhundert Schritte weit geschleppt und nur durch die Ankunft eines dem schreienden Mädchen folgenden Mannes abgehalten wurde, es zu fressen, so daß sein wohl am linken Arm und an der Hand verwundetes Opfer gerettet wurde und später als » Geieranni« einen Schneider heiraten konnte, und anderes mehr. Berichtete nicht Girtanner über einen in der neuesten Zeit vorgekommenen Angriff eines Geieradlers auf einen halberwachsenen Knaben, ich würde alle Geschichten solcher Art unbedenklich in die Rumpelkammer der Fabel geworfen haben und nach wie vor den Geieradler als einen Vogel bezeichnen, der im großen nicht mehr ist, als der ihm in vieler Hinsicht nahe verwandte Schmutzgeier im kleinen: ein kraftloser, feiger, leiblich wie geistig wenig begabter Raubvogel, der nur gelegentlich ein schwächeres, lebendes Wirbeltier wegnimmt, gewöhnlich aber in Knochen und andern tierischen Abfällen seine Speise findet. Eingedenk aber der Gewissenhaftigkeit des eben genannten, von mir hochgeachteten Forschers, darf ich dessen Darlegung nicht verschweigen, so schwer mir auch wird, zu glauben.
»Mit der Frage nach der Ernährung des Alpenbartgeiers«, sagt Girtanner, dessen Mitteilungen ich übrigens nur im Auszug wiedergebe, »sind wir sowohl aus die Beschaffenheit des Nährstoffes als auf die Art und Weise, wie er sich desselben bemächtigt, bei dem streitigsten Kapitel in seiner Naturgeschichte angelangt. Daß er Aas frißt, steht fest: hierin stimmen alle Berichte überein. Am deutlichsten beweist dies, wenn wir noch vermeiden wollen, aus seinem bezüglichen Verhalten in Gefangenschaft auf sein Freileben zu schließen, der Umstand, daß die Falle stets mit solchem geködert wird, und daß er oft auf Aas angetroffen worden ist.« Von ihm selbst getötete kleinere Vierfüßler: Berghasen, Murmeltiere, frischgesetzte, überhaupt junge Gemsen und Ziegen, Lämmer, Ferkel usw. zieht er bei uns jeder andern Nahrung vor, die wildlebenden aber den Haustieren. Findet er solche seinerseits ohne Anstrengung und Gefährdung zu erbeutende Säuger in genügender Anzahl, so ist er gewiß zufrieden, seinen Hunger auf die müheloseste Weise stillen zu können; gelingt ihm dies aber nicht, und ist auch kein Aas zu haben, dann zwingt ihn der Hunger, dann führt ihn der Selbsterhaltungstrieb dazu, größere lebende Tiere zu überfallen und zu bezwingen: Schafe, Ziegen, Gemsen, Füchse, Kälber usw. Hierüber sind alle Berichte, die mir seitens gewissenhafter Beobachter eingegangen sind, zu sehr einig, als daß für mich die vollständige Sicherheit der Tatsache noch im geringsten fraglich sein könnte. Dieselben Berichterstatter sind auch darin einig, daß sich der Alpenbartgeier von Aas und kleinen Säugern allein gar nicht zu erhalten imstande wäre. Berghasen sucht er aus dem Gestrüpp und Krummholz herauszujagen, um sie dann auf offenem Gelände entweder ohne weiteres zu fassen oder vorher durch einen Flügelhieb zu betäuben. Je nach der Sicherheit der Stelle frißt er die Beute sofort an oder trägt sie nach dem Horst oder seinem gewöhnlichen Standplatz. Bei der Jagd auf erwachsene Gemsen, Schafe usw. bedient er sich zu deren Bewältigung in erster Linie seiner Flügel, nicht der Fänge. Während der Adler mit angezogenen Flügeln wie eine Bombe aus der Luft auf die Beute herabfährt, ihr die Fänge einschlägt und sie durch Ersticken mordet, so geschieht der Angriff des Bartgeiers meist erst aus ziemlicher Nähe. Unser Tessiner Beobachter berichtet nach mehrfacher eigener Anschauung: »Wenn der Bartgeier mit seinen scharfen Augen auf dem Boden unter sich ein Tier sieht, das er fressen will, so fällt er nicht wie ein Stein aus der Luft herab, gleich dem Steinadler, sondern er kommt in weiten Kreisen herabgeflogen. Oft setzt er sich zunächst auf einen Baum oder einen Felsen und beginnt den Angriff erst, nachdem er sich von hier nochmals, jedoch nicht hoch, erhoben hat. Sieht er Leute in der Nähe, so schreit er laut und fliegt fort. Nie greift er Tiere an, die weit von Abhängen im flachen Tal weiden; bemerkt er aber eine Gemse zum Beispiel, die nahe am Abgrund graset, so beginnt er, von hinten heranschießend, mit wuchtigen Flügelschlägen das aufgeschreckte Tier hin und her zu jagen und zu schleppen, bis es, völlig verwirrt und betäubt, nach dem Abhang hinflieht. Erst wenn er diesen seinen Zweck erreicht hat, legt er seine ganze Kraft in die starken Flügel. Von beiden Seiten fahren mit betäubendem Zischen und Brausen die harten Schwingen klatschend auf das tödlich geängstigte, halb geblendete Opfer. Wohl sucht dieses, zeitweise noch sich zusammenraffend, mit den Hörnern den Mörder abzuwehren – vergebens. Zuletzt wagt es einen Sprung oder macht einen Fehltritt; es springt oder stürzt in die Tiefe, oder aber es bricht todesmatt zusammen und kollert sterbend über die Felsbänke. Langsam senkt sich der Bartgeier seinem Opfer nach, tötet es nötigenfalls noch vollständig mit Flügeln und Schnabel und beginnt ungesäumt, das warme Tier zu zerfleischen. Steht ein Schaf oder ein ähnliches Tier, ein Jagdhund, an sehr steiler Stelle am Abhang, und er wird nicht von ihm bemerkt, bis er, von hinten kommend, sich ihm genaht hat, so dauert der Kampf oft nur sehr kurze Zeit. Er fährt mit scharfem Flügelschlag geraden Weges an das überraschte Opfer an und wirft es durch den ersten Anprall glücklich hinunter, oder er reißt dasselbe fliegend mit Schnabel und Krallen über die Felskante hinaus und läßt es stürzen, im Abgrund zerschellen.« Hiermit übereinstimmend schreibt mir Baldenstein: »Als ich einst auf einer meiner Gebirgsjagden gegen Abend in gemütlichem Gespräch bei einem Hirten saß, schnupperte dessen Hund am nahen Anhang herum. Plötzlich erreichte ein Schrei des Hundes unser Ohr. Im selben Augenblick sahen wir den treuen Herdenbewacher über dem Abgrund in der Luft schweben, während sein Mörder, ein alter Bartgeier, triumphierend über ihm hinschwamm. Wir hatten unmittelbar vorher nicht auf den Hund geachtet und auch von dem Geier nichts bemerkt, bis uns der sonderbare Schrei des armen Tieres nach jener Stelle sehen ließ. Ohne jenen Schreckenslaut wäre der Hund auf rätselhafte Weise verschwunden, und wir hätten uns sein Verschwinden nie erklären können, wenn auch sicher der Verdacht auf diese Todesart in uns sofort aufgetaucht wäre. Schnell ließ sich auch der Geier auf seine Beute hinunter und verschwand wie diese vor unsern Augen. Es wickelte sich alles sehr rasch ab, rascher, als es erzählt werden kann. Ob der Vogel diese Beute mehr durch die Gewalt seines Flügelschlages oder durch einen Riß mit dem Schnabelhaken über den Felsen hinausgeworfen, bin ich deshalb nicht zu entscheiden imstande, weil, wie gesagt, bei unserm Aufblicken der Hund schon frei in der Luft schwebte; sicher aber weiß ich, daß der Bartgeier nie auf einen meiner jagenden Hunde stieß, solange sie, entfernt vom Abgrund, auf ebenem Boden suchten, sooft er auch allein oder zu zweien nahe über ihnen kreiste. Der Bartgeier ist nicht ein Stoßvogel im Sinne des Adlers.« Daß und in welcher Weise der Bartgeier auch erwachsene Gemsen angreift und bewältigt, hatte Saratz mit eigenen Augen anzusehen Gelegenheit: »Als ich einst«, schreibt er, »von meinem Hause aus Gemsen auf ihrem Marsche zuschaute, sah ich plötzlich, wie ein gewaltiger Bartgeier von hinten auf eine derselben niederstürzte, ihr einige rasche Flügelschläge versetzte, dann auf die am Boden liegende Beute sich warf und sie sofort mit dem Schnabel zu bearbeiten begann. Bei meinen Jagdstreifereien auf Gemsen sah ich einmal ein kleines Rudel derselben an einem schmalen Gletscher dahinziehen und ruhig, die Geis voran, sich dem Berggrat zuwenden. Plötzlich stutzt die Geis, die andern halten bestürzt an, und im Nu haben alle einen Kreis gebildet, die Köpfe sämtlich nach innen zugekehrt. Was mochte diese Unruhe, diesen plötzlichen Halt bewirkt haben? Hierüber gab mir ein der Höhe zugewandter Blick Aufschluß; denn ich wurde bald gewahr, daß sich über ihnen in der Luft etwas schaukelte, was mir mein Glas als Bartgeier zu erkennen gab. Plötzlich stürzte sich dieser in schräger Richtung von hinten den Gemsen nach, die ihn jedoch mit tatkräftigem Emporwerfen der Hörner empfingen und zwangen, von ihnen abzulassen. Er erhob sich, um viermal denselben Angriff zu wiederholen. Nochmals stieg er empor, diesmal aber immer höher und höher, und als er nur noch als Punkt am Himmel sichtbar war, da plötzlich stiebten meine geängstigten Tiere auseinander, um sich im gestreckten Lauf einer überhängenden Felswand zu nähern, der sie sich anschmiegten und nun das Auge der Höhe zurichteten. In dieser Stellung verblieben sie, bis ihnen die herandämmernde Nacht Beruhigung über ihre Sicherheit brachte.« Daß der Bartgeier sich auch an Menschen wage mit der Absicht, sie zu töten, ist seit langer Zeit geglaubt und als Märchen verlacht, dann wieder als Tatsache behauptet oder doch wenigstens als vielleicht möglich gehalten worden. Beispiele vom Raub kleiner Kinder durch große Raubvögel, bei denen es sich in unserer Alpenkette jedenfalls nur um den Steinadler und den Bartgeier handeln kann, sind zu sicher festgestellt, als daß hieran noch gezweifelt werden könnte. Warum nun der Verbrecher immer der Steinadler sein soll, ist nicht ohne weiteres klar. Was den Bartgeier, der sich erwiesenermaßen an erwachsene Gemsen wagt, die doch im Verhältnis zu einem kleinen Kind jedenfalls wehrhaft sind und die dennoch meist besiegt werden, abhalten sollte, bei gebotener Gelegenheit ein solches hilfloses Wesen wegzuschleppen, über einen Felsen, an denen man sie in den Bergen oft genug in der Nähe der Hütten herumkrabbeln läßt, herunterzuwerfen, will mir nicht einleuchten. Man verteile hier ruhig die Schuldenlast auf beide Räuber. Denn auch der Bartgeier versucht die Beute wegzutragen, wenn er sie aus irgendeinem Grunde nicht an Ort und Stelle verzehren kann. Übersteigt ihr Gewicht seine Kraft, die man sich jedoch nur nicht zu gering vorstellen möge, so kann er sie immer noch fallen lassen, wie dies bei allen Arten von Dieben vielfach beobachtet worden ist. Begründeter und begreiflicher ist der Zweifel darüber, daß sich unser Bartgeier auch an halberwachsene Menschen wage, in der Absicht, sie auf irgendeine Weise zu vernichten. Beispiele von solchen Überfällen mit oder ohne Erfolg, an denen nicht die gerechtesten Zweifel haften, sind sehr wenige bekannt; doch gewinnt die Glaubwürdigkeit jenes Falles an der Silbernalp, wo ein Hirtenbube durch einen Bartgeier von einem Felskopfe in den Abgrund gestoßen und am Fuße der Felswand von ihm angefressen worden sein soll, durch die Feststellung der Wahrheit der neuesten ähnlichen Begebenheit im Berner Oberland eine kräftige Stütze. Dieser jüngste Fall eines Angriffes seitens eines schweizerischen Bartgeiers auf einen halberwachsenen Menschen trug sich im laufenden Jahr zu, ist also keine veraltete Geschichte, und ich habe mich sehr bemüht, die Feststellung der Tatsache oder die Grundlosigkeit des Gerüchtes sicherzustellen.
»Im Laufe des Juni 1870 war in mehreren schweizerischen Zeitungen zu lesen, daß bei Reichenbach, im Kanton Bern, ein Knabe von einem ›Lämmergeier‹ überfallen worden sei und dem Angriff sicher erlegen wäre, wenn der Vogel nicht noch rechtzeitig hätte verscheucht werden können. Zuerst schenkte ich der Mitteilung wenig Aufmerksamkeit und erwartete, der Lämmergeier werde sich wohl baldigst in einen Adler, wo nicht gar in einen Habicht, und der überfallene Knabe in ein Hühnchen verwandeln; doch der Widerruf blieb diesmal aus, und da die Sache für mich Teilnahme genug darbot, um verfolgt zu werden, so wandte ich mich an Herrn Pfarrer Haller in Kandergrund, dessen Freundlichkeit mir von früher her schon bekannt war.«
Unser Forscher erzählt nun, wie er von dem genannten Pfarrherrn an einen zweiten, Herrn Blaser, verwiesen wurde und von letzterem nach verschiedenem Hin- und Herschreiben folgende Nachricht erhalten habe. »Es war am zweiten Juni 1870, nachmittags vier Uhr, da ging jener Knabe, Johann Betschen, ein munterer, aufgeweckter Bursche von vierzehn Jahren, noch klein, aber kräftig gebaut, von Kien hinauf nach Aris. Kien liegt im Tolgrund bei Reichenbach, im Winkel, den der Zusammenfluß der Kander und der Kien aus dem Kientale bildet, Aris ungefähr hundertundfünfzig Meter hoch auf einer Stufe des Bergabhanges. Der Weg führte den Knaben ziemlich steil über frischgemähte Wiesen hinauf, und wie er eben oben auf einer kleinen Bergweide noch ungefähr tausend Schritte von den Häusern entfernt, ganz nahe bei einem kleinen Heuschober angelangt war, erfolgte der Angriff. Plötzlich und ganz unvermutet stürzte der Vogel mit furchtbarer Gewalt von hinten auf den Knaben nieder, schlug ihm beide Flügel um den Kopf, so daß ihm, nach seiner Bezeichnung, gerade war, als ob man zwei Sensen zusammenschlüge, und warf ihn sogleich beim ersten Hiebe taumelnd über den Boden hin. Stürzend und sich drehend, um sehen zu können, wer ihm auf so unliebsame Weise einen Sack um den Kopf geschlagen, erfolgte auch schon der zweite Angriff und Schlag mit beiden Flügeln, die fast miteinander links und rechts ihm um den Kopf sausten und ihm beinahe die Besinnung raubten, so ›sturm‹ sei er davon geworden. Jetzt erkannte der Knabe einen ungeheuren Vogel, der eben zum dritten Mal auf ihn herniederfuhr, ihn, der etwas seitwärts auf dem Rücken lag, mit den Krallen in der Seite und auf der Brust packte, nochmals mit den Flügeln auf ihn einhieb, ihn beinahe des Atems beraubte und sogleich mit dem Schnabel auf seinen Kopf einzuhauen begann. Trotz alles Strampelns mit den Beinen und Wenden des Körpers vermochte er nicht, den Vogel zu vertreiben. Um so kräftiger benutzte der Junge seine Fäuste, mit deren einer er die Hiebe abzuwehren suchte, während er mit der andern auf den Feind losschlug. Dies muß gewirkt haben. Der Vogel erhob sich plötzlich etwas über den Knaben, vielleicht um den Angriff zu wiederholen. Da erst fing dieser mörderlich zu schreien an. Ob dies Geschrei das Tier abgehalten habe, den Angriff wirklich zu erneuern, oder ob er bei seinem Auffliegen eine auf das Geschrei des Burschen herbeieilende Frau gesehen und er ihn deshalb unterließ, bleibt unausgemacht. Anstatt wieder sich niederzustürzen, verlor er sich rasch hinter dem Abhang. Der Knabe war jetzt so schwach, von Angst und Schreck gelähmt, daß er sich kaum vom Boden zu erheben vermochte. Die erwähnte Frau fand ihn, als er sich eben taumelnd und blutend vom Boden aufraffte. Gesehen hat die Frau den Vogel nicht mehr. Dieses kann nun trotz allem bezweifelt werden; ich selbst bezweifle es aber nicht im geringsten. Johann Bretschen, der von solchen Vögeln vorher nie gehört hatte, konnte auch einen solchen Vogelkampf nicht sofort erfinden und eingehend beschreiben, während er doch seiner Retterin sofort den Hergang der Sache erzählte, sowie nachher andern Leuten, als man ihn bei den Häusern wusch und verband. Ich kenne zudem ihn und seine Familie als wahrheitsliebend. Die Wunden, die ich selbst bald nachher besichtigte, bestanden in drei bedeutenden, bis auf den Schädel gehenden Aufschürfungen am Hinterkopfe. Auf Brust und Seiten sah man deutlich die Krallengriffe als blaue Flecken, zum Teil blutig, und der Blutverlust war bedeutend. Der Knabe blieb acht Tage lang sehr schwach. An seinen Aussagen also und an der Wirklichkeit der Tatsache ist nach meiner Ansicht kein Zweifel zu hegen. Wie sollte ich nun aber von dem Jungen, der sonst nie solche Vögel gesehen, nach der Angst eines solchen Kampfes erfahren, ob er es mit einem Steinadler oder mit einem Bartgeier zu tun gehabt habe? Ich nahm ihn ins Verhör, und er berichtete mir, so gut er konnte. Namentlich war ihm der fürchterlich gekrümmte Schnabel, an dem er beim Aufsteigen des Vogels noch seine Haare und Blut sah, im Gedächtnis geblieben, ferner ein Ring um den Hals und die ›weiß grieseten Flecken‹ (mit weißen Tupfen besprengte Fittiche) und endlich, was mich am meisten stutzig machte, daß er unter dem Schnabel ›so 'was wüstes G'strüpp‹ gehabt habe.«
Der Pfarrer berichtet nun in ausführlicher, schon von Girtanner gekürzter Weise über die mit dem geschädigten Knaben, unter Vorlegung verschiedener Abbildungen vorgenommene, sehr geschickt und sorgfältig geleitete Prüfung, beschließt mit ihm nach Bern zu reisen und erzählt, daß der Bursche, im Museum zuerst zum Steinadler geführt, von diesem als von seinem Gegner durchaus nichts wissen wollte, daß er beim Anblick eines Bartgeiers im dunklen Jugendkleid in die größte Verlegenheit geriet, weil ihm der Vogel zwar in Bezug auf die Form und Größe des Schnabels und das Gestrüpp unter demselben seinem Feinde ähnlich, im Gefieder aber durchaus unähnlich vorkam, und daß, als er endlich vor einem alten, gelben Bartgeier stand und denselben kaum erblickt hatte, er plötzlich ausrief: »Der isch's jitzt, das isch jitzt dä Schnabel, grad däwäg sy d'Flecke grieset gsi und so dä Ring um e Hals, und das isch jitzt s'G'strüpp.« Immer wieder kehrte der Knabe zu diesem Bartgeier mit hellgelbem Halse, Brust und Bauch zurück und anerkannte ihn als seinen Gegner. Immer wieder trat er erregt vor denselben hin mit der Erklärung: »das isch e, grad so isch er gsi!«
»So vereinzelt glücklicherweise Angriffe des Bartgeiers auf Menschen überhaupt sind und zumal solche in der Größe des angeführten Knaben dastehen«, fährt Girtanner fort, »zweifle ich wenigstens nicht mehr daran, daß sie vorkommen, überlasse es jedoch natürlich jedem, selbst davon zu halten, was immer er möge. Daß unser Bartgeier auch erwachsene Menschen, in der Hoffnung sie zu bewältigen, mörderisch überfallen, vom Felsenrand gestürzt, oder auf eine andere Art umgebracht habe, ist nie festgestellt worden. Ebensowenig aber wollen sich solche Jäger, Alpenwanderer, Hirten, die an gefährlicher Stelle im Gebirge verweilend, plötzlich den knarrenden, sausenden Flügelschlag des unmittelbar über ihrem Körper pfeilschnell am Felskopf hin und in den gähnenden Abgrund hinaus schießenden mächtigen Vogels in beängstigender Weise selbst gespürt haben, einreden lassen, daß der reine Zufall den Weg desselben an jener Stelle durch und genau über die Länge ihres Leibes weggeführt habe.«
Unsere Kenntnis über die Fortpflanzung des Bartgeiers ist in den letzten Jahren durch verschiedene Beobachter wesentlich erweitert worden. Ziemlich übereinstimmend wird angegeben, daß auch dieser Vogel, wie so viele andere Mitglieder seiner Zunft, wiederholt in demselben Horste, im Süden auch ohne Bedenken unter andern Geiern brütet. Ein Horst, den Lilford in Spanien besuchte, war, wie die Bewohner der nächsten Ortschaften versicherten, seit Menschengedenken benutzt worden. In der Regel wählt der Bartgeier, nach anderer Raubvögel Art, eine geräumige Felsenhöhle an einer in den meisten Fällen unzugänglichen Felswand zu seiner Brutstätte; nach Mitteilungen meines Bruders kann es aber auch geschehen, daß er kaum zehn Meter über zugänglichem Boden nistet. Ob er selbst den Horst erbaut oder den eines andern Raubvogels einfach in Beschlag nimmt, ist bis jetzt noch nicht ausgemacht, ebensowenig, als festgestellt werden konnte, ob ein und dasselbe Paar in jedem Jahre in dem nämlichen Horste brütet oder zwischen mehreren Niststellen wechselt. In der Schweiz wählt er, nach Girtanners Erhebungen, zu seiner Brutstätte eine Stelle an einer möglichst kahlen, unnahbaren Felswand ziemlich hoch oben im Gebirge, immer da, wo überhängendes Gestein ein schützendes Dach über einer geräumigen Nische bildet. Seinen Horst besucht der Vogel bereits in den letzten Monaten des Jahres regelmäßig; denn schon im Januar, spätestens in den ersten Tagen des Februar, beginnt sein Brutgeschäft. In weitaus den meisten sicher festgestellten Fällen legt das Weibchen nur ein einziges Ei; doch bemerkt Saratz, daß am Camogaskerhorst bald ein, bald zwei Junge von der gegenüberliegenden Felswand aus bemerkt wurden. Die Eier sind groß, rundlich und grobkörnig, auf trüblichweißem Grunde mit kleineren und größeren, zuweilen auch sehr großen, aschgrauen oder rotgrauen Schalenflecken und ockergelben, braunroten oder rotbraunen Tupfen und Flecken gezeichnet, die unten oder um die Mitte des Eies dichter zusammenstehen. Wie lange die Brutzeit währt, ist nicht bekannt; man weiß nur, daß zu Anfang des März, spätestens im April, in der Schweiz wie in Südspanien und Nordafrika ausgeschlüpfte Junge bemerkt werden.
Der erste Naturforscher, der einen Horst des Geieradlers erstieg, scheint mein Bruder gewesen zu sein. Der Horst stand auf einem Felsenvorsprung, der durch das etwas überhängende Gestein einigermaßen vor den Sonnenstrahlen geschützt war, kaum mehr als fünfzehn Meter über dem Fuß des letzten Felsenkammes, war also verhältnismäßig leicht zu erreichen. Der Durchmesser des Unterbaues betrug ungefähr anderthalb Meter, der Durchmesser der etwa zwölf Zentimeter tiefen Nestmulde sechzig Zentimeter, die Höhe einen Meter. Dicke und lange Äste, von der Stärke eines Kinderarmes bis zu der eines Daumens, bildeten den Unterbau; hierauf folgte eine dünne Schicht von Zweigen und Ästchen, zwischen denen die Nestmulde eingetieft war. Diese bestand aus denselben, aber etwas feineren Bestandteilen und war innen mit Baststricken, Kuh- und Roßhaaren sorgfältig ausgekleidet. Um den Horst herum waren alle Felsplatten mit einer schneeweißen Kotkruste überzogen. Ein zweiter Horst in Griechenland wurde von Simpson bestiegen. Derselbe war, wie Krüper berichtet, aus starken Zweigen erbaut und mit verschiedenen Tierhaaren, besonders solchen von Ziegen, ganz durchwebt und innen flach ausgepolstert. Auf ihm saß ein drei Wochen altes Junges, dessen Tafel mit Knochen, einem ganzen Eselsfuß, Schildkröten und dergleichen reich bedeckt war. »Beide Eltern nahten und stießen zuweilen ein Pfeifen aus, das dem eines Hirten nicht unähnlich klang.« Später zeigten sich die Alten noch ängstlicher; davon aber, daß sie einen Angriff versucht hätten, sagt Krüper kein Wort.
Das Gefangenleben der Lämmergeier ist vielfach beobachtet worden und entspricht vollständig dem Charakterbild, das man bei Erforschung des Freilebens unsers Vogels gewinnt. Mein Bruder erhielt einen jungen Bartgeier im Jugendkleid, der von zwei Hirten aus dem beschriebenen Horst genommen und zunächst einem Fleischer zum Ausfüttern übergeben, von diesem aber seinem spätern Herrn abgetreten worden war. Die beiden alten Vögel hatten, als man ihnen ihr Junges rauben wollte, die Hirten nahe umkreist, ohne jedoch auf dieselben zu stoßen, sich auch nach einigen Steinwürfen entfernt und das Geschrei ihres Kindes nicht weiter beachtet.
»Als ich den jungen Geieradler zum ersten Male sah«, erzählt der genannte, »war er sehr unbeholfen und ungeschickt. Er trat noch nicht auf die Füße, sondern ließ sich, wenn er zum Auftreten gezwungen worden war, sofort wieder auf die Fußwurzeln nieder, legte sich auch wohl geradezu auf den Bauch. Die ihm vorgelegten Fleischstückchen ergriff er mit der Spitze des Schnabels, warf sie dann in die Höhe und fing sie geschickt wieder auf, worauf er sie begierig hinunterschlang. Knochen behagten ihm jetzt ebensowenig als später; stopfte ich ihm solche, die scharfe Ecken oder Kanten hatten, bis in den Kropf hinab, so würgte er solange, bis er sie wieder ausspie. Bei Tage wurde er in die Sonne gesetzt und breitete dann sogleich Flügel und Schwanz aus, legte sich wohl auch auf den Bauch und streckte die Beine weit von sich; in dieser Stellung blieb er mit allen Anzeichen der höchsten Behaglichkeit stundenlang liegen, ohne sich zu rühren. Nach ungefähr einem Monat konnte er aufrecht stehen und begann nun auch zu trinken. Dabei hielt er das ihm vorgesetzte Gefäß mit einem Fuße fest, tauchte den Unterschnabel tief ein und warf mit rascher Kopfbewegung nach oben und hinten eine ziemliche Menge von Wasser in den weit geöffneten Rachen hinab, worauf er den Schnabel wieder schloß. Vier bis sechs Schluck schienen zu seiner Sättigung ausreichend zu sein. Jetzt hackte er auch bereits nach den Händen und Füßen der Umstehenden, verschonte aber immer die seines Herrn. Einen Monat später war er bis auf den Hals, dessen Krausenfedern oben hervorsproßten, vollkommen befiedert und sein Schwanz bedeutend, jedoch noch keineswegs zu voller Länge gewachsen. Er wurde in einen geräumigen Käfig gebracht und gewöhnte sich auch bald ein, nahm jedoch in den ersten beiden Tagen seines Aufenthaltes in dem neuen Raum keine Nahrung zu sich und trank nur Wasser. Nach Ablauf dieser Frist bekam er Hunger. Ich warf ihm Knochen vor, er rührte sie nicht an; sodann bekam er Köpfe, Eingeweide und Füße von welschen und andern Hühnern, aber auch diese ließ er unberührt liegen. Als ich ihm Knochen einstopfte, brach er dieselben augenblicklich wieder aus, ebenso die Eingeweide der Hühner; erst viel später begann er Knochen zu fressen. Frisches Rind- und Schöpsenfleisch verschlang er stets mit Gier. Nachdem er das erstemal in seinem Käfig gefressen hatte, legte er sich wieder platt auf den Sand, um auszuruhen und sich zu sonnen. Er antwortete mir und kam, sobald ich ihn rief, zu mir heran, ließ sich streicheln und ruhig wegnehmen, während er augenblicklich die Nackenfedern sträubte, wenn ein Fremder nahte. Auf Bauern in der Tracht der Vega schien er besondere Wut zu haben. So stürzte er mit heftigem Geschrei auf einen Knaben los, der seinen Käfig reinigen sollte, und zwang ihn mit Schnabelhieben, denselben zu verlassen. Einem Bauer, der ebenfalls in den Käfig ging, zerriß er Weste und Beinkleider. Nahte sich ein Hund oder eine Katze seinem Käfig, so sträubte er die Federn und stieß ein kurzes, zorniges ›Grik, grik, grik‹ aus, dagegen kam er regelmäßig an sein Gitter, wenn er meine Stimme vernahm, ließ erfreut und leise seinen einzigen Laut hören und gab auf jede Weise sein Vergnügen zu erkennen. So steckte er den Schnabel durch das Gitter und spielte mit meinen Fingern, die ich ihm dreist in den Schnabel stecken durfte, ohne befürchten zu müssen, daß er mich beißen werde. Wenn ich ihn aus seinem Käfig herausließ, war er sehr vergnügt, spazierte lange im Hofe herum, breitete die Schwingen, putzte seine Federn und machte Flugversuche.
Ich wusch ihm von Zeit zu Zeit die Spitzen seine Schwung- und Schwanzfedern rein, weil er dieselben stets beschmutzte. Dabei wurde er in einen Wassertrog gesetzt und tüchtig eingenäßt. Diese Wäsche schien ihm entschieden das unangenehmste zu sein, was ihm geschehen konnte; er gebärdete sich jedesmal, wenn er gewaschen wurde, geradezu unsinnig und lernte den Trog sehr bald fürchten. Wenn er dann aber wieder trocken war, schien er sich höchst behaglich zu fühlen und es sehr gern zu sehen, daß ich ihm seine Federn wieder mit ordnen half.
In dieser Weise lebte er bis Ende Mai gleichmäßig fort. Er fraß allein, auch Knochen mit, niemals aber Geflügel. Ich versuchte es mit allerlei Vögeln; er erhielt Tauben, Haus- und Rothühner, Enten, Blaudrosseln, Alpenkrähen, Blauröcke, gleichviel. Selbst wenn er sehr hungrig war, ließ er die Vögel liegen; stopfte ich ihm Vogelfleisch mit oder ohne Federn ein, so spie er es regelmäßig wieder aus. Dagegen verschlang er Säugetiere jeder Art ohne Widerstreben. Ich habe diesen Versuch unzählige Male wiederholt: das Ergebnis blieb immer dasselbe.«
Eine von Girtanner vorgenommene Vergleichung der von ihm an seinem Pfleglinge und von früheren Beobachtern an andern gefangenen schweizerischen Bartgeiern gesammelten Erfahrungen ergibt, daß sich junge, in die Gefangenschaft geratene Geieradler sehr zu ihrem Vorteile von alten unterscheiden. Diese erweisen sich als träge, dumm und trotzig und wollen nie in ein trauliches Verhältnis zu Menschen treten, wogegen die jungen nicht nur viel beweglicher sind, sondern auch weit mehr Fassungsgabe bekunden, sich geistig und körperlich selbständiger zeigen, mit ihren Pflegern in vertraulicheren Verkehr treten und deshalb weit richtigere Einblicke in ihr Betragen in der Freiheit erlauben als die alten. Einer, den Baldenstein sieben Monate lang pflegte, benahm sich im wesentlichen ebenso wie der vorhin geschilderte und faßte dieselbe Zuneigung zu seinem Gebieter. So wußte er sein Bedürfnis nach Bädern aufs deutlichste dadurch anzuzeigen, daß er sich mit den Flügeln schwimmend und mit dem Schwanze hin und herfegend auf dem Boden niederkauerte und alle Bewegungen eines badenden Vogels so deutlich darstellte, daß Waldenstein sofort eine gefüllte Wanne holte, in die sich der Vogel ungesäumt stürzte und nun alle Bewegungen, die er vorher im Trockenen ausgeführt, jetzt mit dem größten Behagen im Wasser wiederholte, sich im Bade fast völlig untertauchend und gänzlich einnässend. Neckte Baldenstein seinen Vogel zu arg, so machte dieser unschädliche Scheinangriffe auf seinen Gebieter, so innig er sich diesem auch angeschlossen und so bestimmt er auch in ihm seinen Wohltäter erkannt hatte. Wenn er auf dem Tische stand, war sein Kopf in gleicher Höhe mit dem seines Herrn, und beide hielten Unterredungen miteinander. Der Bartgeier krabbelte seinem Pfleger mit dem Schnabel im Backenbarte herum oder steckte ihn beim Handgelenk in die Ärmel und ließ dabei sein gemütliches »Gich« hören. Baldenstein dagegen konnte ihn streicheln wie er wollte, ohne daß er jemals Mißtrauen zeigte. Fremden gegenüber benahm er sich ganz anders.
Der Schaden, den der freilebende Bartgeier dem Menschen zufügt, ist gering, läßt sich mindestens mit dem vom Steinadler verursachten nicht vergleichen. Im Süden, wo Aas und Knochen, Schildkröten und andere kleine Tiere ihn mühelos ernähren, erlaubt er sich nur ausnahmsweise Übergriffe auf menschliches Besitztum. Von einem erheblichen Nutzen, den er stiften könnte, ist freilich ebensowenig zu reden, es sei denn, daß man der Tuaregs gedenken wollte, die diesen, bei ihnen gemeinen Vogel seines Fleisches und Fettes wegen erlegen, um ersteres zu verspeisen und letzteres als Mittel gegen den Biß giftiger Schlangen zu verwenden. Da, wo der Bartgeier häufig auftritt, führt er ein ziemlich unbehelligtes Leben. Man verfolgt ihn nicht, wenigstens nur, um der Jagdlust Genüge zu tun, nicht aber aus Gründen der Notwehr. Demungeachtet bleibt der Mensch der schlimmste Feind des Vogels, denn er schädigt ihn, wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar durch weiter und weiter umsichgreifende Besitznahme derjenigen Gebiete, in denen er vormals ungehindert herrschte und noch heutigen Tages ein freies Leben führt. Über die Jagd selbst wie über den Fang ist wenig zu berichten. Wen der Zufall nicht begünstigt, wem nicht ein Horst die Jagd erleichtert, darf sich nicht verdrießen lassen, in der Nähe eines Aases tagelang zu lauern, wie wir es, jedoch vergeblich, in Spanien getan haben, oder aber wochenlang nacheinander an gewissen Gebirgszügen sich aufzustellen, in der Hoffnung, einen vorüberstreichenden Geieradler zu erlegen. Eher noch führt ein geschickt aufgestelltes Fuchseisen zum Ziele; doch muß dasselbe wohl befestigt werden, damit es der Vogel nicht losreißt und wegschleppt. Gefahr bringt die Jagd in keiner Weise. Auch verwundete Bartgeier denken nicht daran, sich dem Menschen gegenüber zur Wehr zu setzen, wie dies die Gänsegeier regelmäßig tun. Nach meinen eigenen Erfahrungen sträuben sie die Nackenfedern und sperren den Schnabel möglichst weit auf, versuchen mit diesem allerdings auch ihren Gegner zu packen, sind aber leicht gebändigt. Ihre Lebenszähigkeit ist sehr groß; nur ein gut angebrachter Schuß tötet sie augenblicklich. Ich schoß einem fliegenden eine Kugel durch den Leib, die das Zwerchfell und die ganze Leber zerrissen und neben den Lendenwirbeln ihren Ausgang gefunden hatte. Der Vogel stürzte zwar sofort zum Boden hernieder, lebte aber noch volle sechsunddreißig Stunden, bevor er an Eitervergiftung starb.
*
Die Altweltsgeier ( Vulturinae), die eine zweite Familie bilden, sind plumper gebaut als die Geieradler und die plumpsten aller Raubvögel überhaupt. Unter allen Mitgliedern der Gruppe hat kein einziger eine so große Berühmtheit erlangt wie der Schmutzgeier, der seit uralter Zeit bekannte und beschriebene Kot- und Maltesergeier, die »Henne der Pharaonen«, und wie er sonst noch benamset sein mag ( Neophron percnopterus). Er ist es, dessen Bildnis die altägyptischen Bauwerke zeigen, der von den alten Ägyptern und den Hebräern als Sinnbild der Elternliebe gefeiert wurde und heutigentages noch wenigstens keine Mißachtung auf sich gezogen hat. Er unterscheidet sich von allen bekannten Arten seiner Familie durch seine rabenähnliche Gestalt, die langen, ziemlich spitzen Schwingen, den langen, abgestuften Schwanz und die Art und Weise der Befiederung. Der Schnabel ist sehr in die Länge gestreckt, die Wachshaut über mehr als die Hälfte desselben ausgedehnt, der Haken des Oberschnabels lang herabgekrümmt, aber zart und unkräftig, der Fuß schwach, die Mittelzehe fast ebensolang als der Lauf, der Fang mit mittellangen, schwach gebogenen Nägeln bewehrt. Im Fittiche überragt die dritte Schwinge alle übrigen; die zweite ist länger als die vierte, die sechste länger als die erste. Im Schwanze sind die seitlichen Federn nur zwei Drittel so lang als die äußeren. Das reiche Gefieder besteht aus großen und langen Federn, die sich im Nacken und am Hinterhalse noch mehr verlängern, zugleich auch verschmälern und zuspitzen. Gesicht und Kopf bleiben unbefiedert. Ein schmutziges Weiß, das in der Hals- und Oberbrustgegend mehr oder weniger in das Dunkelgelbe spielt, auf Rücken und Bauch aber reiner wird, herrscht vor; die Handschwingen sind schwarz, die Schulterfedern graulich. Der Augenstern ist rotbraun oder licht erzgelb, der Schnabel an der Spitze hornblau, im übrigen wie die nackten Kopfteile und der Kropfflecken lebhaft orangegelb, die Kehlhaut etwas lichter als der Unterschnabelrand. Die Länge des Weibchens beträgt siebzig, die Breite einhundertundsechzig, die Fittichlänge fünfzig, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Zentimeter. Männchen habe ich zufällig nicht gemessen.
Der Schmutzgeier wird unter den deutschen Vögeln mit aufgezählt, weil er einige Male in unserem Vaterlande erlegt worden ist. Häufiger kommt er in der Schweiz vor, wie schon der alte Geßner angibt; in der Nähe von Genf hat sogar ein Paar gehorstet. Weiter nach Süden hin tritt er in namhafterer Menge auf. Von Mittelägypten an südlich wird er häufig, in Nubien ist er einer der gemeinsten Raubvögel. Dasselbe gilt für Mittel- und Südafrika, jedoch unter Maßgabe, daß der Schmutzgeier als entschiedener Freund morgenländischen Getriebes betrachtet werden muß. So häufig er sich allerorten findet, wo der Morgenländer im weitesten Sinne des Wortes sich angesiedelt hat, so einzeln tritt er in andern Gegenden auf. Er bewohnt in der Tat ganz Afrika, von der Nordgrenze an bis zum äußersten Süden, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Küstengebiete des Westens, woselbst er bisher nur auf den Inseln des Grünen Vorgebirges beobachtet wurde, ist jedoch nicht allein in den Küstengebieten des Roten Meeres, sondern auch im tieferen Innern oder überall da, wo der Neger lebt, eine seltene Erscheinung und meidet größere Waldungen, die sein Vetter, der Kappengeier, besucht, fast gänzlich. In West- und Südasien haust er in Kleinasien, Syrien, Palästina, Arabien, Persien, Nepal, Afghanistan, den Himalajaländern, in Nord- und Mittelindien, fehlt dagegen im Süden des Landes und ebenso weiter nach Osten hin, insbesondere in China, durchaus.
Das schmutzige Handwerk, das dieser Geier betreibt, hat Vorurteile erzeugt, die selbst von unsern tüchtigsten Naturforschern geteilt werden. »Es möchte schwerlich einen Vogel geben«, sagt Naumann, »dessen widerliches Äußere seinen Sitten und seiner Lebensweise so vollkommen entspräche als diesen. Das kahle Gesicht des kleinen Kopfes, der vorstehende nackte Kropf, die lockere Halsbefiederung, das stets beschmutzte und abgeriebene Gewand nebst den groben Füßen sind nicht geeignet, einen vorteilhaften Eindruck auf den Beschauer zu machen. Dazu kommt noch, daß dem lebenden Vogel häufig eine häßliche Feuchtigkeit aus der Nase trieft, der Geier überhaupt einen Geruch, ähnlich dem unserer Raben ausdünstet, der so stark ist, daß ihn selbst der tote Balg nach Jahren und in einem fast zerstörten Zustande nicht verliert. Er ist ein trauriger und träger Vogel.« Ich bin fest überzeugt, daß Naumann anders geurteilt haben würde, hätte er den Schmutzgeier sooft wie ich lebend gesehen. Das Handwerk, das der Vogel betreibt, ist widerlich, nicht er selbst. Es ist durchaus nicht meine Absicht, ihn zu einem schönen und anmutigen oder liebenswürdigen Vogel stempeln zu wollen, eine angenehme Erscheinung aber ist er gewiß. Mir wenigstens hat er immer weit besser gefallen als die großen Arten seiner Zunft.
Der Schmutzgeier ist nur in Südeuropa scheu und vorsichtig. In ganz Afrika vertraut er dem Menschen, vorausgesetzt, daß er von der Mordsucht des Europäers noch nicht zu leiden gehabt hat. Er ist nichts weniger als ein dummer Vogel; denn er unterscheidet sehr genau zwischen dem, was ihm frommt, und dem, was ihm schadet, weiß sich auch, oft unter recht schwierigen Umständen, mit einer gewissen List sein tägliches Brot zu erwerben. Träge kann man ihn ebenfalls nicht nennen; er ist im Gegenteil sehr viel in Bewegung und gebraucht seine Schwingen oft stundenlang nur des Spieles halber. Hat er sich freilich satt gefressen, so sitzt auch er lange Zeit aus einer und derselben Stelle. Im Gehen ähnelt er unserm Kolkraben; im Fliegen erinnert er einigermaßen an unsern Storch, aber auch wieder an den Geieradler, nur daß er langsamer und minder zierlich fliegt als dieser. Er verläßt mit einem Sprung den Boden, fördert sich durch einige langsame Flügelschläge und streicht dann rasch ohne Flügelbewegung dahin. Ist das Wetter schön, so erhebt er sich mehr und mehr, zuweilen, der Schätzung nach, bis in Luftschichten von tausend bis zwölfhundert Meter Höhe über dem Boden. Zu seinen Ruhesitzen wählt er sich, wenn er es haben kann, Felsen; die Bäume meidet er so lange als möglich, und in großen Waldungen fehlt er gänzlich. Ebenso häufig als auf Felsen, sieht man ihn auf alten Gebäuden fußen, in Nordafrika, Indien und Arabien auf Tempeln, Moscheen, Grabmälern und Häusern. Mit seinen Familienverwandten teilt er Geselligkeit. Einzeln sieht man ihn höchstselten, paarweise schon öfter, am häufigsten aber in größeren oder kleineren Gesellschaften. Er vereinigt sich, weil sein Handwerk es mit sich bringt, mit andern Geiern, aber doch immer nur aus kurze Zeit; sobald die gemeinsame Tafel aufgehoben ist, bekümmert er sich um seine Verwandten nicht mehr. In Südägypten und Südnubien bemerkt man zahlreiche Flüge von ihm, die sich stundenlang durch prächtige Flugübungen Vergnügen, gemeinschaftlich ihre Schlafplätze aussuchen und auf Nahrung ausgehen, ohne daß man jemals Zank und Streit unter ihnen wahrnimmt. In Gesellschaft der großen Geier sitzt er entsagend zur Seite und schaut anscheinend ängstlich deren wüstem Treiben zu.
Der Schmutzgeier ist kein Kostverächter. Er verzehrt alles, was genießbar ist. Man nimmt gewöhnlich, aber mit Unrecht an, daß Aas auch für ihn die Hauptspeise sei; der Schmutzgeier ist weit genügsamer. Allerdings erscheint er auf jedem Aase und versucht, soweit seine schwachen Kräfte erlauben, sich zu nähren, pickt die Augen heraus, öffnet am After eine Höhle und bemüht sich, die Eingeweide herauszuzerren, oder wartet, bis die großen Geier sich gesättigt haben, und nagt dann die Knochen ab, die sie übrig ließen, aber ein derartiger Schmaus gehört doch zu seinen Festgerichten. Größere Ströme oder die Küste des Meeres bieten ihm schon mehr, sei es, daß sie ein Aas oder wenigstens tote Fische an den Strand schwemmen, ihn mindestens zu allerlei niederem Seegetier verhelfen. Endlich liefert ihm auch allerlei Kleingetier dann und wann eine Mahlzeit. Räuberisch überfällt er Ratten, Mäuse, kleine Vögel, Eidechsen und andere Kriechtiere; diebisch plündert er Nester mit Eiern, und geschickt fängt er auch Heuschrecken auf Wiesen und Triften. Mein Bruder beobachtete von einem gefangenen Schmutzgeier, daß er augenblicklich auf seine gezähmten Vögel losging und sie eifrigst verfolgte. Einen Fettammer, den er glücklich erlangte, tötete er mit einem einzigen Schnabelhiebe, hielt ihn fest und verzehrte ihn auf der Stelle. Allein weder seine Räubereien noch seine Diebereien können für seine Ernährung besonders ins Gewicht fallen. Zum Glück für ihn weiß er sich anders zu behelfen. In ganz Afrika, ja in Südspanien schon bildet Menschenkot seine hauptsächlichste Nahrung. Fast die ganze Bevölkerung ist gezwungen, zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse gewisse Plätze aufzusuchen, die für Wiedehopf und Schmutzgeier gleich ergiebig werden. Hier nun findet sich der letztere ein, unbekümmert um das Treiben der Menschen, die in seiner baldmöglichst beginnenden Tätigkeit zwar etwas überaus Verächtliches, in dem Vogel selbst aber doch einen Wohltäter sehen. Daß es in Indien nicht anders ist, haben wir durch Jerdon erfahren. In der Nähe größerer Ortschaften Afrikas ist er ein regelmäßiger Gast bei den Schlachtplätzen, die außerhalb der Städte zu liegen pflegen. Hier sitzt er dicht neben dem Schlachter und lauert auf Fleisch und Hautfetzen oder auf die Eingeweide mitsamt deren Inhalt, die sein Brotgeber ihm zuwirft. Im Notfalle klaubt er blutgetränkte Erde auf. Den europäischen Beobachter fesselt besonders, wahrzunehmen, wie richtig er den Menschen beurteilt, wie genau er ihn kennt. Eines gewissen Schutzes oder, richtiger gesagt, gleichgültiger Duldung gewiß, treibt er sich unmittelbar vor den Haustüren herum und geht seiner Nahrung mit derselben Ruhe nach wie ein Hausgeflügel oder mindestens wie eine unserer Krähenarten. Ich habe beobachtet, daß er, wenn wir im Zelte Vögel abbalgten, bis zu den Zeltpflöcken sich heranschlich, uns aufmerksam zusah und unter unsern Augen die Fleischstücke auffraß oder die Knochen benagte, die wir ihm zuwarfen. Bei meinen Wüstenreisen habe ich ihn wirklich lieb gewonnen. Er ist es, der der Karawane tagelang das Geleite gibt; er ist nebst den Wüstenraben der erste Vogel, der sich am Lagerplatze einfindet und der letzte des Reisezuges, der ihn verläßt.
Über das Brutgeschäft sind erst in der Neuzeit sichere Beobachtungen angestellt worden. Bolle beobachtete, daß fünf bis sechs Horste dicht nebeneinander in den zerklüfteten Wänden eines tiefen Tales standen. »Sie lieben es«, sagt er, »nachbarlich nebeneinander zu horsten. Wo eine steile Felswand ihnen bequeme Nistplätze darbietet, da siedeln sie sich an, ohne auf die größere oder geringere Wärme der Örtlichkeit besonders Rücksicht zu nehmen. Die Masse des neben und unter den Nestern sich anhäufenden Kotes macht, daß dieselben weithin sichtbar werden und dem Beobachter mit Leichtigkeit ins Auge fallen. Die Geier scheinen ihre Sicherheit durchaus nicht durch eine versteckte Lage begünstigen zu wollen, sondern sich einzig und allein auf die Unzugänglichkeit der Orte, die sie wählen, zu verlassen.« In Spanien tritt der Vogel so einzeln auf, daß ein gesellschaftliches Brüten kaum möglich ist; in Ägypten sieht man die Horste an den steilen Wänden der Kalkfelsen zu beiden Seiten des Nils, und zwar, wenn die Örtlichkeit es erlaubt, oft mehrere nebeneinander, regelmäßig aber an Stellen, zu denen man nur dann gelangen kann, wenn man sich an einem Seile von oben herabläßt. Das habe ich nicht getan. Heuglin, der auch die Pyramiden als Standort der Nester angibt und letztere untersucht zu haben scheint, bemerkt, daß sie von dem Vogel selbst gebaut werden, ziemlich groß und dicht sind und aus dürren Reisern und Durrahstengeln bestehen, wogegen Hartmann sagt, daß der große Horst aus Gras und Lumpen erbaut werde. Auch in Indien brütet der Schmutzgeier auf Felsen und Klippen, ebenso aber in großen Gebäuden, Pagoden, Moscheen, Gräbern, gelegentlich sogar auf Bäumen, baut hier wie da den Horst aus Zweigen und mancherlei Abfällen und kleidet die Mulde oft mit alten Lumpen aus. Ein besonders beliebter Brutplatz scheint, laut Alléon, die Stadt Konstantinopel zu sein, jedoch nur der von den Türken bewohnte Teil Stambuls und nicht das Fremdenviertel Pera. Dort nistet der Vogel ebenso auf den Zypressen wie auf den Moscheen, und zwar in so bedeutender Menge, daß der genannte die Anzahl der alljährlich ausfliegenden Jungen auf tausend Stück anschlägt. In Ägypten fällt die Brutzeit in die Monate Februar bis April, in Griechenland, nach Krüper, etwa in die Mitte des letztgenannten Monats. Doch erhielt Krüper auch Ende April und Anfang Mai noch frische Eier. Das Gelege enthält gewöhnlich zwei Eier; dreimal fand jedoch Krüper nur ein einziges. Die Eier sind länglich, hinsichtlich des Korns und der Färbung sehr verschieden, gewöhnlich auf gelblichweißem Grunde entweder lehmfarben oder rostbraun gefleckt und gemarmelt, einzelne auch wie mit blutschwarzen, größeren Flecken und Streifen überschmiert. Diese Flecke stehen zuweilen am dickeren, zuweilen am spitzeren Ende dichter zusammen. Das Weibchen sitzt sehr fest auf den Eiern und verläßt sie erst, wenn der störende Mensch unmittelbar vor dem Horste angelangt ist. Die Jungen, die anfänglich mit grauweißlichem Flaume bekleidet sind, werden aus dem Kropfe geatzt, sitzen lange Zeit am Horste und verweilen auch dann noch Monate in Gesellschaft ihrer Alten.
Jung eingefangene Schmutzgeier werden sehr zahm, folgen zuletzt ihrem Pfleger wie ein Hund auf dem Fuße nach und begrüßen ihn mit Freudengeschrei, sobald er sich zeigt. Auch alt gefangene gewöhnen sich bald ein und ertragen den Verlust ihrer Freiheit viele Jahre.
In Mittel- und Westafrika gesellt sich dem Schmutzgeier ein naher Verwandter ( Neophron pileatus), den wir Kappengeier nennen wollen. Er unterscheidet sich von jenem durch etwas kürzeren Schnabel, breitere Flügel, kürzeren, gerade abgestutzten Schwanz, wollige Befiederung der Hinterhals- und Nackenteile und geringere Ausdehnung der unbefiederten Stellen, da nur der Scheitel, die Wangen und der Vorderhals nackt sind. Ein sehr gleichmäßiges Dunkelerdbraun ist die vorherrschende Färbung des Gefieders; die weichen, sammetartigen Federn des Hinterkopfes und Halses sind graulichbraun, die kurzen, die den Kropf bekleiden, schmutzig weiß, die der Innenschenkel reiner weiß, die Handschwingen braunschwarz, die Steuerfedern schwarzbraun. Die Iris ist braun, der Schnabel hornblau, die Wachshaut lebhaft violett, der nackte Kopf bläulichrot, der Fuß lichtbleigrau. Die Länge beträgt dreiundsechzig bis achtundsechzig, die Breite einhundertsiebenundfünfzig bis einhundertneunundsechzig, die Fittichlänge fünfundvierzig bis fünfzig, die Schwanzlänge dreiundzwanzig bis fünfundzwanzig Zentimeter; erstere Maße gelten für das Männchen, letztere für das Weibchen.
In Mittel- und Südafrika hat man den Kappengeier ziemlich allerorten, in Nordafrika dagegen ebensowenig wie in Asien und Europa gefunden. In Westafrika ist er, soviel bis jetzt bekannt, der einzige Geier, der das Küstengebiet belebt, in Habesch häufiger als alle dort lebenden Verwandten, wenigstens viel häufiger als der Schmutzgeier. Man kann ihn ein halbes Haustier nennen. Er ist mindestens ebenso dreist wie unsere Nebelkrähe, ja beinahe so wie unser Sperling. Ungescheut läuft er vor der Haustür auf und nieder, macht sich in unmittelbarer Nähe der Küche zu schaffen und fliegt, wenn er ausruhen will, höchstens auf die Spitze eines der nächsten Bäume. Am Morgen harrt er auch vor den Hütten der sich entleerenden Menschen, schaut sachkundigen Auges der hierbei zu entfaltenden, für beide Teile ersprießlichen Tätigkeit zu und ist sofort bei der Hand, um die verunreinigte Stelle wieder zu säubern. Auf jedem Schlachtplatze ist er ein ständiger Gast; niemals aber nimmt er etwas weg, was ihm nicht zukommt, niemals erhebt er ein Küchlein oder ein anderes lebendes, kleines Haustier; seine Hauptnahrung besteht in den Abfällen der Küche und des menschlichen Leibes. Beim Aase erscheint er ebenfalls und benimmt sich hier genau ebenso wie sein Gesippe. Abweichend von seinen großen Verwandten verläßt er seinen Schlafplatz mit der Sonne und fliegt ihm erst mit einbrechender Nacht wieder zu. Für die Nachtruhe wählt er sich immer solche Bäume, die möglichst weit von allem menschlichen Treiben entfernt stehen, über solchen Schlafplätzen führt er erst einen kurzen Flugreigen aus, fällt sodann mit zusammengelegten Flügeln nach unten und setzt sich in Gesellschaft von anderen auf den gewohnten Baum. In seiner Haltung ist der Kappengeier ein sehr schmucker Vogel und ein echter Geier.
Der Kappengeier wird ebenso wenig verfolgt wie seine übrigen Verwandten. Seine Jagd verursacht keine Schwierigkeiten, denn da, wo er vorkommt, vertraut er dem Menschen. Auch der Fang ist einfach genug. Ich habe einen dieser Vögel längere Zeit lebend besessen und mich wirklich mit ihm befreundet. Abgesehen von seiner natürlichen Hinneigung zu unreinlichen Stoffen, war er ein schmucker und netter Gesell, der mich bald kennenlernte und bei meinem Erscheinen stets lebhafte Freude an den Tag legte.
*
Die Gänsegeier ( Gyps) kennzeichnen sich vor allem durch ihren langen, gänseartigen Hals von gleichmäßiger Stärke, der ohne Absatz an den länglichen Kopf sich anschließt und spärlich mit weißlichen, flaumartigen Borsten bedeckt ist. Bei jungen Vögeln sind alle Federn, namentlich die der Halskrause, lang, junge Gänsegeier also an ihrer langen und flatternden, alte hingegen an ihrer kurzen, zerschlissenen und haarartigen Krause mit untrüglicher Sicherheit zu erkennen. Auch hinsichtlich der Färbung findet eine mehr oder minder erhebliche Umänderung des Gefieders statt, wiederum besonders an den Federn der Krause, die bei jungen Vögeln regelmäßig dunkel fahlbraun, bei alten aber ebenso regelmäßig weiß oder gelblichweiß gefärbt sind.
Der Gänsegeier ( Gyps fulvus) erreicht eine Länge von 1,12, eine Breite von 2,56 Meter bei 68 Zentimeter Fittich- und 30 Zentimeter Schwanzlänge. Das Gefieder ist sehr gleichmäßig lichtfahlbraun, auf der Unterseite dunkler als auf der Oberseite, jede einzelne Feder lichter geschaftet. Die breiten, weiß gesäumten großen Flügeldeckfedern bilden eine lichte Binde auf der Oberseite; die Schwingen erster Ordnung und die Steuerfedern sind schwarz, die Schwingen zweiter Ordnung graubraun, auf der Außenfahne breit fahl gerandet. Das Auge ist lichtbraun, die Wachshaut dunkelblaugrau, der Schnabel rostfarben, der Fuß lichtbräunlichgrau.
Der Gänsegeier ist häufig in Siebenbürgen, Südungarn und auf der ganzen Balkanhalbinsel, in Ost-, Süd- und Mittelspanien, auf Sardinien und Sizilien, kommt dagegen auf der italienischen Halbinsel sehr selten und immer nur zufällig vor, verbreitet sich andererseits mehr und mehr in Krain, Kärnten und dem Salzkammergute, allmählich die Stelle des Geieradlers einnehmend, und verfliegt sich nicht allzuselten nach Deutschland. Als nördlichster Brutplatz dürften die Salzburger Alpen zu betrachten sein. Noch häufiger als in Siebenbürgen lebt er in Ägypten und Nordnubien, in Tunis, Algier und Marokko, und ebenso kommt er in Nordwestasien bis zum Himalaja vor.
In Mittelafrika ersetzt ihn der Sperbergeier ( Gyps rüppellii), wohl das schönste Mitglied der Sippe und deshalb einer kurzen Beschreibung wert. Nach eigenen Messungen beträgt die Länge 1, die Breite 2,25 Meter, die Fittichlänge 63, die Schwanzlänge 25 Zentimeter. Beim alten Vogel sind mit Ausnahme der Schwingen und Schwanzfedern alle Federn dunkelgraubraun, geziert mit einem schmutzigweißen, halbmondförmigen, mehr oder minder breiten Saume am Ende, wodurch das Kleid buntscheckig wird. Die durchschimmernde nackte Haut des spärlich bekleideten Halses ist graublau, vorn und an den Seiten des Unterhalses ins Fleischrote übergehend, die nackten Schulterflecken bläulichfleischrot gesäumt. Das Auge ist silbergrau, der Schnabel an der Wurzel gelb, an der Spitze bleifarben, die Wachshaut schwarz, der Fuß dunkelbleigrau.
Alle Gänsegeier scheinen vorzugsweise Felsenbewohner zu sein; deshalb trifft man sie am häufigsten in der Nähe von Gebirgen, die geeignete steile Wände haben. Unsern europäischen Gänsegeier habe ich nur in der Fruschkagora auf Bäumen ruhen sehen; dagegen bäumen andere Arten, insbesondere die Sperbergeier, nicht selten und verbringen auf Bäumen die Nacht.

Gänsegeier ( Gyps fulvus)
Die Lebensweise der Gänsegeier stimmt in vieler Hinsicht mit der anderer Arten der Familie überein; doch unterscheiden sie sich in andern Stücken nicht unwesentlich von den noch zu erwähnenden altweltlichen Verwandten. Ihre Bewegungen sind leichter und zierlicher als bei diesen, und namentlich beim Herabsenken aus großer Höhe benehmen sie sich durchaus eigentümlich, weil sie fast mit der Leichtigkeit eines Falken unter vielfachen Schwenkungen herabschweben, während sich die andern Arten aus einer bedeutenden Höhe ohne Flügelbewegungen herabfallen lassen, bis sie fast den Boden berührt haben. Ihr Gang auf dem Boden ist so gut, daß sich ein Mensch anstrengen muß, wenn er einen laufenden Geier einholen will. Noch mehr, wenngleich nicht in gutem Sinne, zeichnet die Gänsegeier ihr Wesen aus. Sie sind die heftigsten, jähzornigsten und tückischsten Arten der Familie. Sie leben in großen Gesellschaften, gründen gemeinschaftlich Nistansiedlungen und vereinigen sich regelmäßig auch mit andern Arten der Familie; aber sie sind und bleiben immer die Störenfriede, die, die den meisten Streit erregen. Angeschossen wehren sie sich mit Mut und Ingrimm, gehen wie bissige Hunde auf den Mann, springen über einen halben Meter hoch vom Boden auf und schnellen ihren langen Hals unter vernehmlichem Schnabelklappen stets nach dem Gesicht des Gegners. Anfänglich flüchten die, die durch den Schuß flugunfähig wurden, im raschen Laufe, wobei sie sich mit den Flügeln nachhelfen, vor dem Menschen; ist dieser ihnen aber nahe gekommen, so drehen sie sich blitzschnell um, fauchen wie eine Eule und rollen wütend die Augen. Hat man sie glücklich gepackt, so krallen sie sich noch mit den Klauen fest und wissen diese, trotz ihrer Stumpfheit, nachdrücklich zu gebrauchen.
Beim Wegräumen eines Aases fressen sie vorzugsweise die Leibeshöhlen der toten Tiere aus. Einige Bisse schneiden ein rundes Loch in die Bauchwand, und in dieses nun stecken sie den langen Hals so tief hinein, als sie können. Die edleren Eingeweide werden hinabgewürgt, ohne daß sie den Kopf aus der Höhle hervorziehen, die Gedärme aber erst an das Tageslicht gefördert, durch heftige Bewegungen nach rückwärts herausgezerrt, dann mit einem Bisse durchschnitten und nun stückweise hinabgeschlungen. Es versteht sich von selbst, daß bei derartiger Arbeit Kopf und Hals mit Blut und Schleim überkleistert werden und die Gänsegeier nach dem Schmause ein wahrhaft abschreckendes Bild gewähren. Ob auch sie über kranke und bezüglich verendende Tiere herfallen, lasse ich dahingestellt; die Araber klagen sie derartiger Übeltaten an, und auch die Hirten der südungarischen Gebirge erzählen dasselbe. Nach meinen Beobachtungen erscheinen sie erst in den Vormittagsstunden in ihrem Jagdgebiet und fallen vorzugsweise um die Mittagszeit auf das Aas.
»Die Brutzeit des Gänsegeiers«, so berichtet mein Bruder, »fällt in Spanien in die letzte Hälfte des Februar oder in den Anfang des März. Der Horst wird gewöhnlich in einer Felsenhöhle oder wenigstens unter einem überhängenden Felsen errichtet und besteht aus einer niedrigen Schicht nicht sehr starker Reiser. In diesen Horst legt das Weibchen ein weißes Ei von der Größe eines Gänseeies, mit dicker Schale, das es mit dem Männchen gemeinschaftlich bebrütet und zwar so, daß das Männchen in der Regel während der Vormittags- und ersten Nachmittagsstunden dem Brutgeschäfte obliegt, das Weibchen dagegen den übrigen Teil des Tages im Neste verweilt. Auf Bäumen horstet der Gänsegeier nie. An einem günstigen Brutplatze findet man immer mehrere Horste in einer Entfernung von etwa hundert bis zweihundert Schritte voneinander. Zu bemerken ist, daß die Nistgesellschaften an solchen Felswänden keineswegs ausschließlich aus Geiern bestehen, sondern daß die Geier ruhig neben und unter sich auch den Geieradler und Habichtsadler dulden, ja selbst dem Schwarzstorch gestatten, unmittelbar neben ihrem Horste sich anzusiedeln und zu nisten. Auf den Eiern sitzen sie ziemlich fest, kommen erst auf lautes Anrufen aus der Höhle hervor, stellen sich auf den Rand derselben und sehen sich neugierig nach dem Störer um, trippeln auch wohl, wenn dieser sich gut verborgen hatte, nach dem Neste zurück und verlassen letzteres überhaupt nur, wenn sie sich wirklich von der ihnen drohenden Gefahr überzeugt haben. Bei meinen Jagden in der Nähe des Escorial machte ich mir oft das Vergnügen, die brütenden Geier vom Neste aufzurufen. Sie erschienen auf jedesmaligen Anruf, schauten sich sorgfältig nach allen Seiten um und zogen sich dann, wenn sie mich nicht gewahren konnten, wieder in das Nest zurück. Ein nach ihnen abgefeuerter Schuß scheucht freilich die ganze brütende Gesellschaft auf, und jeder einzelne sucht mit raschen Flügelschlägen das Weite. Dann währt es lange Zeit, ehe sie sich wieder sehen lassen; man späht vergeblich nach allen Seiten hin, die Gegend erscheint mit einem Male wie ausgestorben, und von den gewaltigen Vögeln ist auch nicht das geringste mehr zu entdecken. Erst nach ungefähr einer halben Stunde erscheint einer nach dem andern. Jeder streicht mehrere Male am Nistplatze vorbei, hält sorgfältig Umschau und schießt dann plötzlich, aber mit einer gewissen Heimlichkeit, nach dem Horste hernieder, verweilt noch eine Zeitlang vorn auf dem Felsenrande, späht nochmals vorsichtig und mißtrauisch in die Runde und schleicht sich nun erst wieder in das Innere seiner Felsenburg zurück. Man hat vielfach behauptet, daß diese Geier den das Nest bedrohenden Jäger mutig angreifen; diese Angabe entbehrt jedoch nach meinen Beobachtungen jeder Begründung. Noch ist es mir unbekannt, wie viele Tage der Bebrütung erforderlich sind, um das große Ei zu zeitigen; ich weiß nur, daß gegen Ende März bereits einzelne der Jungen ausgeschlüpft sind. Bezeichnend für diese Vögel, die niemals Wohlgerüche verbreiten, ist, daß nicht bloß das ausgeschlüpfte Junge, sondern schon das sich im Ei entwickelnde, ja selbst Dotter und Eiweiß heftig nach Moschus stinken. Das Ausblasen eines solchen Eies erfordert in der Tat die ganze Gleichmütigkeit eines begeisterten Naturforschers, und selbst dieser muß gewaltsam ankämpfen, um des aufsteigenden Ekels sich zu erwehren. Das Junge, das einem kleinen Wollklumpen gleicht, wird von beiden Alten mit vieler Liebe behandelt und sorgfältig geatzt, zuerst mit den durch die Verwesung bereits gänzlich zerfetzten Fleischteilen eines Aases, später mit kräftigerer Nahrung, freilich immer mit solcher, die derselben Quelle entstammt. Dank der reichlichen Fütterung wächst das Junge rasch heran, braucht aber immerhin drei Monate, bevor es flugfähig wird.«
Es ist eine Ausnahme, wenn ein Gänsegeier zahm wird. »Man sagt nicht zuviel«, meint mein Bruder, »wenn man behauptet, daß er immer in gewissem Grade gefährlich bleibe. Nur ein einziges Mal habe ich in dem Hofe eines Wirtshauses zu Bayonne einen wirklich gezähmten Gänsegeier gesehen. Er hing freilich an einer langen, dünnen Kette und war in seinen Bewegungen hierdurch wesentlich gehindert. Dieser Vogel kam auf den Ruf seines Pflegers von der Stange herabgeflogen, näherte sich vertraulich dem Manne und duldete sogar, daß dieser ihn zwischen die Beine nahm und ihm Kopf und Hals und Rücken streichelte. Mit den im Wirtshause befindlichen Hunden lebte er ebenfalls in größter Einigkeit.«
*
Die Schopfgeier ( Vultur) unterscheiden sich von den Gänsegeiern durch kräftigeren Leib, kürzeren, stärkeren Hals, größeren Kopf mit kräftigerem Schnabel und breitere Flügel. Europa beherbergt einen Vertreter dieser Sippe, den Kutten- oder Mönchsgeier ( Vultur monachus). Es ist der größte Vogel unseres Erdteils. Die Länge des Männchens beträgt nach eigenen Messungen 1,1 die Breite 2,22 Meter, die Fittichlänge 76, die Schwanzlänge 40 Zentimeter. Das Weibchen ist noch um 4 bis 6 Zentimeter länger und um 6 bis 9 Zentimeter breiter. Das Gefieder ist gleichmäßig dunkelbraungrau, das Auge braun, der Schnabel an der Wachshaut blau, stellenweise rötlich, sodann lebhaft violett, an der Spitze aber blau, der Fuß fleischfarben, ins Violette spielend, der Hals, soweit er nackt, licht bleigrau, ein unbefiederter Ring ums Auge violett. Der junge Vogel ist dunkler; sein Gefieder hat mehr Glanz, und die Flaumfedern am Scheitel sind schmutzig weißlichbraun.
Der Kuttengeier kommt in Spanien, auf Sardinien und allen Gebirgen der Balkanhalbinsel sowie in Slavonien, Kroatien und den Donautiefländern, nach Norden hin bis zur Fruschkagora, Wodzickis Angabe zufolge sogar bis zu den Karpathen, als Brutvogel vor. Von hier aus verbreitet er sich über einen großen Teil Asiens bis China und Indien. Afrika, die Atlasländer und einen Teil der Westküste ausgenommen, bewohnt er nicht; im nördlichen Teil des Niltales zeigt er sich jedoch dann und wann einmal. Nach Norden hin hat er sich bis Dänemark verflogen. In Deutschland ist er wiederholt erlegt worden; seiner Flugkraft verursacht eine Reise aus Ungarn bis in unser Vaterland keine Schwierigkeiten.

Bartgeier ( Gypaëtus barbatus) Kuttengeier ( Vultur monachus)
Nach meinen Beobachtungen, die mit denen anderer Forscher übereinstimmen, tritt der Kuttengeier regelmäßig seltener als der Gänsegeier auf; nur für Ungarn scheint das Gegenteil zu gelten. In Südspanien sieht man ihn einzeln oder in kleinen Flügen von drei bis fünf. Diese fallen mit den Gänsegeiern auf das Aas, gebärden sich hier aber viel ruhiger und anständiger als letztere. Ihr Benehmen steht im vollsten Einklang zu dem großen, wohlgebildeten Kopfe. Die Bewegungen sind gemessener als bei den Gänsegeiern, aber, falls dies möglich, ausdauernder und gleichmäßiger. Selbst das Flugbild unterscheidet sich von dem des Gänsegeiers, einerseits weil es durch die verhältnismäßig breiteren und etwas mehr zugespitzten Flügel und den längeren Schwanz dem eines großen Edeladlers ähnelt, andererseits aber dadurch auffällt, daß die Spitzen der Fittiche ein wenig nach oben gebogen, vom Gänsegeier dagegen gerade getragen werden. Die Haltung ist edler, mehr adlerartig, und der Blick des Auges hat durchaus nichts Tückisches, sondern höchstens etwas Feuriges und Kluges. Bei dem Schmause verzehren die Kuttengeier zunächst die Muskelteile, eines Tieres Eingeweide dagegen nur dann, wenn sie kein besseres Fleisch haben. Auch Knochen werden von ihnen verschlungen. Nach einer brieflichen Mitteilung Lázárs stimmen alle Gebirgsjäger Siebenbürgens darin überein, daß der Kuttengeier auch lebende Tiere ergreife und töte. Beweisend dafür ist eine Beobachtung meines Bruders. »Ich hatte«, schreibt er mir, »eine junge Ziege angebunden, um Geieradler anzulocken. Plötzlich beginnt dieselbe wie toll hin und her zu springen, soweit der Strick ihr erlaubt. Ich höre ein starkes Brausen in der Luft und hoffe schon, einen Bartgeier vor mir zu haben, erstaune aber nicht wenig, als ich einen Kuttengeier erblicke, der mit ausgestreckten Fängen dicht über dem Boden dahinsaust und auf die Ziege stößt. Rasch trete ich aus meinem Versteck hervor und kann eben noch verhindern, daß der Geier das geängstigte Tier ergreift.«
»Der Kuttengeier«, berichtet mein Bruder ferner, »nistet nicht wie der fahle oder Gänsegeier in Gesellschaften, sondern einzeln und, in Spanien wenigstens, nur auf Bäumen. Sein umfangreicher Horst steht entweder auf dem starken Ast einer Kiefer oder auf dem breiten, buschigen Wipfel einer immergrünen Eiche, oft nicht höher, als drei bis vier Meter über dem Boden. Er besteht aus einer Unterlage von armstarken Knüppeln, auf die eine zweite Schicht dünnerer Stöcke folgt; erst auf dieser ruht die flache Nestmulde aus dünnen, dürren Reisern. In dieser findet man Ende Februar ein weißes, dickschaliges Ei, das an Größe das der Gänsegeier nicht übertrifft, demselben im Gegenteil häufig nachsteht; sein Längsdurchmesser beträgt etwa fünfundachtzig, sein Querdurchmesser achtundsechzig Millimeter. Ich habe stets nur ein Ei gefunden, und die Erfahrungen aller spanischen Jäger, die ich befragte, stimmen mit meiner Beobachtung überein. Das aus dem Ei geschlüpfte Junge ist mit dichtem, weißem, wolligem Flaum bekleidet und bedarf mindestens vier Monate bis zum Ausfliegen. Es wird von den Eltern sorgfältig mit Aas gekröpft, keineswegs aber so heldenmütig verteidigt, wie man gewöhnlich annimmt. Nähert man sich dem Horst, in dem sich ein Junges befindet, so umkreisen wohl die Geier den Platz, jedoch in bedeutender Entfernung, und kommen nie dem Jäger auf Schußweite heran.«
Als die Riesen der Familie dürfen die Ohrengeier angesehen werden. Die bekannteste Art dieser Untersippe ist der Ohrengeier ( Vultur auricularis). Die Länge des Männchens beträgt 1 bis 1,05, die Breite 2,7 bis 2,8 Meter, die Fittichlänge 69 bis 72, die Schwanzlänge 34 bis 36 Zentimeter; das Weibchen, dessen Maße ich nicht verzeichnet habe, ist noch erheblich größer. Fahlgraubraun ist die vorherrschende Färbung des Gefieders; die Schwingen und die Steuerfedern sind dunkler, die großen Flügeldeckfedern lichter gerandet. Sehr häufig stehen blaßfahle und gelbweiße Federn im Nacken und am Oberrücken. Der Ohrengeier, der sich wiederholt nach Europa verflogen haben soll, ist von Oberägypten an über ganz Afrika verbreitet und steigt im Hochgebirge bis zu viertausend Meter unbedingter Höhe empor. Er tritt seltener auf als seine Verwandten, kommt jedoch überall vor.
Der indische Vertreter des gewaltigen Vogels ist der Kahlkopfgeier ( Vultur calvus). Seine Länge beträgt, laut Jerdon, einundneunzig, die Fittichlänge sechzig, die Schwanzlänge fünfundzwanzig Zentimeter; der Vogel ist also erheblich kleiner als der Ohrengeier. Der Kopf, mit alleiniger Ausnahme der mit haarartigen Federn gebildeten, spärlich bekleideten Ohrgegend, Kinn, Kehle, Gurgel, Vorderhalsseiten und eine Stelle am innern Teil des Unterschenkels über dem Knie sind nackt. Alle nackten Teile sehen karminrot, bei Erregung blutrot aus. Die Iris ist dunkelbraun, der Schnabel hornschwarz, die Wachshaut dunkel, der Fuß hell karminrot. Das Verbreitungsgebiet des Vogels erstreckt sich über ganz Indien bis Burma.
Von Mittelnubien an südwärts vermißt man den Ohrengeier selten bei einem größeren Aas. Er scheut sich nicht vor dem Menschen und kommt, obgleich er sich nicht so zutraulich zeigt wie die kleineren Rabengeier, dreist bis in die Dörfer oder auf die Schlachtplätze der Städte. Auf dem Aas spielt er den Alleinherrscher und vertreibt alle übrigen Geier, vielleicht mit Ausnahme der bissigen Gänsegeier. Vier Ohrengeier fressen binnen fünf Minuten den größten Hund bis auf den Schädel und die Fußknochen rein auf. Von der Stärke eines Ohrengeiers habe ich mich oft überzeugt. Ein einziger Biß von ihm zerschneidet die dickste Lederhaut eines großen Tieres, und wenige Bisse genügen, um auf eine bedeutende Strecke die Muskeln bloßzulegen. Ich sah einen dieser Vögel eine ausgewachsene Ziege mit dem Schnabel packen und mit größter Leichtigkeit fortziehen.
Nach jeder Mahlzeit fliegt der Ohrengeier dem nächsten Wasser zu, trinkt und putzt sich dort, ruht aus, indem er sich wie ein Huhn in den Sand legt und behaglich sonnt, und fliegt dann kreisend, oft auf Strecken hin ohne Flügelschlag schwebend, seinem Schlafplatz zu. Zur Nachtruhe wählt er sich nicht immer die größten Bäume aus, sondern begnügt sich mit jedem, der ihm passend erscheint, oft mit einem kaum drei Meter hohen Mimosenstrauch. Hier sitzt er in sehr aufrechter Haltung, wie ein Mann, den Kopf dicht eingezogen, den Schwanz schlaff herabhängend. Am Morgen verweilt er wenigstens zwei Stunden nach Sonnenaufgang auf seinem Schlafplatz, und bis zum Auffliegen ist er so wenig scheu, daß man ihn unterlaufen und selbst mit Schrot herabschießen kann. Als ich das erstemal von Mensa zurückkehrte, traf ich in einem wegen des durchführenden Weges wenigstens einigermaßen belebten Tal eine Gesellschaft von etwa acht schlafenden Ohrengeiern an. Die Vögel saßen so fest, daß ich um ihren Schlafbaum herumreiten konnte, ohne sie aufzuscheuchen. Erst nachdem ich einen von ihnen niedergeschossen hatte, flogen sie auf, waren aber noch so schlaftrunken, daß sie schon nach einer Entfernung von ungefähr fünfhundert Schritten wieder aufbäumten. Auf dem Aase erscheinen sie nie vor zehn Uhr morgens und verweilen daselbst spätestens bis vier oder fünf Uhr nachmittags. Man erkennt sie an ihrem ruhigen, schönen Flug, namentlich aber daran, daß sie, wenn sie ein Aas gefunden haben, weit über hundert Meter senkrecht herabfallen, hierauf die Schwingen wieder breiten, die Ständer weit von sich strecken und sich dann vollends schief auf das Aas herabsenken. Hier halten sie sich, wie die Kuttengeier, vorzugsweise an die Muskeln; Eingeweide scheinen sie zu verschmähen.
Beim Fressen stellt sich der Ohrengeier auf seine gerade ausgestreckten Füße, legt alle Federn glatt und nimmt eine vollkommen wagerechte Stellung an. Das vor ihm liegende Fleischstück wird mit den Klauen festgehalten und dann mittels des Schnabels mit einer Kraft bearbeitet, die mit dem Riesenkopf durchaus im Einklang steht. Er verschlingt übrigens nur kleine Stückchen und nagt die Knochen sorgfältig ab. Im Zorne sträubt er alle Federn und faucht wie eine Eule; dabei rötet sich der nackte Fleck am Hinterkopf in auffallender Weise. Ärgert er sich mehr als gewöhnlich, so pflegt er das im Kropf aufbewahrte Fleisch auszubrechen; er frißt es aber auch, wenn die Ruhe eintritt, nach Art der Hunde, wieder auf. In einem größeren Gesellschaftsbauer benimmt er sich ebenso ruhig wie in der Freiheit. Er ist sich seiner Stärke bewußt und läßt sich nichts gefallen, wird aber niemals zum angreifenden Teil. Unser Klima scheint leicht von ihm ertragen zu werden, obgleich er Wärme in hohem Grade liebt. In unsern Tiergärten hält man die Ohrengeier Sommer und Winter im Freien. Sie frieren bei strenger Kälte allerdings und geben dies durch heftiges Zittern kund, erhalten dafür aber etwas mehr zu fressen als im Sommer und trotzen dann dem Winter.
*
Das ausfälligste Kennzeichen der neuweltlichen Geier besteht in den durchgehenden, großen, eiförmigen Nasenlöchern. Man erachtet dies Merkmal für wichtig genug, um darauf eine besondere Familie zu begründen, und wir wollen dieser Auffassung insofern Rechnung tragen, als wir die Neuweltsgeier in einer Unterfamilie ( Catharinae) vereinigen. Als ihre edelsten Glieder sehen wir die Kammgeier ( Sarcorhamphus) an. Die Merkmale liegen in dem verhältnismäßig gestreckten Leib und langen, rundlichen, seitlich zusammengedrückten, stark hakigen Schnabel, der beim Männchen an der Wurzel mit hohem Kamm, in der Kinngegend mit Hautlappen verziert ist, dem mittellangen Hals, den hohen und langzehigen Füßen, den langen, aber ziemlich schmalen Flügeln, dem langen Schwanze und dem verhältnismäßig kleinfederigen, lebhaft bunten Gefieder, das jedoch den Kopf und den Unterteil des Halses nicht bekleidet. Das Männchen übertrifft sein Weibchen an Größe.
Das Schicksal des Bartgeiers ist auch dem Kondor ( Sarcorhamphus gryphus) geworden. Ebenso wie jenen hat man ihn verkannt und verschrien, über ihn die wunderbarsten Sagen erzählt und geglaubt. Erst den Forschern unsers Jahrhunderts blieb es vorbehalten, seine Naturgeschichte von Fabeln zu reinigen. Humboldt, Darwin, d'Orbigny und J. J. von Tschudi verdanken wir so genaue Nachrichten über den bis zur Veröffentlichung ihrer Forschungen fabelhaften Vogel, daß wir uns gegenwärtig eines vollkommen klaren Bildes seiner Lebensweise versichert halten dürfen.
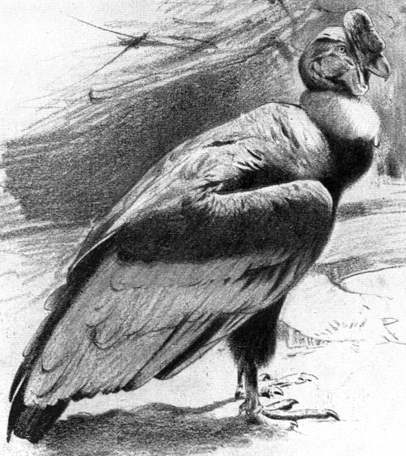
Kondor ( Sarkorhamphus gryphus)
Das Gefieder des ausgefärbten Kondors ist schwarz, schwach dunkelstahlblau glänzend; die Fittichfedern sind mattschwarz, die äußersten Deckfedern aller drei Ordnungen sowie die aus weichen, haarig wolligen aber ziemlich langen Federn bestehende Krause weiß, die Armschwingen an der äußeren Fahne weiß gesäumt. Dieser Saum wird bei den Arm- und Schulterfedern immer breiter und erstreckt sich zuletzt auch auf den inneren Fahnenteil, so daß die eigentlichen Schulterfedern ganz weiß und nur an der Wurzel schwarz sind. Hinterkopf, Gesicht und Kehle haben schwärzlichgraue, ein schmaler Hautlappen an der Kehle wie die beiden warzigen Hautfalten zu beiden Halsseiten des Männchens lebhafter rote, der Hals fleischrote, die Kropfgegend blaßrote Färbung. Das Auge ist feurig karminrot, bei zwei mir bekannten Männchen aber lichtgrünlich erzfarben, der Schnabel am Grunde und auf der Firste hornschwarz, an den Seiten und an der Spitze horngelb, der Fuß dunkelbraun. Nach Humboldts Messungen beträgt die Länge des Männchens 1,02, die Breite 2,75, die Fittichlänge 1,15 Meter, die Schwanzlänge 37 Zentimeter, die Länge des Weibchens 2,5, die Breite 24 Zentimeter weniger.
Das Hochgebirge Südamerikas ist die Heimat des Kondors. Er verbreitet sich von Quito an bis zum fünfundvierzigsten Grad südlicher Breite. In den Anden bevorzugt er einen Höhengürtel zwischen drei- bis fünftausend Meter über dem Meere; an der Magelhaensstraße und in Patagonien horstet er in steilen Klippen unmittelbar an der Küste. Auch in Peru und in Bolivia senkt er sich oft bis zu dieser Küste hernieder, ist aber, laut Tschudi, in der Höhe mindestens zehnmal so häufig als in der Tiefe. Nach Humboldt sieht man ihn oft über dem Chimborazo schweben, sechsmal höher als die Wolkenschicht, die über der Ebene liegt, siebentausend Meter über dem Meere.
Lebensweise und Betragen des Kondors sind im wesentlichen die anderer Geier. Er lebt während der Brutzeit paarweise, sonst in Gesellschaften, wählt sich steile Felszacken zu Ruhesitzen und kehrt, wie die Menge des abgelagerten Mistes beweist, regelmäßig zu ihnen zurück. Beim Wegfliegen erheben sich die Kondore durch langsame Flügelschläge; dann schweben sie gleichmäßig dahin, ohne einen Flügel zu rühren. Erspäht einer von ihnen etwas Genießbares, so läßt er sich hernieder, und alle übrigen, die dies sehen, folgen ihm rasch nach. »Es ist«, sagt Tschudi, »oft unbegreiflich, wie in Zeit von weniger als einer Viertelstunde auf einem hingelegten Köder sich Scharen von Kondoren versammeln, während auch das schärfste Auge keinen einzigen von ihnen entdecken konnte.« Waren sie im Fang glücklich, so kehren sie gegen Mittag zu ihren Felsen zurück und verträumen hier einige Stunden.
Der Kondor ist, ebenso wie andere Geiervögel, vorzugsweise Aasfresser. Humboldt berichtet, daß ihrer zwei nicht bloß den Hirsch der Anden und die Vicuña, sondern selbst das Gunaco und sogar Kälber angreifen, diese Tiere auch umbringen, verfolgen und solange verwunden, bis sie atemlos hinstürzen, und Tschudi bestätigt, daß die Kondore den wilden und zahmen Herden folgen und augenblicklich über ein verendetes Tier herfallen. Unter Umständen stürzen sie sich auf junge Lämmer, Kälber, selbst auf gedrückte Pferde, hie sich ihrer nicht erwehren können und es geschehen lassen müssen, daß sie das Fleisch rings um die Wunde wegfressen, bis sie in die Brusthöhle gelangen und jene endlich umbringen. Beim Ausweiden erlegter Vicuñas oder Andenhirsche sieht sich der Jäger regelmäßig von Scharen von Kondoren umkreist, die mit gieriger Hast auf die weggeworfenen Eingeweide stürzen und dabei nicht die geringste Scheu vor dem Menschen an den Tag legen. Ebenso sollen sie den jagenden Puma beobachten und die Überreste seiner Tafel abräumen. »Wenn die Kondore«, sagt Darwin, »sich niederlassen und dann alle plötzlich sich zusammen erheben, so weiß der Chilene, daß es der Puma war, der, ein von ihm erbeutetes und getötetes Tier bewachend, die Räuber hinwegtreibt.« In der Lammzeit der Schafe beobachtet der Kondor auch die Herden sehr genau und nimmt die Gelegenheit wahr, junge Ziegen oder Lämmer zu rauben. Am Meeresstrand nähren sich die Vögel von den durch die Flut ausgeworfenen großen Seesäugetieren, die Südamerika in großer Menge umschwärmen. Menschliche Wohnungen meiden sie, greifen auch nicht Kinder an. Oft schlafen solche in der freien Höhe, während ihre Väter Schnee sammeln, ohne daß diese irgendwelche Sorge bezüglich der Raublust des Kondors haben müßten. Indianer versichern einstimmig, daß letzterer dem Menschen nicht gefährlich wird. Bei der Mahlzeit verfahren die Kondore genau wie andere Geier. Vollgefressen wird der Kondor träge und schwerfällig, und auch er würgt, wenn er gezwungen auffliegen muß, die im Kropf aufgespeicherte Nahrung heraus.
Die Brutzeit des Kondors fällt in unsere Winter- oder Frühlingsmonate. Absonderliche Liebeserklärungen seitens des Männchens gehen der Paarung voraus. Wie ich an gefangenen Kondoren beobachtete, balzen beide Geschlechter förmlich, um ihre Gefühle auszudrücken. In Zeitabständen, die je nach der Höhe ihrer Erregung länger oder kürzer sein können, breiten sie die Flügel, biegen den vorher gestreckten und etwas aufgeblähten Hals nach unten, so daß die Schnabelspitze fast den Kropf berührt, lassen unter ersichtlichem Zittern der Zunge eigenartige, trommelnd murmelnde oder polternde Laute vernehmen, die mit so großer Anstrengung hervorgestoßen werden, daß Gurgel und Bauch in zitternde Bewegungen geraten, und drehen sich, langsam, mit kleinen Schritten trippelnd und mit den Flügeln zitternd, um sich selbst. Nach Verlauf einer, zwei oder drei Minuten stoßen sie den scheinbar eingepreßten Atem fauchend aus, ziehen den Hals zurück und die Flügel ein, schütteln ihr Gefieder, schmeißen wohl auch und nehmen ihre frühere Stellung wieder ein. Der andere Gatte des Paares nähert sich mitunter dem balzenden, streichelt ihn zärtlich mit Schnabel und Kopf, umhalst ihn förmlich und empfängt von ihm ähnliche Liebkosungen. Das ganze Liebesspiel währt ungefähr eine Minute, wird aber im Laufe einer Vormittagsstunde zehn- bis zwanzigmal wiederholt. Der Horst steht auf unzugänglichen Felsen, ist aber kaum Nest zu nennen; denn oft legt das Weibchen seine zwei Eier auf den nackten Boden. Die Eier, deren Längsdurchmesser hundertundacht, und deren Querdurchmesser zweiundsiebzig Millimeter beträgt, sind einfarbig und glänzend weiß. Häufiger als beim Bartgeier entschlüpfen zwei Junge. Sie kommen in graulichem Dunenkleid zur Welt, wachsen langsam, bleiben lange im Horst und werden auch nach dem Ausfliegen noch von ihren Eltern ernährt. Bei Gefahr verteidigen sie letztere mit großem Mut. »Im Mai 1841«, sagt Tschudi, »verirrten wir uns bei Verfolgung eines angeschossenen Hirsches in die steilen Kämme des Hochgebirges und trafen kaum anderthalb Meter über uns auf drei brütende Weibchen, die uns mit grausenerregendem Gekrächze und mit den drohendsten Gebärden empfingen, so daß wir fürchten mußten, durch dieselben von dem kaum sechzig Zentimeter breiten Felsenkamme, auf dem wir uns befanden, in den Abgrund gestoßen zu werden. Nur der schleunigste Rückzug auf einen breiteren Platz konnte uns retten.«
An gefangenen Kondoren sind sehr verschiedene Wahrnehmungen gemacht worden. Einzelne werden überaus zahm, andere bleiben wild und bissig. Häckel pflegte längere Zeit ihrer zwei, die höchst liebenswürdig waren. »Ihren Besitzer«, schreibt Gourcy, »haben sie bald sehr lieb gewonnen. Das Männchen schwingt sich auf seinen Befehl von der Erde auf die Sitzstange, von dieser auf seinen Arm, läßt sich von ihm herumtragen und liebkost sein Gesicht mit dem Schnabel aufs zärtlichste. Dieser steckt ihm den Finger in den Schnabel, setzt sich ihm fast frei auf den Rücken, zieht ihm die Halskrause über den Kopf und treibt mit ihm allerlei Spielereien, wie mit einem Hunde. Dabei wird das Weibchen über das verlängerte Fasten ungeduldig und zieht ihn am Rocke, bis es Futter bekommt. Überhaupt sind sie auf die Liebkosungen ihres Herrn so eifersüchtig, daß ihm oft einer die Kleider zerreißt, um ihn von dem andern, mit dem er spielt, wegzubringen.« Unter Mitgefangenen Familienverwandten wissen sie sich Achtung zu verschaffen und diese zu behaupten. Wenn es zum Beißen kommt, gebrauchen sie ihren Schnabel mit Geschicklichkeit, Gewandtheit und Kraft, so daß selbst die bissigen Gänsegeier ihnen ehrfurchtsvoll Platz machen.
»Wie der Kondor die Aufmerksamkeit der ersten Reisenden in Peru auf sich zog«, sagt Tschudi, »so tat es in Mexiko und Südamerika der Königsgeier. Er wird schon von Hernandez angeführt. Sein lebhaftes, zierliches Gefieder, wie es bei keinem andern Raubvogel vorkommt, verdient ihm den Namen Rex vulturum, König der Geier.« Zudem ist er, wie alle großen Arten seiner Familie, die mit kleineren verkehren, der Fürst und Beherrscher dieser letzteren, die er durch Stärke und Eigenwillen in höchster Achtung hält.

Königsgeier ( Sarkorhamphus papa)
Der Königsgeier ( Sarcorhamphus papa) ist 84 bis 89 Zentimeter lang, 1,8 Meter breit, der Fittich 52, der Schwanz 23 Zentimeter lang. Alte, ausgefärbte Vögel tragen ein wirklich prachtvolles Kleid. Die Halskrause ist grau, der Vorderrücken und die oberen Flügeldeckfedern sind lebhaft rötlichweiß, der Bauch und die Unterflügelfedern reinweiß, die Fittich- und Schwanzfedern tiefschwarz, die Schwingen außen grau gesäumt, Scheitel und Gesicht, die kurze, steife, borstenähnliche Federn bekleiden, fleischrot, rundliche Warzen, die das Gesicht hinter und unter dem Auge zieren, und eine wulstige Falte, die nach dem Hinterhaupt verläuft, dunkelrot, Hals und Kopf hellgelb. Das Auge ist silberweiß, der hohe, lappig geteilte Kamm, den auch das größere Weibchen trägt, schwärzlich, der Schnabel am Grunde schwarz, in der Mitte lebhaft rot, an der Spitze gelblichweiß, die Wachshaut gelb, der Fuß schwarzgrau. Junge Vögel sind einfarbig nußbraun, auf dem Rücken dunkler, am Steiß und an den Unterschenkeln weiß.
Durch Azara, Humboldt, Prinz von Wied, d'Orbigny, Schomburgk, Bonyan, Tschudi und andere sind wir über Aufenthalt und Lebensweise des Königsgeiers unterrichtet worden. Er verbreitet sich vom zweiunddreißigsten Grad südlicher Breite an über alle Tiefländer Südamerikas bis Mexiko und Texas und soll selbst in Florida vorgekommen sein. Im Gebirge findet er sich nur bis zu anderthalbtausend Meter über dem Meere. Sein eigentliches Wohngebiet sind die Urwaldungen oder die mit Bäumen bestandenen Ebenen. Auf den baumlosen Steppen und auf waldlosen Gebirgen fehlt er gänzlich. Er ist nach d'Orbigny höchstens halb so häufig als der Kondor. Die Nacht verbringt er, auf niederen Baumzweigen sitzend, meist in Gesellschaft, scheint auch zu gewissen Schlafplätzen allabendlich zurückzukehren; mit Anbruch des Morgens erhebt er sich und schwebt längs des Waldes und in dessen Umgebung dahin, um sich zu überzeugen, ob etwa ein Jaguar ihm die Tafel gedeckt habe. Hat er glücklich ein Aas erspäht, so stürzt er sich, sausenden Fluges aus bedeutender Höhe herab, setzt sich aber erst in geringer Entfernung nieder und wirft nur dann und wann einen Blick auf das leckere Mahl. Oft gewährt er seiner Gier, erst nach einer viertel oder halben Stunde freien Lauf; denn er ist immer vorsichtig und überzeugt sich vorher auf das sorgfältigste von der Sicherheit. Auch überfrißt er sich manchmal so, daß er sich kaum mehr bewegen kann. Ist sein Kropf mit Speise gefüllt, so verbreitet er einen unerträglichen Aasgeruch; ist jener leer, so duftet er wenigstens sehr stark nach Moschus. Nach beendigter Mahlzeit fliegt er einem hochstehenden, am liebsten einem abgestorbenen Baum zu und hält hier Mittagsruhe.
Azara erfuhr von den Indianern, daß der Geierkönig in Baumhöhlen niste; Tschudi bestätigt diese Angabe; Burmeister sagt, daß der Geier auf hohen Bäumen, selbst auf den Spitzen alter, abgestorbener, starker Bäume niste. Die zwei Eier, die das Gelege bilden, sollen weiß sein. Ausgeflogene Junge sieht man noch monatelang in Gesellschaft ihrer Eltern.
Gefangene Geierkönige lassen sich leicht zähmen, bekunden jedoch nur ihrem Pfleger gegenüber Anhänglichkeit, wogegen sie gegen fremde Leute oft recht unfreundlich sein und eine Bissigkeit zeigen können, die selbst dem Menschen Achtung vor ihren Waffen abringt.
*
Ganz Amerika wird bevölkert von den Rabengeiern ( Cathartes), die in Sein und Wesen wesentlich übereinstimmen. Der Truthahngeier ( Cathartes aura) kennzeichnet sich durch verhältnismäßig kurzen, aber dicken Schnabel mit weit vorgezogener Wachshaut, die die großen, länglichrunden, durchgehenden Nasenlöcher eben noch bedeckt, den in der oberen Hälfte nackten Hals, stufigen Schwanz und verhältnismäßig niedere Läufe. Der vorn nackte, hinten gewulstete Kopf, der außerdem noch eine vom Mundwinkel an über die Mitte des Scheitels verlaufende Wulst zeigt, ist vorn karmin-, hinten bläulich-, um die Augen blaß-, der nackte Hals fleischrot, der befiederte Teil des Halses wie der Oberrücken und die Unterseite schwarz, grünlich metallisch glänzend, jede Feder der Oberseite etwas lichter gerandet; die Schwingen sind schwarz, die Armschwingen mit breiten, verwaschenen fahlgrauen Rändern geziert, die Steuerfedern etwas dunkler als die Schwingen. Die Iris hat schwarzbraune, der Schnabel licht horngelbe, der Fuß weiße Färbung. Die Länge beträgt achtundsiebzig, die Breite einhundertvierundsechzig, die Fittichlänge neunundvierzig, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Zentimeter.
Dem Truthahngeier gesellt sich im östlichen Südamerika der Urubu ( Cathartes jota), ein jenem sehr ähnlicher Vogel, bei dem jedoch nur Kopf und Gurgel nackt, Genick und Hinterhals aber befiedert sind.
Der Rabengeier oder »Gallinazo« ( Cathartes atratus) kennzeichnet sich durch dünneren und längeren Schnabel, bei dem die Wachshaut ebenfalls weit vorgezogen ist, während die kleineren, länglich runden und durchgehenden Nasenlöcher nahe der Wurzel liegen, durch kürzeren, geraden abgeschnittenen Schwanz und verhältnismäßig hohe Füße. Der nackte Kopf und der Vorderhals sind dunkel bleigrau, ins Mattschwarze übergehend. Das ganze Gefieder, Flügel und Schwanz inbegriffen, ist mattschwarz, mit dunkel rostbraunem Widerschein bei günstig auffallendem Licht, die Wurzel der Schäfte der Fittichfedern weiß, das Auge dunkelbraun, der Schnabel schwarzbraun, an der Spitze horngrau. Die Länge beträgt sechzig, die Breite einhundertsechsunddreißig, die Fittichlänge neununddreißig, die Schwanzlänge achtzehn Zentimeter.
Die beiden beschriebenen Geierarten sind unter sich und mit dem noch erwähnten Urubu vielfach verwechselt worden; alle Rabengeier führen jedoch, soweit bis jetzt bekannt, eine übereinstimmende Lebensweise. Der Truthahngeier verbreitet sich vom Saskatchewan an über ganz Nord-, Mittel- und Südamerika bis zur Magelhaensstraße und von der Küste des Atlantischen bis zu der des Stillen Meeres, tritt jedoch nicht überall in gleicher Häufigkeit auf; der Rabengeier dagegen gehört mehr dem Süden Amerikas an, findet sich in den Vereinigten Staaten nicht im Norden von Karolina, zählt aber in den an den Golf von Kalifornien angrenzenden Ländern, in Mittel- und Südamerika zu den gemeinsten Vögeln des Landes. Das Leben und Treiben unserer Vögel ähnelt dem ihrer altweltlichen Verwandten; sie sind aber noch vertrauensseliger als letzterwähnte, weil in den meisten Ländern von Obrigkeitswegen eine hohe Strafe den bedroht, der einen dieser Straßenreiniger tötet. Nicht überall kommen beide Arten zusammen vor; jede von ihnen bevorzugt vielmehr gewisse Örtlichkeiten. So lebt, nach Tschudi, der Truthahngeier mehr am Meeresufer und fast nie im Innern des Landes, während der Gallinazo häufig in den Städten und einzeln auch wohl im Gebirge, aber nur selten am Strande gesehen wird. »Der Europäer, der zum erstenmal die Küste von Peru betritt, erstaunt über die unglaubliche Menge von Aasgeiern, die er am Meeresstrand an allen Wegen und in den Städten und Dörfern trifft, und über die Dreistigkeit und Zuversicht, mit der sie sich dem Menschen nähern.« Sie scheinen zu wissen, daß sie, als höchst notwendige Ersatzkräfte der mangelhaften Wohlfahrtsbehörde, geheiligt sind. In allen südamerikanischen Städten vertreten sie die Stelle unserer Straßenpolizei. »Ohne diese Vögel«, versichert Tschudi, »würde die Hauptstadt von Peru zu den ungesundesten des ganzen Landes gehören, indem von seiten der Behörden durchaus nichts für das Wegschaffen des Unrates getan wird. Viele tausende von Gallinazos leben in und um Lima und sind so wenig scheu, daß sie auf dem Markt in dem dichtesten Menschengewühle herumhüpfen.« Im übrigen Süden, hier und da selbst im Norden Amerikas ist es nicht anders. Sie sind nicht bloß geduldete, sondern durch strenge Gesetze gesicherte Wohlfahrtswächter.
Gegenwärtig sieht man gefangene Rabengeier in allen größeren Tiergärten. Durch Azara erfahren wir, daß sie außerordentlich zahm, ja zu wirklichen Haustieren werden können. Ein Freund dieses Forschers besaß einen, der aus- und einflog und seinen Herrn bei Spaziergängen oder Jagden im Felde, ja sogar bei größeren Reisen begleitete, wie ein folgsamer Hund auf den Ruf folgte und sich aus der Hand füttern ließ. Ein anderer begleitete seinen Pfleger auf Reisen über fünfzig englische Meilen weit, hielt sich stets zu dem Wagen und ruhte, wenn er müde war, auf dem Dache desselben aus, flog aber, wenn es heimwärts ging, voraus und kündigte hier die Rückkunft des Hausherrn an.
Die Eulen ( Strigidae), mit denen wir die Ordnung der Raubvögel beschließen, bilden eine nach außen hin scharf begrenzte Familie. Sie kennzeichnen sich durch ihren zwar dick erscheinenden, in Wahrheit aber sehr schlanken und schmalen, wenig fleischigen Leib, den ungemein großen, nach hinten zumal breiten, dicht befiederten Kopf mit sehr großen Augen, die nach vorn gerichtet sind und von einem runden, strahligen Federkranze umgeben werden, breite und lange, muldenförmige Flügel und den meist kurzen Schwanz. Der Schnabel ist von der Wurzel an stark abwärts gebogen, kurzhakig und zahnlos, die Wachshaut kurz und immer in den langen, steifen Borstenfedern des Schnabelgrundes versteckt. Die gewöhnlich bis zu den Krallen herab befiederten Beine sind mittel- oder ziemlich hoch, die Zehen verhältnismäßig kurz und unter sich bezüglich der Länge wenig verschieden; doch pflegt die hinterste etwas höher eingelenkt zu sein als die übrigen, und die äußere ist, eine Wendezehe, die nach vorn und hinten gerichtet werden kann. Die Klauen sind groß, lang, stark gebogen und außerordentlich spitzig, im Querschnitte fast völlig rund. Die einzelnen Federn sind groß, lang und breit, an der Spitze zugerundet, höchst fein zerfasert, deshalb weich und biegsam, unter der Berührung knisternd, die des Gesichts kleiner und steifer, zu einem, meist aus fünf Reihen gebildeten Schleier umgewandelt, der dem Eulenkopfe das katzenartige Aussehen verschafft. Die Schwingen sind ziemlich breit, am Ende abgerundet und nach dem Körper zu gebogen; die äußere Fahne der ersten, zweiten und dritten Schwinge ist, mindestens bei den echten Tageulen, sonderbar gefranst oder sägeartig gezähnelt, die innere Fahne der Schwungfeder dagegen infolge ihrer weichen Nebenfasern seidenartig oder wollig. Die erste Schwinge ist kurz, die zweite etwas länger, die dritte oder die vierte die längste von allen. Die Schwanzfedern, die sich nach Art der Flügelfedern abwärts biegen, sind regelmäßig gleichlang, am Ende gerade abgestutzt, ausnahmsweise aber auch stufig, nach der Mitte zu verlängert. Die gewöhnlich düstere, ausnahmsweise aber noch verhältnismäßig lebhafte, sich blendende Färbung schließt sich in den meisten Fällen aufs genaueste der Boden- oder Rindenfärbung an; ungeachtet kann die Zeichnung äußerst zierlich und mannigfaltig sein.
Beachtung verdienen die Sinneswerkzeuge der Eulen. Die Augen sind ausnehmend groß und so stark gewölbt, daß sie einer Halbkugel gleichen, die Seiten der harten Augenhaut, soweit der Knochenring sie einnimmt, sonderbar verlängert; das Auge selbst ist innerlich ungemein beweglich; denn der Stern erweitert oder verengert sich bei jedem Atemzuge. Die äußere Ohröffnung ist bei der Mehrzahl eine Falte, die von oben nach unten sich um das Auge herumzieht und ausgeklappt werden kann. Hierdurch entsteht eine sehr weite, durch die strahligen Federn ringsum noch vergrößerte Muschel, die sich, wie mein Vater hervorhebt, »bei mehreren Arten, zum Beispiel bei sämtlichen Ohreulen, beim Nacht- und Rauchfußkauze und andern so weit öffnet, daß man bei aufgehobener Falte einen großen Teil des Auges liegen sieht.«
Die Eulen, von denen man etwa einhundertundneunzig Arten kennt, sind Weltbürger und bewohnen alle Erdteile, alle Gürtel, alle Gegenden und Örtlichkeiten, von den eisigen Ländern um den Nordpol an bis zu dem Gleicher hin und von der Seeküste bis zu fünftausend Meter über dem Meer aufwärts. Der Süden beherbergt auch sie in größerer Artenzahl als der Norden; dieser aber ist keineswegs arm an ihnen. Waldungen sind ihre eigentlichen Heimstätten; sie fehlen aber auch den Steppen, Wüsten oder dem pflanzenlosen Gebirge, volksbelebten Ortschaften und Städten nicht. Man nennt sie Nachtraubvögel; der Ausdruck erfordert aber mindestens eine Erklärung. Allerdings beginnt die große Mehrzahl erst mit eintretender Dämmerung ihre Streifzüge; nicht wenige jedoch sind auch bei Tage tätig und gehen selbst in der Mittagszeit ihrer Nahrung nach. Ihr für kürzere Entfernungen überaus scharfes Auge, ihr außerordentlich feines Gehör, ihr weiches Gefieder befähigen sie noch während des Dunkels zu erfolgreicher Tätigkeit. Lautlos fliegen sie in nicht eben bedeutender Höhe über dem Boden dahin, ohne durch das Geräusch der eigenen Bewegung beeinträchtigt zu werden, vernehmen das leiseste Rascheln auf dem Boden, und sehen ungeachtet des Dunkels das kleinste Säugetier. »Ich habe«, sagt mein Vater, »bei zahmen Eulen, die die Augen ganz geschlossen hatten und also völlig schliefen, Versuche über die Festigkeit ihres Schlafes angestellt und war erstaunt, als ich erfuhr, wie leicht sie selbst durch ein entferntes, geringes Geräusch ganz munter und zum Fortfliegen bereit wurden. Ich habe auch die Eulen in ziemlich finsteren Nächten gegen den Himmel fliegen sehen, in ganz finsteren bald da, bald dort schreien hören, und bin Zeuge gewesen, daß ein Rauchfußkauz, an den sich ein scharfsichtiger Freund von mir äußerst still und vorsichtig anschlich, um ihn von einer Tanne herabzuschießen, sogleich wegflog, als der Jäger über eine von Bäumen entblößte Stelle ging.« Das Auge der Eulen scheint empfindlicher gegen das Tageslicht zu sein, als dies tatsächlich der Fall ist. Einzelne Arten von ihnen verschließen ihre Augen bis zur Hälfte und noch weiter, wenn sie dem vollen Lichte ausgesetzt werden, aber gänzlich unbegründet ist die Behauptung, daß sie am Tage nicht sehen könnten. »Sie sind«, fährt mein Vater fort, »nicht nur imstande, bei hellem Tageslicht im Freien, sondern auch durch die dichtesten Bäume zu fliegen, ohne anzustoßen. Ich habe dies bei fast allen deutschen Arten bemerkt. Am hellen Mittage kamen die alten Ohreulen herbeigeflogen, wenn ich ihre Jungen ausnahm; am hellen Mittag raubte ein Schleierkauz vom Schloßturme zu Altenburg aus einen Sperling, der mit den Hühnern aus dem Schloßhofe fraß, und trug ihn in seinen Schlupfwinkel«; am hellen Tage, will ich hinzufügen, erkennt der Uhu jeden Tagraubvogel, der in ungemessener Höhe dahinfliegt.
Die absonderlich gestalteten Flügel und das weiche Gefieder der Eulen lassen im voraus auf eine eigentümliche Flugbewegung schließen. Der leise Flug ist verhältnismäßig langsam, ein Mittelding zwischen Schweben, Gleiten und Flattern, bei einigen Tageulen aber ein abwechselnd bogiges Aufsteigen und Niederfallen, nach Art des Spechtfluges, das ungemein fördert, jedoch anscheinend bald ermüdet und deshalb niemals lange fortgesetzt wird. Nur bei größeren Wanderungen erheben sich die Eulen bis zu hundert Meter über den Boden und bewegen sich dann gleichmäßig mit vielen Flügelschlägen oder schwebend dahin. Auf dem Boden sind die meisten sehr ungeschickt; die langbeinigen aber gehen so gut, daß sie, freilich unter Zuhilfenahme der Flügel, selbst ihre Jagd laufend betreiben können. Im Gezweige der Bäume sind alle gewandt: einzelne klettern in sonderbarer Weise hüpfend und springend sehr rasch von einem Zweige zum andern. Sie lieben, die verschiedensten Stellungen anzunehmen, sich abwechselnd niederzuducken und dann hoch auszustrecken, wenden, beugen und drehen den Kopf in wirklich wunderbarer, für den Beschauer ergötzlicher Weise und sind, wie das Faultier imstande, das Gesicht vollständig nach rückwärts zu kehren, also auch nach hinten zu sehen. Die Stimme ist gewöhnlich laut, selten aber angenehm. Wütendes Klappen oder Knappen mit dem Schnabel und heiseres Fauchen ist der gewöhnliche Ausdruck ihrer Seelenstimmung; die eigentliche Stimme vernimmt man nur des Nachts oder bei höchster Gefahr. Einzelne Arten kreischen abscheulich, andere geben helle Töne zu hören. Alle Eulen sind scheu, aber nicht vorsichtig, lernen selten ihre Freunde kennen und sehen in jedem fremden Wesen mehr oder weniger einen Feind, lassen sich an eine gewisse Örtlichkeit gewöhnen, nicht aber zu etwas abrichten; sie sind jähzornig, blind wütend im höchsten Grade, gleichgültig und grausam. Jeder Edelfalk, ja selbst Bussard und Weih leistet sicherlich dasselbe wie sie, falls nicht mehr. Mit andern ihrer Art leben sie in Frieden und Freundschaft, solange nicht irgendeine Leidenschaft, Freßgier zum Beispiel, bei ihnen übermächtig wird; mit der größten Seelenruhe aber fressen sie den Gefährten auf, mit dem sie jahrelang einträchtig zusammenlebten, wenn derselbe irgendwie verunglückte. Ich habe zuweilen zehn bis zwölf Waldkäuze und Ohreneulen in einem und demselben großen Käfig gehalten. Keine der Eulen dachte daran, sich an einer andern zu vergreifen, solange alle bei gleichen Kräften waren; sowie aber eine der Gesellschaft erkrankte und sich in eine Ecke flüchtete, fiel die ganze Rotte über sie her, erwürgte sie und fraß sie auf. Geschwister, die aus einem Nest stammen, überfallen sich gegenseitig nicht selten, und die unterliegende wird regelmäßig getötet und verspeist.
Alle Eulen fressen während ihres Freilebens nur selbst erworbene Beute. Die verschiedensten Beobachter stimmen darin überein, daß sie niemals Aas anrühren. Vor allem sind es kleine Säugetiere, die befehdet werden; die stärksten unter ihnen greifen aber auch größere, selbst raubfähige Säuger an oder verfolgen Vögel nach Art der Falken; einzelne sind Fischer, andere Kerbtierjäger. Äußerst wenige werden dem Menschen schädlich, die große Mehrzahl bringt nur Nutzen. Es liegen sorgfältige Beobachtungen vor, die beweisen, daß unsere deutschen Eulen kaum auf andere Tiere jagen als auf Mäuse, und wir wissen, daß ihre Tätigkeit eine sehr erfolgreiche ist. Gerade wenn die verhaßten Nager es am lustigsten treiben, beginnen die Eulen ihr Handwerk. Unhörbar schweben sie dicht über dem Boden dahin; von ihrer Höhe aus durchsuchen sie diesen sehr gründlich, und in der Regel wird die erspähte Maus mit Sicherheit gefangen. Dazu tragen die kurzen, beweglichen Zehen und die nadelscharfen, stark gekrümmten Krallen wesentlich bei. Eine einmal von der Eule ergriffene Maus ist unrettbar verloren: sie ist erdolcht, noch ehe sie an Entrinnen denken kann. Sobald die Eule Beute gewonnen hat, fliegt sie einem Ruhesitze zu und beginnt nun zu fressen. Es geschieht auch dies in eigentümlicher Weise. »Nichts sieht ekelhafter aus«, sagt mein Vater, »als das Fressen einer Eule, weil sie ungeheure Stücke und diese mit großer Anstrengung verschlingt. Wenn andere Tiere ein gewisses Wohlbehagen beim Fressen zeigen, so scheint die Eule eine wahre Frohnarbeit zu verrichten, wenn sie ihre großen Bissen hinunterdrückt. Ich habe eine Ohreneule eine große Maus und einen Schleierkauz ein altes Haussperlingsmännchen mit Füßen und fast sämtlichen Federn ganz verschlingen sehen. Er nahm den Sperling mit dem einen Fange, brachte ihn zum Schnabel, so daß der Kopf zuerst in den Rachen kam, und fing dann an, durch Zurückschlagen des Kopfes den Sperling hinunter zu arbeiten, was endlich nach großer Anstrengung gelang. Als der Vogel in den Schlund kam, trat dieser so hervor, daß er vom Halse getrennt zu sein schien. Ich habe diese Versuche mehrere Male wiederholt; die Eule aber rupfte später die Federn gewöhnlich aus und verschlang erst dann den Vogel. Mäuse verschlucken die Schleierkäuze mit leichter Mühe. Sind die in den Schnabel aufgenommenen Tiere zu groß, um durch den Rachen zu gehen, dann werfen die Eulen sie wieder heraus, drücken sie mit dem Schnabel und den Fängen zusammen und arbeiten so lange, bis sie in den Schlund hinabgedrängt werden. Ich glaube, daß die Eulen beim Verschlingen größerer Stücke eine Vorstellung von dem ekelhaften Fressen der Schlangen geben können. Bei sehr großen Tieren verzehren sie das Fleisch von der Brust und das Gehirn; das übrige heben sie auf. Der Uhu frißt das Fleisch aus der Haut, wickelt sie zusammen und bewahrt dadurch das noch in ihr befindliche vor dem Austrocknen. Zuletzt verschlingt er die Haut auch.« Wasser können die meisten Eulen monatelang entbehren, vielleicht weil das Blut ihrer Schlachtopfer ihnen genügt; sie trinken jedoch zuweilen recht gern, und bedürfen Wasser zum Baden. Die Verdauung ist sehr lebhaft; der scharfe Magensaft zersetzt alle Nahrung in kurzer Zeit. Knochen, Haare und Federn ballen sich zu Kugeln zusammen und werden dann unter höchst ergötzlichen Bewegungen, gewöhnlich an bestimmten Orten, ausgespien. Dabei sperren die Eulen den Schnabel weit auf, nehmen den Kopf tief herab, treten von einem Bein aufs andere, kneifen die Augen zusammen, würgen und schütteln und entladen sich endlich des gedachten Balles oder Gewölles. Altum hat mehrere hunderte solcher Gewölle untersucht und gefunden, daß unsere deutschen Eulen hauptsächlich Mäuse und Spitzmäuse, ausnahmsweise aber auch Ratten, Maulwürfe, Wiesel, Vögel und Käfer verzehren. In siebenhundertsechs Gewöllen der Schleiereule fand er die Überreste von sechzehn Fledermäusen, zweihundertvierzig Mäusen, sechshundertdreiundneunzig Wühlmäusen, eintausendfünfhundertachtzig Spitzmäusen, einem Maulwurfe und zweiundzwanzig kleinen Vögeln, in zweihundertzehn Gewöllen des Waldkauzes Reste von einem Hermelin, achtundvierzig Mäusen, zweihundertsechsundneunzig Wühlmäusen, einem Eichhörnchen, dreiunddreißig Spitzmäusen, achtundvierzig Maulwürfen, achtzehn kleinen Vögeln und achtundvierzig Käfern, ohne die unzählbaren Maikäfer, in fünfundzwanzig Gewöllen der Waldohreule die Reste von sechs Mäusen, fünfunddreißig Wühlmäusen und zwei Vögeln, in zehn Gewöllen des Käuzchens zehn Wühlmäuse, eine Spitzmaus und elf Käfer. Diese Zahlen sprechen besser als viele Worte für die Nützlichkeit der Eulen. Die größeren Arten machen sich allerdings Übergriffe schuldig, indem sie Hasen, Rebhühner und anderes Wild befehden, und auch die kleinen schaden in beschränkter Weise durch Wegfangen der nützlichen Spitzmäuse; der Nutzen aber überwiegt den Schaden doch um ein beträchtliches, und deshalb verdienen auch diese Raubvögel, sorgfältig geschont zu werden.
Viele Eulenarten nisten in Baumhöhlen, andere in Felsspalten oder Mauerlücken, einige in Erdbauen verschiedener Säugetiere und andere endlich auf verlassenen Nestern der Falken- und Krähenarten. Hier wird im günstigsten Falle etwas Genist zusammengetragen; gewöhnlich aber trifft die nistende Eule keine Anstalten, die Nestunterlage aufzubessern, sondern legt ihre Eier ohne weiteres auf den vorgefundenen Nestboden. Die Anzahl des Geleges schwankt zwischen zwei und zehn; ausnahmsweise findet man auch wohl nur ein einziges Ei im Neste. Die Eier selbst ähneln sich sämtlich; sie sind sehr rundlich, feinkörnig und weiß von Farbe. Soviel mir bekannt, wissen wir bis jetzt nur von einer einzigen Eulenart, daß beide Geschlechter abwechselnd brüten; wie es sich bei den übrigen verhält, vermag ich nicht zu sagen. Die Tätigkeit der Eulen ist, um Worte meines Vaters zu gebrauchen, von Dämmerung und Finsternis umhüllt und daher den Beobachtungen des Naturforschers schwer zugänglich. »Nur so viel ist gewiß, daß wir am Tage bei allen Eulenhorsten, die wir zu untersuchen Gelegenheit hatten, stets das Weibchen auf den Eiern fanden.« Dagegen unterliegt es keinem Zweifel, daß bei Ernährung der Jungen die Männchen tätig sind. In meines Vaters Sammlung befand sich ein altes Paar Uhus, von denen das Weibchen zuerst bei den festgebundenen Jungen in einem Tellereisen gefangen wurde, das Männchen aber der mutterlosen Waisen so getreulich sich annahm, daß es zwei Tage später dasselbe Schicksal hatte wie sein Weibchen. Auch von andern Eulen, namentlich Wald-, Rauhfuß- und Steinkäuzen, hat mein Vater dasselbe beobachtet. Gemeinsam scheint allen Arten zu sein, daß beide Eltern warme Liebe zu ihrer Brut bekunden und diese unter anderm auch dadurch betätigen, daß sie dieselben gegen Feinde mit auffallendem Mute verteidigen. Die Jungen sitzen lange im Nest und erfüllen des Nachts die Umgegend desselben mit ihrem Geschrei. Insbesondere hört man letzteres, wenn sie ausgeflogen sind und bereits sich zu bewegen beginnen. Meines Vaters Meinung, daß sie dies tun, um den Eltern jederzeit ihren Aufenthaltsort anzuzeigen, mag wohl berechtigt sein.
Leider haben die Eulen viele Feinde. Alle Tagvögel sind ihnen abhold, gleichsam als ob sie sich für die ihnen während ihres Schlafes von den Nachträubern zugefügten Angriffe rächen wollten. Fast sämtliche Tagraubvögel gebärden sich wie sinnlos, wenn sie eine größere Eule erblicken. Das gesamte Kleingeflügel hegt dieselben Gesinnungen wie sie und gibt diese durch lebhaftes Geschwätz und Geschrei, das man wohl als Schelten und Schimpfen deuten kann, zu erkennen. Der ganze Wald wird rege, wenn eine Eule entdeckt wurde. Ein Vogel ruft den andern herbei, und der arme Finsterling hat dann viel zu leiden; denn die starken Tagvögel vergreifen sich auch tätlich an ihm. Der Mensch schließt sich nur zu oft den genannten Feinden an. Zwar betrachten meines Wissens nur Ostjaken und – Helgoländer das Fleisch einer Eule als willkommenes, ihrer Zunge zusagendes Gericht; viele gebildet sein wollende Deutsche aber wähnen eine Heldentat zu vollbringen, indem sie Eulen im Schlafe meucheln oder im Fluge herabschießen, und nur sehr vereinzelt geschieht es, daß man ihnen Schutz gewährt. Der Land- und Forstwirt tut wohl, sich den Beschützern der Eulen anzuschließen und sie zu hegen und pflegen, als ob sie heilige Vögel wären.
Im Käfige werden nur diejenigen Eulen wirklich zahm, die man in sehr früher Jugend aushebt, groß füttert und freundlichen Umganges würdigt. Ich habe solche besessen und dann mich innig mit den sonst nicht gerade liebenswürdigen Vögeln befreundet. Solche, die in reiferem Alter gefangen wurden, zeigen sich entweder gleichgültig oder gebärden sich in einer Weise, die ängstliche Gemüter schier erschrecken, kräftigere Naturen aber höchstens ergötzen kann. Zumal die großen Arten scheinen mit der ganzen Welt zerfallen zu sein und in jedem andern Wesen einen Feind zu wittern. Wütend rollen sie die großen Augen, wenn man sich ihnen naht; ingrimmig knacken sie mit dem Schnabel, und boshaft fauchen sie nach Katzenart. Kleine Eulen dagegen zählen zu den unterhaltendsten und liebenswürdigsten aller Stubenvögel. Bei geeigneter Pflege kann man die einen wie die andern im Käfige zur Fortpflanzung schreiten sehen.
*
Alle Forscher stimmen darin überein, daß man den Tageulen die erste Stelle anzuweisen hat, die meisten auch darin, daß man sie in einer besonderen Unterfamilie ( Surnina) vereinigen darf. Der Kopf der betreffenden Arten ist verhältnismäßig klein, der Leib schlank und zierlich, der Schleier undeutlich, das übrige Gefieder knapp, der Fittich ziemlich, der Schwanz meist ansehnlich lang.
In den nördlichen Ländern der Alten Welt lebt die Sperbereule ( Surnia ulula), die man als die falkenähnlichste aller Eulen ansieht und deshalb wohl auch geradezu »Falkeneule« oder »Eulenfalk« nennt. Sie kennzeichnet sich durch breiten, auf der Stirne niedrigen Kopf mit platter Stirne und schmalem Gesicht, ohne eigentlichen Schleier und Federkreis um das Auge, durch ziemlich lange, verhältnismäßig spitzige Flügel, in denen die dritte Schwinge die längste ist, und langen, keilförmigen Schwanz. Die Läufe sind bis zu den Zehen herab befiedert, diese kurz und mit scharfen Krallen bewehrt. Die Augen sind groß, die Ohren mit einer länglich eiförmigen, sechzehn Millimeter hohen Öffnung und wohl ausgebildeten Klappe ausgerüstet, die an die des Schleierkauzes erinnert. Das Gefieder ist reich, sanft und glänzend, liegt aber doch viel dichter an als bei den meisten Nachteulen. Beim ausgefärbten Vogel ist das Gesicht weißgrau, ein Streifen vor und ein anderer hinter dem Ohre, die sich halbmondförmig zu beiden Seiten des Kopfes herabziehen, schwarz, der Scheitel braunschwarz, der Nacken wie ein Fleck hinter dem Ohre reinweiß, die Oberseite braun, weiß gefleckt, die Kehle weiß, die Oberbrust durch ein verwaschenes Querband geziert, die Unterseite weiß, auf Unterbrust, Bauch und Seiten schmal schwarzbraun in die Quere gestreift oder gesperbert; die Schwingen und Schwanzfedern sind mäusegrau, weißlich gebändert. Das Auge ist dunkelschwefel-, der Schnabel schmutzigwachsgelb, an der Spitze hornschwarz. Junge Vögel unterscheiden sich wenig von den alten; diese aber ändern vielfach ab, ohne daß dadurch übrigens das Gesamtgepräge der Zeichnung verwischt würde. Die Länge beträgt neununddreißig bis zweiundvierzig, die Breite sechsundsiebzig bis einundachtzig, die Fittichlänge dreiundzwanzig, die Schwanzlänge sechzehn Zentimeter.
Im Norden Amerikas wird die Sperbereule durch die ihr sehr nahestehende Falkeneule ( Surnia funerea) vertreten, die sich ständig durch dunklere Oberseite und breitere, mehr oder minder lebhaft braune Sperberung der Unterseite von ihrer altweltlichen Verwandten unterscheidet.
Das Verbreitungsgebiet der Sperbereule erstreckt sich über alle nördlichen Länder der Alten, das der Falkeneule über die entsprechenden der Neuen Welt. Jene, auf die ich mich im nachstehenden beschränken werde, findet sich als regelmäßiger Brutvogel erwiesenermaßen im nördlichen Skandinavien, Nord- und Mittelrußland sowie in Sibirien, vom Ural an bis zum Ochotskischen Meere und von der nördlichen Waldgrenze an bis in die Steppengebiete im Süden des Waldgürtels, ist bis jetzt aber in China noch nicht aufgefunden worden. Wie bei den meisten nordischen Eulen richtet sich ihr Vorkommen mehr oder weniger nach dem jeweiligen Gedeihen der Lemminge. Als Regel mag gelten, daß sie Birkwaldungen allen übrigen bevorzugt und demgemäß in Skandinavien erst in einem Höhengürtel auftritt, in dem die Birken vorherrschen. Auf innigen Zusammenhang des genannten Baumes mit ihr deuten Färbung und Zeichnung des Gefieders. Es kommt vor, daß sie in Fichten- oder Föhrenwaldungen brütet; wenn sie aber innerhalb der Birkwaldungen genügende Nahrung hat, verläßt sie dieselben gewiß nicht. Reichlicher Schneefall, mehr vielleicht noch Armut an Lemmingen, zwingt sie, gegen den Winter hin ihre beliebtesten Aufenthaltsorte zu verlassen und entweder einfach nach der Tiefe oder nach niederen Breiten hinab zu wandern. Bei dieser Gelegenheit erscheint sie wahrscheinlich allwinterlich in den Ostseeprovinzen und Dänemark, nicht allzu selten auch in Deutschland. Ein und das andere Paar bleibt unter besonders günstigen Umständen wohl auch in der Fremde wohnen; für Deutschland wenigstens ist keineswegs unwahrscheinlich, daß unsere Eule wiederholt in Ost- und Westpreußen genistet hat.
Über Lebensweise, Betragen, Nahrung und Fortpflanzung liegen mehrere Berichte vor. Ich selbst habe die im hohen Norden keineswegs seltene Eule nur auf unserer letzten Reise nach Sibirien am unteren Ob gesehen, leider jedoch nicht eingehend beobachten können. Nur über ihren Flug vermag ich einiges zu sagen, was ich anderswo nicht erwähnt finde. Sie fliegt nicht nach Art anderer mir bekannten Eulen, sondern nach Art eines Weih; man muß sogar scharf hinblicken, wenn man sie in geraumer Entfernung vom Wiesenweih unterscheiden will. Hat man sie erst einige Male gesehen, so erkennt man sie nicht allein an dem dickeren Kopfe, sondern, und sicherer noch, an ihrem, doch auch vom Weih bestimmt verschiedenen Fluge. Sie wiegt sich nicht, von einer Seite auf die andere sich neigend, hebt beim gleitenden Dahinschweben die Flügel höher und schaltet zwischen die schwebende Bewegung viel mehr, durch ihre Weichheit ausgezeichnete Flügelschläge ein, der Flug ist minder stetig, im ganzen merklich langsamer als der des Weih; endlich rüttelt sie sehr häufig und setzt sich während ihrer Jagd oft nieder. Mitteilungen von Wallengren, Collett, Wheelwright und Wolley lehren uns zusammengefaßt ungefähr das folgende: In guten Lemmingjahren verläßt die Sperbereule ihr Brutgebiet nicht; höchstens Junge unternehmen Wanderungen nach südlicher gelegenen Gegenden und werden dann auch an solchen Örtlichkeiten gesehen, die ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsorte wenig entsprechen, so beispielsweise in unbewaldeten Geländen. In ihrem Auftreten erinnert sie sehr an die Falken. Ein Tagvogel wie diese, vereinigt sie mit dem leisen obwohl raschen Fluge der Eule jener Lebendigkeit und Mut, ähnelt ihnen auch hinsichtlich ihres Geschreies. Oft sieht man sie auf den dürren Wipfeln einer abgestorbenen Föhre sitzen und von hier nach Beute sich umschauen. Ein ihr nahender Mensch behelligt sie dann so gut wie nicht. Mit ihren hellgelben Augen starrt sie alles ruhig an, und ihr Blick gewinnt dabei den Anschein halb verlegener Verschmitztheit; ihren gefährlichsten Gegner aber fest ins Auge zu fassen, fällt ihr nicht ein. Sie gebart sich, als ob sie es unter ihrer Würde halte, solches zu tun, dreht vielleicht auch, angesichts des sie bedrohenden Schützen, ihr Haupt gemächlich nach einer anderen Richtung, als ob sie sich willentlich nicht um ihn kümmern wolle. Ganz anders benimmt sie sich einer Beute oder einem ihrer gefiederten Feinde sowie auch demjenigen gegenüber, der ihr Nest bedroht. Kaum ein einziger Waldvogel ist vor ihren Angriffen gesichert. Wheelwright sah, daß sie einen unglücklichen Häher, ihren gewöhnlichen Nachbar, im Fluge schlug, und überraschte sie mehr als einmal beim Kröpfen eines Morasthuhnes, dessen Gewicht das des ihrigen fast um das doppelte übersteigt. Allerlei Vögel, Lemminge und Waldmäuse, ebenso auch Kerbtiere bilden ihre gewöhnliche Nahrung. Wie ein Falk stürzt sie sich von ihrem Hochsitze hernieder, um einen der kleinen Nager zu ergreifen, packt denselben sicher, erdolcht oder erwürgt ihn mit den scharfen Fängen und trägt ihn dann nach einem passenden Sitzplatze, oft länger zwischen dem einen oder dem anderen wählend, um ihn hier zu verzehren. Wird sie von Waldgeflügel, insbesondere Hähern, Krähen, Meisen geneckt, so läßt sie sich dies oft lange gefallen, wirft sich dann aber plötzlich in die Mitte der Widersacher und ergreift einen von ihnen. Nur gegen die Elstern, die sie laut schreiend umringen und necken, scheint sie nichts ausrichten zu können. In die Enge getrieben, beispielsweise flügellahm geschossen, wehrt sie sich auf das verzweifeltste, deckt ihren Rücken und streckt beide Klauen angriffsfertig ihrem Feinde entgegen.
Anfang Mai, unter Umständen bereits im April, schreitet sie zur Fortpflanzung. Zu ihrer Niststätte wählt sie sich entweder eine Baumhöhlung, einen Nistkasten, wie man sie in Lappland für die Gänsesäger an die Bäume hängt, oder ein altes Krähennest, erbaut sich auch wohl auf höheren Bäumen einen der Hauptsache nach aus Ästen und Reisern bestehenden, mit Laub und Moos ausgekleideten flachmuldigen Horst und belegt denselben mit sechs bis acht abgerundeten, rein weißen Eiern, die etwas kleiner als die des Baumkauzes sind und etwa einen Längendurchmesser von fünfunddreißig bis fünfundvierzig und einen Querdurchmesser von neunundzwanzig bis einunddreißig Millimeter haben. Auf der Spitze eines abgestorbenen Baumes in möglichster Nähe des Nestes sitzend, hält das Männchen sorgsam Wache, erhebt, sobald sich irgendein lebendes Wesen dem Horste nähert, Kopf und Schwanz, läßt einen schrillen, dem des Turmfalken nicht unähnlichen Schrei vernehmen und stößt wütend auf den Störenfried herab. Wheelwrights Steiger fürchtete sich so sehr vor der Sperbereule, daß er sich weigerte, deren Horst zu erklettern, denn er hatte gelegentlich des Ausnehmens eines Nestes erfahren müssen, daß er von dem alten Männchen des bedrohten Paares auf das heftigste angegriffen und nicht allein seiner Kopfbedeckung, sondern auch einiger Büschel seiner Haupthaare beraubt worden war. Ein Jagdhund wird nicht bloß während der Brutzeit, sondern in allen Monaten des Jahres aufs heftigste angegriffen. Beachtenswert ist, daß nach den Beobachtungen des letztgenannten Forschers das Männchen sein Weibchen im Brüten ablöst. Noch bevor die Jungen flugbar geworden sind, tritt bei den Alten die Mauser ein, und wenn jene ihr volles Gefieder erlangt haben, prangen auch diese in neuem Kleid.
*
Hauptkennzeichen der Schnee-Eulen ( Nyctea) sind der schmale, kleine Kopf mit kleinen Ohrmuscheln und Ohröffnungen, deshalb auch mit unvollkommenem Schleier, und die kurzen, aber ungemein dicht befiederten Füße. Der Schnabel ist stark und kurzhakig, der Flügel mittellang, in ihm die dritte Schwinge die längste, der Schwanz ziemlich lang, ab- und zugerundet, das übrige Gefieder dicht, aber minder weich, als bei anderen Eulen.
Die Schnee-Eule ( Nyctea nivea) ist achtundsechzig bis einundsiebenzig Zentimeter lang, einhundertsechsundvierzig bis einhundertsechsundfünfzig Zentimeter breit; die Fittichlänge beträgt fünfundvierzig, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Zentimeter. Die Färbung ist je nach dem Alter verschieden. Sehr alte Vögel sind weiß, zuweilen fast ungefleckt oder höchstens mit einer Querreihe brauner Fleckchen am Vorderkopfe und einzelner auf den großen Schwingen, mittelalte auf weißem Grunde mehr oder weniger mit braunen Quer- oder auf dem Kopfe mit solchen Längsflecken gezeichnet, jüngere Vögel noch stärker gesteckt als letztere und auf der Ober- wie auf der Unterseite förmlich gesperbert. Das Auge ist prächtig gelb, der Schnabel hornschwarz.
Anstatt einer ausführlichen Angabe aller Gegenden und Länder, die die Schnee-Eule bewohnt, brauche ich bloß zu sagen, daß sie ein Kind der Tundra, nach Norden hin aber beobachtet worden ist, soweit Reisende gegen den Pol zu vordrangen. In der Tundra tritt sie keineswegs überall in gleicher Menge auf. Auch ihr Vorkommen richtet sich nach der Häufigkeit oder verhältnismäßigen Seltenheit der Lemminge. Nächstdem liebt sie Ruhe und Einsamkeit, meidet also solche Gegenden, die vom Menschen, ihrem ärgsten Widersacher, oft besucht werden. Daher tritt sie in Amerika, Lappland und Nordwestrußland häufiger auf als in Nordostrußland und Sibirien, woselbst man ihr, wenigstens in den von uns durchreisten Gegenden, ihres Fleisches halber arg nachzustellen pflegt. Während des Sommers hält sie sich hauptsächlich auf den nordischen Gebirgen auf; im Winter streicht sie in tiefer gelegene Gegenden hinab, und wenn der Schnee in ihrer Heimat sehr reichlich fällt und die Nahrung knapp wird, tritt sie auch wohl eine Wanderung nach dem Süden an. Auf den taurischen Hochsteppen stellen sich, laut Radde, zuerst die Weibchen ein und zwar bereits gegen Ende September; die Männchen folgen viel später. In Skandinavien kommt sie erst mit Einbruch des Winters in die Täler herab. Regelmäßiger als die Sperbereule erscheint sie in südlicheren Gegenden, insbesondere in Deutschland. In Ostpreußen, namentlich in Litauen, kommt sie fast in jedem Winter vor; Westpreußen, Posen und Pommern besucht sie ebenfalls sehr regelmäßig, und auch in Dänemark erscheint sie nicht allzu selten, obwohl sie für gewöhnlich auf dem Wege dahin nur bis Südskandinavien vorzudringen pflegt. Auf den britischen Inseln wandert sie wahrscheinlich von beiden Seiten, nämlich von Skandinavien und von Grönland her, im Winter ein; Südrußland, die Steppen Südsibiriens und der Mongolei, China und Japan besucht sie von der sibirischen Tundra, dem Süden der Vereinigten Staaten, Mittelamerika und sogar Westindien endlich von dem hohen Norden Amerikas aus. Unter Umständen verweilt auch sie ausnahmsweise während des Sommers im fremden Lande, um hier zu brüten.
Eine Schnee-Eule in der Tundra ist ein herrlicher Anblick. Während unserer Reise durch die Samojedenhalbinsel hatten wir wiederholt Gelegenheit, den prachtvollen Vogel zu sehen. Die Schnee-Eule ist hier zwar minder häufig, als es, nach den bei allen Lagerstellen der Ostjaken gefundenen Federresten zu urteilen, der Fall sein müßte, kommt aber doch als Brutvogel durch das ganze Gebiet vor. Von anderen Eulen, insbesondere aber von der in der Tundra sehr häufigen Sumpfeule, unterscheidet man sie augenblicklich, erkennt sie überhaupt in jeder Entfernung. Ganz abgesehen von der bei Tage blendenden Färbung und bedeutenden Größe zeichnen sie ihre kurzen, breiten, stark gerundeten Flügel so bestimmt aus, daß man über sie nicht im Zweifel sein kann. Sie fliegt bei Tage wie bei Nacht und ist unter Umständen in den Nachmittagsstunden lebhafter als im Zwielichte des Morgens und Abends. Zu ihrer Warte wählt sie vorspringende Kuppen und Hügel, auf denen sitzend sie auch ihre weit vernehmbare, dem Geschrei des Seeadlers nicht unähnliche, gackernde Stimme oft ausstößt. Hier verweilt sie manchmal viertelstundenlang, erhebt sich dann und zieht, abwechselnd mit den Flügeln schlagend und schwebend, fort, steigt, wenn sie einen weiteren Weg zurücklegen will, in Schraubenlinien bis zur Höhe eines Bergzuges auf und senkt sich sodann zu einem zweiten Hügel herab, um wiederum von ihm Umschau zu halten. Ihr Wohn- und Jagdgebiet scheint nicht sehr ausgedehnt zu sein, da wir sie im Laufe eines ganzen Tages auf wesentlich denselben Stellen beobachten konnten. Eine, die ich erlegte, war das Männchen eines Paares, das sich in dem gleichen Gebiete umhertrieb. Obwohl die Tundra der Samojedenhalbinsel äußerst spärlich bevölkert und demgemäß höchst unregelmäßig von Ostjaken und Samojeden durchzogen wird, zeigt sich doch die Schnee-Eule auffallend scheu, läßt mindestens den Europäer nicht ohne weiteres zu Schusse kommen. Der in Rede stehenden konnte ich mich nur dadurch nähern, daß ich sie mit dem Renntierschlitten anfuhr. Dieselbe Scheu behält sie, wie ich von meinen ostpreußischen Jagdfreunden erfahre, in der Fremde bei. Auch hier meidet sie die Waldungen gänzlich und hält sich vorzugsweise auf den in den Feldern zusammengelesenen Steinhaufen oder den Weidenbäumen auf, die die Landstraßen besäumen, ist aber stets äußerst vorsichtig. An Kühnheit und Dreistigkeit scheint sie alle übrigen Eulen zu überbieten. Hunde greift sie, nach Schraders Beobachtung, mit großem Ungestüme an und sticht auf sie hernieder wie ein Falk. Das von mir erlegte Männchen fiel flügellahm aus der Luft herab, bereitete sich hierauf sofort zum Angriffe vor und wehrte sich, als ich es aufnehmen wollte, in verzweifelter Weise. Heiser fauchend und heftig knackend empfing es mich, und als ich die Hand nach ihm ausstrecken wollte, hieb es nicht allein mit den Fängen, sondern auch mit dem Schnabel um sich, so daß ich genötigt war, ihm den Gewehrkolben auf die Brust zu setzen und diese zu zerquetschen. Aber auch jetzt noch ließ es den Stiefel, in den es sich verbissen hatte, erst los, als ihm der Atem ausging.
Kleine Nagetiere, vor allen anderen Lemminge, außerdem Eichhörnchen, Pfeifhasen, Biberratten und dergleichen, bilden die Nahrung der Schnee-Eule; sie schlägt aber auch Tiere von Hasengröße. »An einem Vormittage im Anfang des April 1869«, schreibt mir Pieper, »sah ich wieder eine Schnee-Eule in großer Entfernung auf einem Steinhaufen sitzen und begann, um schußgerecht mich zu nähern, sie in der von mir erprobten Weise zu umkreisen. Beim Gehen über die Stoppel scheuchte ich einen jungen Hasen von der Größe einer Katze auf, und dieser lief zufällig gerade auf die Schnee-Eule zu. Obwohl ich nur noch einhundertfünfzig Schritte von letzterer entfernt war, stieß sie doch ohne Besinnen auf den etwa dreißig Schritte weit von ihr vorüberlaufenden Hasen, schlug ihn beim zweiten Stoße, schleppte ihn dicht über dem Erdboden weg, etwa hundert Schritte weiter, und setzte sich dann hier, um ihn zu kröpfen. Als ich mich bis auf etwa sechzig Schritte genähert hatte, wollte sie mit ihrem Raube weiterziehen; ich aber schoß sie aus der Luft herab. Der Hase war über der Mitte des Leibes zu beiden Seiten geschlagen und bereits verendet.« Truppweise geschart folgt sie den Lemmingszügen; paarweise oder einzeln bedroht sie Federwild aller Art. Schneehühner verfolgt sie mit Leidenschaft, nimmt angeschossene vor den Augen des Jägers weg, sogar aus dem Jagdsacke heraus; Waldhühner, Enten und Wildtauben sind ebensowenig vor ihr gesichert, Fische nicht vor ihr geschützt. »Eines Morgens«, erzählt Audubon, »saß ich in der Nähe der Ohiofälle auf dem Anstande, um wilde Gänse zu schießen, und dabei hatte ich Gelegenheit, zu sehen, wie die Schnee-Eule Fische fängt. Sie lag lauernd auf dem Felsen, den niedergedrückten Kopf nach dem Wasser gekehrt, so ruhig, daß man hätte glauben können, sie schliefe. In dem Augenblick aber, als sich ein Fisch unvorsichtig zur Oberfläche des Wassers erhoben, tauchte sie blitzschnell ihren Fang in die Wellen und zog regelmäßig den glücklich erfaßten Fisch ans Land. Mit ihm entfernte sie sich sodann einige Meter weit, verzehrte ihn und kehrte nun nach der alten Warte zurück. Hatte sie einen größeren Fisch erlangt, so packte sie ihn mit beiden Fängen und flog dann weiter mit ihm als sonst davon. Zuweilen vereinigten sich ihrer zwei zum Verzehren der Mahlzeit, gewöhnlich wenn der von einer gefangene Fisch groß war.«
Die Fortpflanzung der Schnee-Eule fällt in den Hochsommer. Im Juni findet man die Eier, deren sie mehr legt als irgendein anderer Raubvogel ihrer Größe. Wiederholt hat man sieben Stück in einem Horste gefunden. Wie es scheint, beginnt das Weibchen bereits zu brüten, während es noch legt; denn in den einzelnen Nestern findet man Junge merklich verschiedener Größe. Die Eier sind etwa fünfundfünfzig Millimeter lang, fünfundvierzig Millimeter dick und schmutzigweiß von Farbe. Der Horst ist eine seichte Vertiefung auf der Erde, die mit etwas trockenem Grase und einigen vom Brutvogel selbst herrührenden Federn ausgefüttert wurde. Das Weibchen sitzt fest auf den Eiern und läßt den Menschen, dem es sonst immer vorsichtig ausweicht, sehr nahe herankommen, nimmt auch wohl zu Verstellungskünsten seine Zuflucht, indem es sich auf den Boden wirft, als wäre es flügellahm geschossen und hier eine Zeitlang wie tot mit ausgebreiteten Flügeln liegen bleibt. Während das Weibchen brütet, hält das Männchen, in der Nähe auf einer passenden Warte sitzend, scharfe Umschau und warnt die Gattin bei dem geringsten Anzeichen von Gefahr durch lautes Schreien, infolgedessen sie augenblicklich das Nest verläßt und über demselben in Gemeinschaft mit dem Männchen, wie dieses fortwährend schreiend, stundenlang das Nest umfliegt. Bei dieser Gelegenheit offenbart das Männchen seine ganze Kühnheit, stößt wütend auf den Eindringling, noch heftiger auf einen diesen begleitenden Hund herab und läßt sich nur schwer vertreiben, wogegen das Weibchen selten ebenso wie jenes sein Leben aufs Spiel setzt.
In Europa wird die Schnee-Eule wohl nur von Naturforschern und Jägern, denen Erlegung eines so großen Vogels besonderes Vergnügen gewährt, ernstlich gefährdet; in der Tundra der Samojedenhalbinsel dagegen verfolgen sie Ostjaken und Samojeden regelrecht, fangen sie mit Hilfe riesiger Sprenkel und verzehren ihr Wildpret mit Behagen.
Schnee-Eulen im Käfige gehören zu den Seltenheiten, dauern auch nur ausnahmsweise vier bis sechs Jahre in Gefangenschaft aus. Im Vergleiche zu andern Verwandten sind sie munterer und auch bei Tage lebendiger als andere Arten gleicher Größe, fliegen gern im Käfige auf- und nieder und ertragen den Blick des Beschauers, ohne sich darüber sonderlich zu erbosen. Reizt man sie freilich, dann werden auch sie sehr ärgerlich und knacken und fauchen ebenso wütend, wie andere ihrer Zunft.
*
»Minervens Vogel war ein Kauz« und zwar der Steinkauz, wenn auch nicht gerade der bei uns lebende, sondern nur einer der vielen Verwandten dieses Vogels, einer der ihm am nächsten stehenden, der in Griechenland ungemein häufig gefunden wird. Unser Steinkauz, der liebenswürdige und doch so verschriene Vogel, auch Sperlings-, Lerchen-, Stock-, Haus- und Scheunenkauz, Leichen- und Toteneule, Leichenhühnchen, Wehklage und Klagemutter, Leichen- und Totenvogel, in Oesterreich aber Wichtl genannt ( Athene noctua), zählt zu den kleineren Eulen unseres Vaterlandes: seine Länge beträgt einundzwanzig bis zweiundzwanzig, die Breite zweiundfünfzig bis fünfundfünfzig, die Fittichlänge vierzehn, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Der Oberkörper ist tief mäusegraubraun, unregelmäßig weiß gefleckt, das Gesicht grauweiß, der Unterkörper weißlich, bis gegen den After hin braun in die Länge gefleckt; die dem Oberkörper gleichgefärbten Schwung- und Schwanzfedern sind rostgelblichweiß gefleckt, wodurch im Schwanze fünf undeutliche Binden entstehen. Das Auge ist schwefelgelb, der Schnabel grünlichgelb, der Fuß gelblichgrau. Junge Vögel sind dunkler als die alten.
Von Südschweden an verbreitet sich der Kauz über ganz Europa und einen großen Teil Asiens bis nach Ostsibirien hin. Er bewohnt ganz Deutschland, Dänemark, Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Österreich-Ungarn, Südrußland, die Donautiefländer und die Türkei, ebenso das südliche Sibirien und Turkestan, tritt nicht überall in gleicher, je weiter nach Süden hin aber in um so größerer Menge auf und zählt auf allen drei südlichen Halbinseln Europas zu den gemeinsten Raubvögeln. In den spanischen Gebirgen steigt er bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe empor, zieht jedoch mit Beginn des Winters in tiefere Lagen hinab. Bei uns zulande gehört er nicht zu den Seltenheiten. Da, wo Obstgärten mit alten Bäumen Dörfer umgeben, findet er sich gewiß; er nimmt aber auch mitten in Städten, auf Türmen und Dachboden, in Gewölben, Begräbnissen und an anderen geeigneten Orten Herberge. Das Innere ausgedehnter Waldungen meidet er, und Nadelhölzer liebt er auch nicht, Feldgehölze dagegen sind ihm sehr genehm. Vor dem Menschen und seinem Treiben scheut er sich nicht. Bei Tage lebt er verborgen in seinem Schlupfwinkel, und nachts fürchtet der Mensch den Kauz oft mehr als dieser jenen. In vielen Gegenden Deutschlands gilt der anmutige Steinkauz als unheilweissagender Vogel. Man gibt sich nicht die Mühe, selbst zu prüfen, sondern glaubt das, was einfältige Weiber erzählen. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, daß der Kauz des Nachts an die Fenster von Krankenstuben flog, und sie haben mit eigenen Ohren gehört, daß er die Kranken einlud, auf dem Friedhofe, selbstredend als Leichen, zu erscheinen. Begründet und wahr ist, daß der harmlose Vogel, angelockt durch das Licht, erleuchteten Zimmern zufliegt, sich wohl auch neugierig auf dem Fensterstocke niederläßt und bei dieser Gelegenheit vielleicht sogar seine Stimme erschallen läßt. Da er nun bald leise und gedämpft »Bu bu«, bald laut und helltönend »Quew quew kebel kebel«, bald endlich »Kuwitt, kuwitt« schreit, übersetzt sich das Volk diese Laute, namentlich die letzteren, nach seiner Weise, hört in ihnen ganz genau die Worte: »Komm mit, komm mit auf den Kirchhof, Hof, Hof«, und das ist Grund genug, den Kauz zu verabscheuen. Schon in Südeuropa fällt es niemandem ein, ihn mit mißgünstigem Auge zu betrachten. Er ist dort so häufig, daß man ihn kennengelernt hat, und weil dies der Fall, Liebling von jung und alt. Schon in Italien liebt und pflegt ihn jedermann; in Griechenland gilt er noch heute als ein hochbegabter Vogel und steht dort in so hohen Ehren, daß man dem König Otto bei seiner ersten Ankunft einen lebenden Kauz als Willkommensgeschenk überreichte. Nicht minder geschätzt wird er in Palästina, wo man ihn als Glücksvogel betrachtet, niemals verfolgt, vielmehr hegt und pflegt.
Der Kauz verdient die Zuneigung des Menschen. Er ist ein allerliebstes Geschöpf. Eine wirkliche Tageule kann man ihn zwar nicht nennen: aber er ist auch nicht so lichtscheu wie andere Eulen und weiß sich bei Tage sehr gut zu benehmen. Niemals schläft er so fest, daß er übertölpelt werden kann; das geringste Geräusch erweckt ihn, und weil er auch bei Tage vortrefflich sieht, ergreift er beizeiten die Flucht. Sein Flug geschieht ruckweise in Bogen, etwa nach Art des Spechtfluges, fördert aber rasch und macht es ihm möglich, mit größter Gewandtheit durch dichtes Gezweig der Bäume sich hindurch zu winden. Im Sitzen hält er sich gewöhnlich geduckt; sobald er aber etwas Verdächtiges sieht, richtet er sich hoch empor, streckt sich, so lang er kann, macht Verbeugungen, faßt den Gegenstand seiner Betrachtung scharf ins Auge und gebärdet sich höchst sonderbar. Sein Blick hat etwas Listiges, Verschmitztes, aber nichts Bösartiges, sondern immer etwas Einnehmendes. Wer ihn kennt, begreift, daß die Griechen in ihm den Lieblingsvogel einer klugen Göttin sehen konnten. Seine geistigen Fähigkeiten sind auch wirklich nicht gering; er darf wohl als eine der verständigsten aller Eulen angesehen werden. Dabei ist er verträglich gegen andere seiner Art. Im Süden Europas oder in Nordafrika trifft man ihn oft gesellschaftsweise an.
Schon vor Sonnenuntergang läßt er seine Stimme erschallen; mit einbrechender Dämmerung beginnt er regelmäßig zu jagen. In hellen Nächten sieht man ihn bis zum Morgen fast ununterbrochen in Bewegung oder hört ihn wenigstens. Er durchstreift dabei ein kleines Gebiet, läßt sich durch alles Auffallende herbeilocken, umschwebt namentlich gern das Lagerfeuer des einsamen Jägers oder Wanderers oder kommt bei uns an die hellerleuchteten Fenster heran. Seine Jagd gilt hauptsächlich kleinen Säugetieren, Vögeln und Kerbtieren. Er fängt Fleder-, Spitz- und wirkliche Mäuse, Lerchen, Sperlinge, Heuschrecken, Käfer und dergleichen. Mäuse bleiben immer sein hauptsächlichstes Wild.
Im April oder Mai schreitet der Kauz zur Fortpflanzung. Er ist dann besonders unruhig, schreit und lärmt viel, auch bei Tage, und ladet jeden, der ihm glauben will, eifrig ein, mit ihm zu kommen. Ein eigentliches Nest baut er nicht, erwählt sich vielmehr eine passende Höhlung in Felswänden, unter Steinen, in alten Gebäuden, Bäumen, in Ermangelung passenderer Nistorte sogar eine Kaninchenhöhle, bei uns zulande oft in unmittelbarer Nähe der Wohnungen, im Süden Europas in diesen selbst, und legt hier seine vier bis sieben fast rundlichen Eier ohne weiteres auf den Boden. Vierzehn bis sechszehn Tage lang brütet er dann so eifrig, daß er sich kaum vom Neste vertreiben läßt. Naumann erwähnt, daß er ein brütendes Weibchen streicheln und sogar ein Ei unter ihm hervorholen konnte, ohne daß es aufflog. Die Jungen werden mit Mäusen, kleinen Vögeln und Kerbtieren großgefüttert. Sobald die Jungen ausgefiedert und imstande sind, das Nest zu verlassen, fliegen ihre Erzeuger, laut Robson, allabendlich eine Strecke weit weg, irgendwelchem Hochsitze zu und schreien laut und gellend, nach Art der warnenden Amsel. So tun sie, bis die Sprößlinge aus dem Neste und ihnen zufliegen. Nunmehr führen sie ihre Brut ins Freie, wo es Berge gibt, diesen zu, um sie nach und nach an Selbständigkeit zu gewöhnen, kehren gegen Morgen aber immer wieder mit ihnen zum Neste zurück, bis endlich das junge Volk seine eigenen Wege zieht.
Habicht und Sperber erwürgen ihn, wenn sie seiner habhaft werden können; das Wiesel stellt seinen Eiern nach; Krähen, Elstern, Häher und alle kleinen Vögel verfolgen ihn mit argem Geschrei. Hierauf gründet sich eine Art des Vogelfangs, die namentlich in Italien stark betrieben wird. Man stellt den Kauz aus und um ihn herum Leimruten, aus denen sich das kleine Geflügel massenhaft fängt. »Um keinen Mangel an Käuzchen zu haben«, erzählt Lenz, »sorgen die Italiener für gute, dunkle Brutplätze unter den Dächern und für bequeme Eingänge dazu. Aus den Nestern werden nur so viele Junge genommen und aufgezogen, als man fürs Haus oder zum Verkauf für den Markt braucht; die übrigen werden in ungestörter Ruhe gelassen. Die zahmen Käuzchen sind wirkliche Hausfreunde der Italiener, gehen oft frei in Haus, Hof und Garten mit beschnittenen Flügeln herum, fangen überall Mäuse, werden besonders gern in gut umzäunte Gärten gesetzt, woselbst sie die Erdschnecken und anderes lästiges Ungeziefer vertilgen, ohne ihrerseits den geringsten Schaden zu tun. Arbeitet nach dortiger Sitte ein Schuster, Schneider, Töpfer oder anderer Handwerker auf der Straße, so hat er, wie ich oft gesehen, sehr gern seine Lieblinge, seine zwei bis vier Käuzchen, neben sich auf einem Stäbchen angefesselt und wechselt mit ihnen so oft als möglich zärtliche Blicke. Weil er nicht immer Fleisch für diese artigen Vielfräße beschaffen kann, so gewöhnt er sie daran, bei dessen Ermangelung mit Polenta vorlieb zu nehmen.«
Schon in Österreich benutzt man den Wichtl vielfach zu gleichem Zweck und versichert, mit ihm die besten Erfolge zu erzielen. Was der Uhu für die Jagd der Falken, das leistet der Steinkauz beim Fange des Kleingeflügels. Jeder Vogel, der sich seiner genügenden Gewandtheit bewußt ist, erscheint gewiß in der Nähe des Gehaßten, um ihn zu necken und zu foppen. Häher und Würger spielen ihm oft in nicht ungefährlicher Weise mit. Letztere vergessen angesichts seiner alle Scheu, kommen, einer nach dem andern, oft von weit her zugeflogen und verlassen die Walstatt auch dann noch nicht, wenn sie sehen müssen, daß dieser oder jener ihrer Gefährten ein klägliches Schicksal erleidet. Die alten holländischen Falkner erbeuteten die zum Falkenfang notwendigen Würger stets mit Hilfe des Wichtls.

1. Sperbereule (
Surnia ulula)
2. Sperlingseule (
Glaucidium passerinum)
Die zierlichste und liebenswürdigste unserer Eulen ist die Zwerg- oder Sperlingseule ( Glaucidium passerinum). Das niedliche Tierchen kennzeichnet sich zunächst durch seine Pygmäengestalt. Der Leib ist gestreckt, der Kopf klein, der Schnabel stark, sehr gekrümmt, mit einem Zahn und Einschnitt an der Schneide des Oberkiefers ausgerüstet, der Fuß kurz und dicht befiedert, der Flügel kurz, die dritte und vierte Schwinge über die andern verlängert, der Schwanz mittellang, das Gefieder minder weich als bei andern Eulen, der Schleier undeutlich. Nach meines Vaters Messungen beträgt die Länge des Männchens siebzehn, die Breite einundvierzig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge gegen sechs Zentimeter. Das Weibchen ist ungefähr zwei Zentimeter länger und um vier Zentimeter breiter. Das Gefieder ist auf der Oberseite mäusegrau, weiß gefleckt, auf der Unterseite weiß mit braunen Längsflecken besetzt, das Gesicht weißgrau, wie mein Vater sagt, »dunkler getuscht«, der Schwanz mit vier, der Flügel mit vielen weißen Binden gezeichnet, der Augenstern hochgelb, der Schnabel horngelb. Das Weibchen ist etwas dunkler als das Männchen und durch zwei dunklere Bogenlinien unter den Augen ausgezeichnet. Bei den Jungen herrscht die braune Färbung vor.
Auch die Zwergeule ist häufiger im Norden als im Süden; ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich aber von Norwegen bis Ostsibirien und von der nördlichen Baumgrenze bis zur Breite von Norditalien. In den Gebirgswaldungen Skandinaviens ist sie nicht selten, in den Wäldern Rußlands sogar häufig, lebt aber auch ständig, und wahrscheinlich keineswegs so selten, als man annimmt, in Deutschland, ist namentlich in Ost- und Westpreußen, Pommern, Schlesien, Sachsen, Thüringen, Hannover, Bayern und Württemberg wiederholt erlegt, auch gefangen worden. Außerdem hat man sie in den schweizerischen, steierischen und italienischen Alpen, im Kaukasus, Burejagebirge und am Amur gefunden.
In Skandinavien erscheint sie manchmal in den Niederungen. Tiefer Schneefall vertreibt sie aus den Wäldern und bringt sie in die Nähe der Dörfer. Alle Waldbewohner kennen mindestens ihren Ruf, einen pfeifenden Laut, der wie »Hi« oder »Ho« klingt. Abgesehen von diesen eintönigen Lauten gibt die Zwergeule auch die Silben »Hi, hu hu hu« zu hören, welch letztere jedoch nur in unmittelbarer Nähe vernommen werden können, schreit auch wohl, zumal im Zwielicht des Morgens und Abends, »Hi hi hi hi«, alle Silben gleichmäßig gedehnt hervorstoßend, oder »Tiwüt, tiwüt, tiwüt, tiwüt.« Im Frühjahr hört man sie schon vor der Dämmerung, nach Tagesanbruch aber nicht mehr rufen. Wie andere Eulen läßt auch sie sich durch Nachahmung ihrer Stimme herbeilocken und verleiten, dem sie in dieser Weise neckenden Menschen auf tausend Schritte und weiter zu folgen, fliegt aber so geräuschlos und setzt sich so rasch auf einem Aste nieder, daß man oft längere Zeit von ihr umflogen wird, bevor man sie zu sehen bekommt. Im Hochsommer jagt sie nur während der Nacht, frühestens von vier Uhr nachmittags an und am eifrigsten in der Dämmerung. Im Verhältnis zu ihrer geringen Größe ist sie ein tüchtiger, ebenso gewandter als kühner Raubvogel. Sie schlägt Mäuse, Lemminge, Fledermäuse und andere Kleinsäuger, vor allem aber Vögel bis zu ihrer eigenen Größe, fängt fliegendes oder laufendes wie sitzendes Wild und verfolgt die Sperlinge oft bis in die Vorhallen bewohnter Gebäude. Vor dem Menschen scheut sie sich wenig, läßt sich daher leicht von ihrem Sitz herabschießen oder in geköderten Fallen aller Art berücken.
Ihr Auftreten schildert von Reichenau in einem an mich gerichteten Brief in anschaulicher Weise: »An sonnigen, schönen Tagen vernehme ich zuweilen in den Vorhölzern und Waldungen der Umgegend von Miesbach einen gedehnt vorgetragenen Vogellaut, der sich durch die Silbe ›Wiht‹ ungefähr wiedergeben läßt. Schon als ich diese Stimme zum erstenmal hörte, fiel sie mir auf, da ich sie keinem gewöhnlichen Tagvogel zutrauen konnte; ihre Ähnlichkeit mit dem bekannten ›Kuwiht‹ des Steinkauzes ließ mich auch auf eine Eule als Urheberin schließen: langer Zeit aber bedurfte es, bis ich den Vogel deutlich zu sehen bekam und in seinem Treiben beobachten konnte. Es war an einem herrlichen Novembertag, als ich inmitten einer mit niedrigem Strauchwerk bewachsenen Waldblöße nicht weit vom Rande einer Wiese auf dem hohen Ast einer Eiche das Tageulchen bemerkte. Es saß dort in aufrechter Stellung mit gelockertem Gefieder, gemütlich sich sonnend, das zierliche Köpfchen mit den hellen Falkenäuglein bald hier, bald da in die Federn versenkend, um diese nestelnd in Ordnung zu bringen. Die Jagdbegierde überwog meine Freude an der Beobachtung: ich legte meine mit mittlerem Schrot geladene Vogelflinte an, schoß und fehlte. Das Käuzchen erhob sich zwar sofort nach dem Schuß, aber nur, um sich mit falkenartigem Flug auf eine kaum dreißig Schritt seitwärts stehende Buche zu begeben. Hier drehte es sich possenhaft unter Bücklingen nach allen Seiten, beständig den kurzen Schwanz in raschem Schwung hoch ausrichtend und ebenso nach abwärts wippend, genau so, wie ein munteres Rotschwänzchen sich benimmt. Nachdem es verschiedenartige Bewegungen ausgeführt, die eher einem Papagei, als einer Eule zuzutrauen gewesen, nachdem es z. B. in drolliger Weise und ganz zwecklos rechts und links seitwärts auf einem wagerechten Ast gelaufen und getrippelt, kurz die größte Lebhaftigkeit an den Tag gelegt, strich es plötzlich ab und faßte auf der Spitze eines etwa acht Meter hohen, astlosen, dürren, durch Blitzstrahl abgebrochenen Eichenstammes Fuß. Hier zeigte sich zur Abwechslung eine ganz andere Gestalt als vorher. Es trug nämlich jetzt sein Gefieder äußerst knapp am Leib, blähte aber Hals und Gesicht so sehr auf, daß der Kopf ein fast viereckiges Ansehen erhielt, sah sich, wie es schien, aufmerksam nach allen Seiten um, sträubte die Kopffedern und legte sie wieder glatt, bekümmerte sich aber so gut wie nicht um meine Anwesenheit, schielte vielmehr immer zum Boden herab. Plötzlich erhob es sich geräuschlos und strich wie ein Weih über den Boden weg; einen Augenblick später quietschte eine Feldmaus, und unter förmlichem Triumphgeschrei ›Dahitt, hitt, hitt‹ flog der kleine Räuber, die Maus in den Fängen tragend, dem nahen etwa drei Meter über dem Boden stehenden Ast einer jungen Eiche zu und tötete sein Opfer vollends durch Schnabelhiebe. Dann saß es, die Flügel halb ausgebreitet und herabgesenkt, mit gesträubtem Gefieder, fast noch einmal so groß erscheinend als früher, über der Beute, würde dieselbe sicherlich auch ohne alle Scheu vor meinen Augen verschlungen haben, hätte ich mich jetzt nicht seiner versichert.«
Infolge seiner Angriffe aus Kleingeflügel ist der Zwergkauz, wo er sich sehen läßt, wie Gloger sagt, ein Gegenstand gehässiger Neugier, aber nicht minder auch des Schreckens und der Furcht für alle kleineren Vögel, die jede Bewegung des winzigen Feindes sogleich in eilige Flucht treibt. »Die Sperlingseule vereinigt« um mit demselben Naturforscher fortzufahren, »die nette Haltung, die Gewandtheit, das rasche, mutvolle Wesen und alle wichtigeren Züge der Tageule mit der wunderlichen Possenhaftigkeit und Gebärdenschneiderei der nächtlichen.«
Um die Zeit des Schnepfenstriches schreitet die Zwergeule zur Fortpflanzung. Sie nistet in Baumhöhlungen namentlich in Spechtlöchern. Ein leider verlassenes Nest, das mein Vater untersuchte, war in der Höhlung einer Buche angelegt und bestand aus Moos und einigen dürren, besser als in andern Eulennestern geordneten Buchenblättern. Anfang der vierziger Jahre brütete eine Zwergeule zwei Sommer nacheinander in einem uralten Birnbaum des Gartens, der Liebes Vaterhaus umgab, und zwar in einem kleinen Astloch mitten im Stamm, während gleichzeitig oben in größeren Astlöchern zwei Starfamilien hausten. Außerdem hat die Zwergeule in Oberlödla bei Altenburg gehorstet, und es sind somit allein für Ostthüringen drei Fälle ihres Brütens bekannt. Daß sie in andern Gegenden Deutschlands ebenfalls zu den Brutvögeln zählt, unterliegt wohl keinem Zweifel. Die weißen Eier haben einunddreißig Millimeter Längs-, fünfundzwanzig Millimeter Querdurchmesser und sind länglichrund, sehr bauchig, feinporig, dick- und glattschalig.
Seitdem ich meines Vaters Schilderung des Gefangenlebens der Zwergeule kenne, war es ein wahrer Herzenswunsch von mir, einmal einen dieser niedlichen Vögel zu pflegen. Die in Rede stehende Zwergeule wurde in einem geräumigen, aber wohlverwahrten Boden untergebracht. »Wenn ich hinauf kam«, sagt mein Vater, »sah ich sie nie, und ich mußte lange suchen, ehe ich sie fand. Gewöhnlich steckte sie in einer Ecke oder da, wo übereinander genagelte Bretter am Giebel Vertiefungen bilden; in diese drückte sie sich so hinein, daß sie kaum zu finden war. Sie stand dabei ganz aufrecht, lehnte sich mit dem Rücken an die Wand an, machte ihren Körper durch Anlegung aller ihrer Federn ganz schmal, sträubte dabei die Seitenfedern des Kopfes, so daß dieser breiter aussah als der Leib, und verhielt sich so ruhig, daß man ganz genau hinsehen mußte, um sie zu bemerken. Die Augen hatte sie mehr geöffnet als der rauhfüßige Kauz und immer starr nach dem gerichtet, der in ihr Behältnis kam. Näherte man sich ihr, dann sträubte sie alle Federn, was diesem kleinen Tier ganz sonderbar stand und sehr natürlich an den Frosch in der Fabel erinnerte. Sie knackte dabei immer von Zeit zu Zeit mit dem Schnabel und gebärdete sich so drollig, daß man sie ohne Lachen nicht ansehen konnte. Wenn man sie in die Hand nahm, betrug sie sich nicht ungestüm und verwundete nicht mit den Fängen, biß aber mit dem Schnabel, was jedoch kaum fühlbar war. Den Tag über verhielt sie sich ganz ruhig; sobald aber die Sonne untergegangen war, wurde sie sehr munter und fing an zu schreien. Ihre Stimme hat große Ähnlichkeit mit der anderer jungen Eulen und klang fast wie ›Gieh‹ oder ›Piep‹, langgezogen, aber sehr leise, nur auf etwa dreißig bis vierzig Schritte hörbar. Am Tage fraß sie nie, sondern nur abends und nachts. Mit einer großen oder zwei kleinen Mäusen oder einem Vogel von der Größe eines Sperlings hatte sie für die Nacht völlig genug. Dieses Tierchen gewährte mir ungemeine Freude; da ich es aber sehr abgezehrt und ermattet erhielt, so war es auch bei dem angemessensten Futter (es bekam lauter Mäuse und Vögel) nicht möglich, es am Leben zu erhalten.«
*
Eine zweite, wohl abgegrenzte, als Unterfamilie angesehene Gruppe der Eulen kennzeichnet sich hauptsächlich durch einen Büschel aufrechtstehender Federn über jedem Ohre. Der Kopf der Ohreulen ( Buboninae) ist gewöhnlich groß, breit und flach, mit mehr oder weniger ansehnlichen, aufrichtbaren Ohrbüscheln geziert, der Schleier dagegen unvollständig, das Federkleid sehr reich und locker. Unter den Sinneswerkzeugen fällt das Auge wegen seiner Größe und Plattheit, in der Regel auch wegen seiner lebhaft goldgelben Farbe auf.
Als die vollendeteste Ohreule darf der vielbekannte, durch mancherlei Sagen verherrlichte »König der Nacht«, unser Uhu, Schuhu, Buhu und wie man ihn sonst noch nennt ( Bubo ignavus), angesehen werden. Seine Länge beträgt dreiundsechzig bis siebenundsiebzig, die Breite hundertfünfundfünfzig bis hundertsechsundsiebzig, die Fittichlänge fünfundvierzig, die Schwanzlänge fünfundzwanzig bis achtundzwanzig Zentimeter. Das sehr reiche und dichte Gefieder ist auf der Oberseite dunkel rostgelb und schwarz geflammt, an der Kehle gelblichweiß, auf der Unterseite rostgelb, schwarz in die Länge gestreift; die Federohren sind schwarz, auf der inneren Seite gelb eingefaßt, die Schwung- und Schwanzfedern mit braunen und gelblichen, dunkler gewässerten Punkten abwechselnd gezeichnet. Eigentlich wechseln im Gefieder nur zwei Farben miteinander ab, ein mehr oder weniger lebhaftes Rötlichgrau und Schwarz. Der Schnabel ist dunkelblaugrau, die nackten Fußschilder sind lichtblaugrau, das Auge ist prachtvoll goldgelb, am äußeren Rande rötlich. Das Weibchen unterscheidet sich nur durch die bedeutendere Größe. Die Jungen pflegen gelblicher zu sein.

Uhu ( Bubo ignavus)
Das Verbreitungsgebiet des Uhu erstreckt sich über das ganze nördliche altweltliche Gebiet, soweit es nach Norden hin bewaldet und im Süden gebirgig ist. In Deutschland zwar in vielen Gegenden ausgerottet, findet er sich doch noch im Bayerischen Hochgebirge und in sämtlichen Mittelgebirgen, ebenso in ausgedehnten und zusammenhängenden Waldungen aller Länder und Provinzen. Ziemlich häufig tritt er auf in Ostpreußen. Weit zahlreicher bewohnt er Österreich-Ungarn, Skandinavien, ganz Rußland, die Donautiefländer, die Türkei und Griechenland, Italien, Spanien und Südfrankreich, ohne daß man ihn jedoch irgendwo gemein nennen könnte; seltener wiederum ist er in Belgien und Dänemark, fast vertilgt in Großbritannien. In Afrika beschränkt sich, obschon er ausnahmsweise auch in Ägypten vorkommt, sein Wohngebiet auf die Atlasländer; in Asien dagegen haust er von Kleinasien und Persien an bis China und von der nördlichen Waldgrenze an bis zum Himalaja, ohne die Steppe zu meiden, in allen Ländern und Gefilden, deren Tierwelt uns genauer bekannt geworden ist. Er wandert nicht, verweilt vielmehr jahraus jahrein in seinem Brutgebiet und streicht höchstens, solange er sich nicht gepaart hat, ziel- und regellos durch das Land.
Der Uhu, auf den ich die nachfolgende Darstellung beschränke, bevorzugt gebirgige Gegenden, weil sie ihm die besten Schlupfwinkel gewähren, findet sich jedoch ebenso in den Ebenen, vorzugsweise da, wo es große Waldungen gibt. Wälder mit steilen Felswänden sagen ihm besonders zu, und manche günstige Örtlichkeit wird seit Menschengedenken von ihm bewohnt. Es kann vorkommen, daß er ausgerottet wurde und man in dem betreffenden Gebiete jahrelang keinen Uhu bemerkte; dann plötzlich hat sich wieder, gewöhnlich genau auf derselben Stelle, ein Paar angesiedelt, und dieses verweilt nun solange hier, als der Mensch es ihm gestattet. Nicht allzuselten geschieht es, daß sich ein Paar in unmittelbarer Nähe der Ortschaften ansiedelt. So erhielt Lenz junge Uhus, die auf dem Dachboden einer tief im Walde gelegenen Fabrik ausgebrütet worden waren. Demungeachtet zeigt sich der Uhu immer vorsichtig. Tagsüber sieht man ihn selten; denn seine Färbung stimmt vortrefflich mit der Farbe einer Felsenwand und ebenso mit der Rinde eines Baumes überein; doch geschieht es, daß irgendein kleiner Singvogel ihn entdeckt, dies schreiend der ganzen Waldbevölkerung mitteilt, andere Schreier herbeizieht und ihn so verrät. Nachts gewahrt man ihn öfter, und im Frühjahr während der Zeit seiner Liebe macht er sich durch auffallendes und weittönendes Schreien sehr bemerklich.
Sein Jagdleben beginnt erst, wenn die Nacht vollkommen hereingebrochen ist. Bei Tage sitzt er regungslos in einer Felsenhöhle oder in einem Baumwipfel, gewöhnlich mit glatt angelegtem Gefieder und etwas zurückgelegten Federohren, die Augen mehr oder minder, selten aber vollständig geschlossen, einem Halbschlummer hingegeben. Das geringste Geräusch ist hinreichend, ihn zu ermuntern. Er richtet dann seine Federbüsche auf, dreht den Kopf nach dieser oder jener Seite, bückt sich wohl auch auf und nieder und blinzelt nach der verdächtigen Gegend hin. Fürchtet er Gefahr, so fliegt er augenblicklich ab und versucht einen ungestörteren Versteckplatz zu gewinnen. Ging der Tag ohne jegliche Störung vorüber, so ermuntert er sich gegen Sonnenuntergang, streicht mit leisem Flug ab, gewöhnlich zunächst einer Felskuppe oder einem hohen Baum zu, und läßt hier im Frühjahr regelmäßig sein dumpfes, aber auf weithin hörbares »Buhu« ertönen. In mondhellen Nächten schreit er öfter als in dunkleren, vor der Paarungszeit fast ununterbrochen durch die ganze Nacht. Sein Geschrei hallt im Walde schauerlich wieder, so daß, wie Lenz sich ausdrückt: »abergläubischen Leuten die Haare zu Berge stehen.« Es unterliegt keinem Zweifel, daß er die Sage vom wilden Jäger ins Leben gerufen hat, daß er es war und ist, dessen Stimme der ängstlichen Menschheit als das Rüdengebell des bösen Feindes oder wenigstens eines ihm verfallenen Ritters erscheinen konnte. Dieses Geschrei läßt den Schluß zu, daß er während der ganzen Nacht in Tätigkeit und Bewegung ist. Man hört es bald hier, bald dort im Walde bis gegen den Morgen hin. Es ist der Lockruf und Liebesgesang, wogegen ein wütendes Gekicher, ein lauttönendes Kreischen, das mit lebhaftem Fauchen und Zusammenklappen des Schnabels begleitet wird, Ingrimm oder Ärger ausdrückt. Zur Paarungszeit kann es vorkommen, daß zwei Uhumännchen sich heftig um die Liebe des Weibchens streiten und man dann alle die beschriebenen Laute nach- und zwischeneinander vernimmt.
Die Jagd des Uhu gilt den verschiedensten Wirbeltieren, groß und klein. Er ist nachts ebenso gewandt als kräftig und mutig und scheut sich deshalb keineswegs, auch an größeren Geschöpfen seine Stärke zu erproben. Ebenso leise schwebend wie seine Artverwandten, streicht er gewöhnlich niedrig über dem Boden dahin, erhebt sich aber auch mit Leichtigkeit in bedeutende Höhen und bewegt sich so schnell, daß er einen aus dem Schlaf aufgescheuchten Vogel regelmäßig zu fangen weiß. Daß er Hasen, Kaninchen, Auer-, Birk-, Hasel- und Rebhühner, Enten und Gänse angreift, deshalb also schädlich wird, daß er weder schwache Tagraubvögel, Raben und Krähen, noch schwächere Arten seiner Familie verschont und ebensowenig vom Stachelkleid des Igels sich abschrecken läßt, ist sicher, daß er die schlafenden Vögel durch Klatschen mit den Flügeln oder Knacken mit dem Schnabel erst zur Flucht aufschreckt und dann leicht im Flug fängt, höchst wahrscheinlich. Doch fragt es sich sehr, ob er wirklich mehr schädlich als nützlich ist. Mäuse und Ratten dürften dasjenige Wild sein, das auch er am eifrigsten verfolgt.
In den ersten Monaten des Jahres, gewöhnlich im März, schreitet unser Uhu zur Fortpflanzung. Er ist ein ebenso treuer als zärtlicher Gatte. Der Horst steht entweder in Felsennischen, in Erdhöhlungen, in alten Gebäuden, auf Bäumen oder selbst auf dem flachen Boden und im Röhricht. Wenn irgend möglich, bezieht er einen schon vorgefundenen Bau und nimmt sich dann kaum die Mühe, denselben etwas aufzubessern; wenn er nicht so glücklich war, trägt er sich einige Äste und Reiser zusammen, polstert sie einigermaßen mit trockenem Laub und Genist aus oder plagt sich nicht einmal mit derartigen Arbeiten, sondern legt seine zwei bis drei rundlichen, weißen, rauhschaligen Eier ohne weiteres auf den Boden ab. Das Weibchen brütet sehr eifrig und wird, solange es auf den Eiern sitzt, vom Männchen ernährt. Den Jungen schleppen beide Eltern so viel Nahrung zu, daß sie nicht nur nie Mangel leiden, sondern im Gegenteil stets mehr als überreich versorgt sind. Wodzicki besuchte einen Uhuhorst, der im Röhricht, inmitten eines Sumpfes angelegt und einer Bauernfamilie die ergiebigste Fleischquelle gewesen war. Um den Horst herum lagen die Überbleibsel von Hasen, Enten, Rohr- und Bläßhühnern, Ratten, Mäusen und dergleichen in Masse, und der Bauer versicherte, daß er schon wochenlang tagtäglich hierher gekommen, alles Genießbare zusammengesucht und sich sehr gut dabei gestanden habe. Bei Gefahr verteidigen die Uhueltern ihre Jungen auf das mutvollste und greifen alle Raubtiere und auch die Menschen, die sich ihnen nahen, heftig an. Außerdem hat man beobachtet, daß die alten Uhus ihre Jungen andern Horsten zutrugen, nachdem sie gemerkt hatten, daß der erste nicht hinlängliche Sicherheit bot. Eine sehr hübsche Geschichte wird von Wiese mitgeteilt: »Ein Oberförster in Pommern hält schon seit längerer Zeit einen gezähmten Uhu auf dem Hof in einem dunklen Verschlag. In einem Frühjahr läßt sich nun zur Paarungszeit auf dem Hofe der Oberförsterei, der inmitten des Kiefernwaldes ganz allein liegt, ein wilder Uhu hören. Der Oberförster setzt in den ersten Tagen des April den Uhu, an beiden Fängen gefesselt, aus. Der wilde Uhu, ein Männchen, gesellt sich sehr bald zum zahmen, und was geschieht: er füttert den gefesselten regelmäßig in jeder Nacht, was einmal aus den Überbleibseln, aus dem Gewölle ersichtlich und dann dadurch bewiesen ist, daß der Uhu in beinahe vier Wochen vom Eigentümer nicht gefüttert wurde. Nähert man sich bei Tage dem zahmen Uhu, so läßt der wilde in dem gegenüberliegenden Kiefernbestand sofort sein ›Uhu‹ oder ›Buhu‹ erschallen und verstummt erst dann, wenn man sich längere Zeit entfernt hat.« Innerhalb vier Wochen lieferte der wilde Uhu drei Hasen, eine Wasserratte, unzählige andere Ratten und Mäuse, eine Elster, zwei Drosseln, einen Wiedehopf, zwei Rebhühner, einen Kiebitz, zwei Wasserhühner und eine Wildente. Wiederholt ist beobachtet worden, daß alte Uhus, deren Junge man wegnahm und in einen Bauer sperrte, diese vollends ausfütterten. Einer der Jäger des Grafen Schimmelmann hat viele Jahre lang ein Uhupaar gefangen gehalten und zu Anfang der fünfziger Jahre wiederholt Junge gezüchtet. Die Vögel wurden schon im Spätherbst aus ihrem gewöhnlichen Bauer herausgenommen und in einen geräumigen Verschlag der Scheune gebracht, dessen eine Ecke zum Brutplatz vorgerichtet worden war. In der Regel wurden die Eier bereits um die Weihnachtszeit gelegt. Mein Gewährsmann, für dessen Glaubwürdigkeit ich selbst jede Bürgschaft übernehmen würde, beobachtete sowohl die brütenden Alten wie später die erbrüteten Jungen, die von ihren Eltern mit größter Liebe bewacht und gegen jeden Eindringling in gewohnter Weise verteidigt wurden. Dasselbe ist in der Schweiz und in Belgien geschehen. Im Tiergarten zu Karlsruhe legte ein Uhuweibchen sechs Jahre nacheinander je vier Eier, begann, sowie das erste gelegt war, mit dem Brüten und blieb fortan, eifrig brütend, auf ihnen sitzen. Neumeier, dem wir diese Mitteilung verdanken, gönnte sich im ersten Jahre den Spaß, ihm statt seiner eigenen vier Eier der Hausente unterzuschieben. Mit gewohntem Eifer brütete es volle achtundzwanzig Tage und hatte das Glück, vier Entchen ausschlüpfen zu sehen; sowie aber diese sich zu rühren begannen, nahm es eines nach dem andern, um dasselbe zu erwürgen und zu verzehren. Alle Bestrebungen, ihm ein Männchen anzupaaren, scheiterten an seiner Unverträglichkeit.
Keine einzige unserer deutschen Eulen wird so allgemein gehaßt wie der Uhu. Fast sämtliche Tagvögel und sogar einige Eulen necken und foppen ihn, sobald sie seiner ansichtig werden. Die Raubvögel lassen sich, wie schon berichtet, zur größten Unvorsichtigkeit hinreißen, wenn sie einen Uhu erblicken, und die Raben schließen sich ihnen treulich an. Doch dürften, vom Menschen abgesehen, alle diese Gegner kaum gefährlich werden.
In der Gefangenschaft hält der Uhu bei geeigneter Pflege viele Jahre aus. Gewöhnlich zeigt er sich auch gegen den, der ihm tagtäglich sein Futter reicht, ebenso ärgerlich und wütend als gegen jeden andern, der sich seinem Käfig nähert; doch ist es immerhin möglich, sehr jung aus dem Nest genommene Uhus, mit denen man sich viel beschäftigt, zu zähmen. Einen habe ich durch liebevolle Behandlung so weit gebracht, daß ich ihn auf der Hand herumtragen, streicheln, am Schnabel fassen und sonst mit ihm verkehren durfte, ohne mich irgendwelcher Mißhandlung auszusetzen. Bei Meves in Stockholm sah ich einen andern, der sich nicht bloß angreifen und streicheln ließ, sondern auch auf seinen Namen hörte, antwortete und herbeikam, wenn er gerufen wurde, ja sogar freigelassen werden konnte, weil er zwar kleine Ausflüge unternahm, aber doch nie entfloh, sondern regelmäßig aus freien Stücken zu seinem Gebieter zurückkehrte. Mit seinesgleichen lebt der gefangene Uhu, wenn er erwachsen ist, in Frieden; schwächere Vögel fällt er mörderisch an, erwürgt sie und frißt sie dann mit größter Gemütsruhe auf.
*
Unsere Waldohreule ( Asio otus), hier und da auch Ohr-, Katzen-, Fuchs- und Ranzeule genannt, ist ein Uhu im kleinen, unterscheidet sich aber von diesem durch schlankeren Leibesbau, längere Flügel, in denen die zweite Schwinge die andern überragt, kürzere Füße, längere Federohren und durch die sehr ausgebildeten Gehörmuscheln, deshalb auch sehr deutlichen Schleier. In der Färbung hat die Waldeule mit dem Uhu viel Ähnlichkeit; ihr Gefieder ist aber lichter, weil die rostgelbe Grundfarbe weniger von den schwarzen Schaftstrichen und Querstreifen der Federn verdeckt wird, die Oberseite auf trüb rostgelblichem Grunde dunkel graubraun gefleckt, gepunkelt, gewellt und gebändert, die lichtere Unterseite mit dunkelbraunen, auf der Brustgegend quer verästelten Längsflecken gezeichnet, die Ohrmuschel an der Spitze und auf der Außenseite schwarz, auf der Innenseite weißlich, der Gesichtskreis graulich rostgelb. Die Schwingen und Schwanzfedern sind gebändert. Der Schnabel ist schwärzlich, das Auge hochgelb. Die Weibchen sind etwas dunkler, die Jungen minder lebhaft gefärbt als das Männchen. Die Länge beträgt vierunddreißig bis fünfunddreißig, die Breite einundneunzig bis achtundneunzig, die Fittichlänge neunundzwanzig, die Schwanzlänge fünfzehn Zentimeter.

Waldohreule ( Asio otus)
Vom vierundsechzigsten Grad nördlicher Breite an verbreitet sich die Waldohreule über ganz Europa und ebenso vom Nordrand des Waldgürtels an über Mittelasien, vom Ural bis Japan. Nach Süden hin wird sie seltener. Sie verdient ihren Namen; denn sie findet sich regelmäßig nur im Walde. Nachts kommt sie zwar bis in die Nähe der Ortschaften heran, und während ihrer Strichzeit nimmt sie übertags wohl auch in einem dicht bestandenen Obstgarten oder selbst auf freiem Felde Herberge; dies aber sind Ausnahmen. Ob sie den Nadel- oder ob sie den Laubwald bevorzuge, ist schwer zu sagen; man findet sie ebenso häufig hier wie dort.
In ihrer Lebensweise und ihrem Betragen unterscheidet sich die Waldeule nicht unwesentlich von dem Uhu. Bei Tage benimmt sie sich allerdings ganz ähnlich wie dieser, fliegt auch ungefähr zu derselben Zeit und ungefähr in gleicher Weise zur Jagd aus; aber sie ist weit geselliger und viel weniger wütend als ihr großer Verwandter, auch selten scheu. Wenn sie bei Tage aufgebäumt hat, läßt sie sich, ohne an Flucht zu denken, unterlaufen; ja, es ist mir vorgekommen, daß ich sie erst durch Schütteln am Baum zum Auffliegen habe bewegen können. Nur während der Brutzeit hält sie sich paarweise; sobald ihre Jungen erwachsen sind, schlägt sie sich mit andern ihrer Art in Flüge zusammen, die zuweilen recht zahlreich werden können. Gegen den Herbst hin streichen diese Gesellschaften im Lande auf und nieder, und man trifft sie dann an passenden Orten zuweilen sehr häufig an. Ich habe Trupps von einigen zwanzig und mehr gesehen, die beinahe auf einem und demselben Baum Platz genommen hatten. Noch zahlreichere Gesellschaften scharen sich weiter nach Süden hin, beispielsweise in Österreich und Ungarn. »Auf den Ackerfeldern Niederösterreichs«, so schreibt mir Erzherzog Rudolf von Österreich, »begegnete ich zuweilen während der Hasenjagd im November ganzen Zügen von Waldohreulen, die mitten in den Feldern unbeweglich wie Pflöcke zwischen den Erdschollen standen und erst in nächster Nähe der Schützen langsamen Fluges ein wenig weiterzogen, um sich dann von neuem niederzulassen, zuletzt aber, nachdem sie einige Male aufgescheucht worden waren, in immer größeren Kreisen zu merklicher Höhe sich emporschraubten und über die Schützenlinie hinweg nach ihrem ersten Standplatz zurückflogen. Auch in jungen Laubholzdickungen von kaum mehr als Manneshöhe begegnete ich häufig solchen Wanderflügen, niemals aber vor Ende November und nicht länger als bis zur Mitte des Winters.«
Für mich unterliegt es keinem Zweifel, daß es nicht allein die Geselligkeit, sondern auch die in einer bestimmten Gegend reichlich zu findende Nahrung ist, die die Waldohreule zu so zahlreichen Scharen gesellt. Auch an Brutplätzen tritt sie, je nach den Mäusejahren, bald in größerer Anzahl, bald nur Paarweise auf. Ihre Jagd gilt hauptsächlich kleinen Säugetieren, und zwar in erster Reihe den Wald- und Ackermäusen sowie den Spitzmäusen. Ein täppisches Vögelchen wird nicht verschont und ein krankes oder ermattetes Rebhuhn unter Umständen ebenfalls mitgenommen: diese Übergriffe aber sind kaum der Erwähnung wert. Den Mäusen stellt sie hauptsächlich am Rande oder auf Blößen der Waldungen nach, läßt sich aber wohl auch dann und wann zu weiteren Ausflügen auf die benachbarten Felder verleiten.
Wenn man die Waldohreule bei Tag im dichtesten Schatten des Waldes hart an den Stamm gelehnt, auf einem Ast sitzen sieht, hoch aufgerichtet wie ein stehender Mann, alle Federn knapp an den Leib gelegt und beide oder nur ein Auge ein wenig geöffnet, um blinzelnd auf den verdächtigen Eindringling herabzuschauen, und sodann durch Beobachtung erfährt, daß sie immer erst nach Eintritt der Dämmerung auf ihre Jagd auszieht, ist man allerdings geneigt zu glauben, daß sie das Tageslicht scheue, beziehentlich durch die Sonne geblendet und am richtigen Sehen verhindert werde. Eine solche Auffassung entspricht der Tatsächlichkeit aber keineswegs. So lichtscheu sie sich gebärdet, so sehr bedarf sie des Sonnenscheins: sie geht zugrunde, wenn man ihr in der Gefangenschaft die Sonne gänzlich entzieht. »Sobald nachmittags die Sonnenstrahlen ihren Käfig treffen«, schreibt mir Walter, »blickt sie mit weitgeöffneten Augen, gehobenem Kopf, die Brust herausgekehrt und der Sonne zugewendet, gerade in das Tagesgestirn und breitet Flügel und Schwanz, um ja allen Teilen die Wohltat der Sonnenwärme zu verschaffen. War mehrere Tage nacheinander trübes Wetter und die Sonne verhüllt, dann springt sie herab in den Sand und hockt in derselben Stellung wie sonst lange Zeit auf der früher beschienenen Stelle. Ergötzlich war es anzusehen, wie diese Eule beim Anzünden des Weihnachtsbaumes von ihrer Sitzstange herab in den Sand sprang und dort in gleicher Weise sich niederhockte, regungslos verharrend, den Kopf unbeweglich in die Schultern zurückgelegt und das volle Gesicht dem strahlenden Baum zugekehrt. Sie hielt den ungewöhnlich starken Lichterglanz offenbar für Sonnenschein. Wenn ich abends arbeite, steht meine Lampe hart am Käfig der Eule, und sie rückt dann gewöhnlich so dicht an die Sprossen, daß zwischen ihr und der Flamme kaum fünfzehn Zentimeter Zwischenraum bleibt. Auf dieser Stelle verweilt sie oft stundenlang. Wie trefflich sie bei Tage sieht, erfuhr ich bei folgender Gelegenheit: An einem Mittag um ein Uhr, als die Sonne bei mir durchs Fenster schien, bemerkte ich, daß die Ohreule sehr scharf zu einem Punkt an der Decke senkrecht über mir ausblickte und durch Drehen des Kopfes ihre Teilnahme für diesen Punkt ausdrückte. Der Richtung folgend, sah ich von meinem Platz aus über mir eine Spinne, kleiner als eine Fliege, an der Decke sitzen. Da die Eule bald gleichgültig nach einer andern Richtung hinblickte, bald aber wieder mit der regsten Aufmerksamkeit jene Spinne betrachtete, stieg ich auf einen Stuhl, um letztere zu beobachten, und bemerkte nun, daß diese, ohne ihre Lage zu verändern, bald mit den Beinen am Gewebe arbeitete, bald wieder untätig in ihrem Netze saß. Ruhte sie bei ihrer Arbeit, so wandte die Eule sich gleichgültig ab; begann sie zu haspeln, ohne den Körper dabei zu verrücken, dann beobachtete sie die Eule auf das schärfste.«
Alte verlassene Nester einer Krähe, einer Ringeltaube, der Bau eines Eichhörnchens oder der Horst eines Tagesraubvogels müssen der Waldeule zur Wiege der Jungen dienen. An eine Aufbesserung des vorgefundenen Nestes denkt sie nicht. Sie legt im März ihre vier runden weißen Eier ohne jegliche Vorbereitung auf den Boden des vorgefundenen Nestes und bebrütet sie drei Wochen lang sehr eifrig, währenddem sie sich von dem Männchen atzen läßt. Dieses hat vorher seiner Liebesbegeisterung durch lautes Geschrei, den Silben »Huihui« und »Wump« vergleichbar, oder durch klatschendes Schlagen mit den Flügeln Ausdruck gegeben und hält sich, solange das Weibchen brütet, in nächster Nähe desselben auf, hält treue Wacht und wird laut, sobald ein Feind sich dem Horste nähert »Ich habe«, sagt mein Vater, »öfter seinen Mut bewundert, wenn es mit lautem ›Wau, wau‹ die Annäherung einer Gefahr verkündete und nicht selten mit augenscheinlicher Todesverachtung den Feind umflog. Wenn ich die Weibchen geschossen hatte, waren die Männchen mit allem Eifer bemüht, die fehlende Mutter zu ersetzen, und wurden dann fast immer mit leichter Mühe von mir erlegt, wogegen sie sich vorher gewöhnlich außer Schußweite gehalten hatten.« Die Jungen bedürfen viele Nahrung, kreischen und pfeifen fortwährend, als ob ihr Hunger niemals gestillt würde, und treiben die zärtlichen Eltern zu ununterbrochener Mäusejagd an. Leider verraten sie sich böswilligen oder dummen Menschen durch ihr Schreien nur zu oft und finden dann häufig ein schmähliches Ende. Hebt man sie aus dem Horste, wenn sie noch mit Wollflaum bedeckt sind, und gibt sich dann viel mit ihnen ab, so wecken sie nach kurzer Pflege ungemein zahm und ergötzen ihren Herrn und Gebieter weidlich.
Auch die Waldohreule ist dem gesamten Tagesgeflügel sehr verhaßt und wird geneckt und gefoppt, sobald sie sich sehen läßt. Der verständige Mensch läßt sie unbehelligt und tut sehr wohl daran, weil jeder Schutz, den man ihr gewährt, dem Wald zugute kommt. Die Waldohreule nützt, solange sie lebt. Ihr Nahrungsbedarf ist zwar gering; aber sie kann, gleichviel ob sie hungrig ist oder nicht, eine Maus nicht erblicken, ohne sich auf sie zu stürzen, fängt daher mehr Mäuse, als sie verzehrt. Günstigen Falles trägt sie letztere ins Versteck und holt sie gelegentlich aus ihm hervor, wenn sie im Jagen erfolglos war. Nur bei sehr großem Hunger frißt sie eine geschlagene Maus sofort, nachdem sie dieselbe getötet; in der Regel reißt sie ihr den Kopf ab und trägt das übrige, wenn auch nur für kurze Zeit, einem Versteckplatz zu. Hat aber ein Paar Junge, dann schleppt es so viele Mäuse heran, als es irgendwie kann, belegt mit ihnen, nachdem auch die Jungen gesättigt sind, den ganzen Horst und leistet so für ihre Größe Erstaunliches.
Die Sumpfeule, Moor-, Bruch- oder Kohleule ( Asio brachyotus) ähnelt der Waldeule so, daß sie oft mit ihr verwechselt worden ist. Ihr Kopf ist jedoch kleiner; die kurzen Federohren bestehen nur aus zwei bis vier Federn; die Flügel sind verhältnismäßig lang und reichen weit über den Schwanz hinaus. Die Grundfärbung ist ein angenehmes Blaßgelb, der Schleier weißlichgrau, die Kopf- und Rumpffedern sind mit schwarzen Schaftstrichen gezeichnet, die bis zur Brust herabreichen, auf dem Bauch aber sich verschmälern und verlängern, die Flügeldecken an der Außenseite gelb, an der Innenseite und an der Spitze aber schwarz, die Schwingen und Schwanzfedern graubraun gebändert. Das Auge ist nicht dunkel-, sondern lichtgelb, der Schnabel hornschwarz. Junge Vögel sind dunkler als die alten. Die Länge beträgt sechsunddreißig, die Breite ungefähr achtundneunzig, die Fittichlänge achtundzwanzig, die Schwanzlänge fünfzehn Zentimeter.
Die Sumpfeule, ursprünglich Bewohnerin der Tundra, ist im buchstäblichen Sinne des Wortes Weltbürgerin. Genötigt, allherbstlich von jener aus eine Wanderung anzutreten, besucht sie zunächst alle drei nördlichen Erdteile, durchstreift bei dieser Gelegenheit ganz Europa und Asien, fliegt von hier wie dort aus nach Afrika und wahrscheinlich von Asien her nach den Sandwichinseln hinüber und durchwandert ebenso Amerika vom hohen Norden an bis gegen die Südspitze hin. Zwar hat man sie innerhalb dieser Grenzen noch nicht überall, beispielsweise weder in Australien noch in Südafrika beobachtet; es läßt sich jedoch kaum annehmen, daß sie hier fehlen wird.
In der Tundra treibt man dann und wann eine Sumpfeule auch bei Tage auf; gewöhnlich aber bemerkt man sie nicht vor Beginn der Nachtstunden. Zwar scheut sie sich auch bei Tage nicht umherzufliegen, tut es jedoch nur ausnahmsweise, wogegen sie in den Abend- und Nachtstunden regelrecht ihrer Jagd obliegt. Entsprechend der im Hochsommer wenig geminderten Helligkeit der Nordlandsnacht, jagt sie anders als die meisten Eulen, in viel bedeutenderer Höhe über dem Boden nämlich, fast nach Art unseres Bussards, nur daß sie mehr und auch in anderer Weise als dieser zu rütteln pflegt. Sie fliegt mit weit ausholenden Flügelschlägen und behält auch beim Rütteln diese Art der Bewegung bei, eilt zuweilen in überraschend schnellem, fast gaukelndem Flug eine Strecke weiter, stellt sich wiederum rüttelnd fest, untersucht dabei das unter ihr liegende Jagdgebiet auf das genaueste und stürzt sich in mehreren Absätzen bodenabwärts, um einen Lemming, ihr gewöhnliches Jagdwild, zu erbeuten. Bei uns zulande pflegt sie sich Mitte September einzustellen und bis gegen Ende Oktober hin durchzuwandern, im März aber langsam zurückzukehren. Während ihrer Reise nimmt sie zwar auf allen nicht oder wenig bewaldeten Ebenen Herberge, bevorzugt aber doch sumpfige Gegenden, hält sich bei Tage zwischen Gras und Schilf verborgen am Boden auf, drückt sich bei Gefahr wie ein Huhn auf die Erde, läßt den Feind dicht an sich herankommen, fliegt aber noch zur rechten Zeit empor und dann sanft, schwankend, niedrig und ziemlich langsam, weihenartig, dahin, obwohl sie unter Umständen auch zu großen Höhen emporsteigt. Hier treibt sie vor allem Mäusejagd und vergreift sich wohl nur ausnahmsweise an größeren Tieren, obwohl sie selbstverständlich kleine ungeschickte Vögel nicht verschmäht und ebenso Maulwürfe wegnimmt, während diese Erde aufstoßen, oder an einem noch schwachen Hasen und Kaninchen sich vergreift. Im Notfalle begnügt sie sich mit Kerbtieren oder Fröschen.
Nicht immer kehrt die Sumpfeule nach ihrer hochnordischen Heimat zurück, läßt sich im Gegenteil durch besonders reichliche Nahrung zuweilen bestimmen, ihren sommerlichen Aufenthalt auch in Gegenden zu nehmen, die außerhalb ihres Verbreitungsgebiets liegen. Wenn beispielsweise in Skandinavien der Lemming auf den südlichen Fjelds zahlreich auftritt, wie es, laut Collet, im Jahre 1872 der Fall war, verfehlt sie nicht, sich dort einzustellen und dann auch zu brüten. Ebenso geschieht es bei uns zulande, wenn wir durch Mäusepest heimgesucht werden. In dem mäusereichen Jahr 1857 brüteten, laut Blasius und Baldamus, in den Brüchen zwischen dem Elb- und Saalezusammenflusse nicht weniger als ungefähr zweihundert Paare unserer Eule. Der Horst steht regelmäßig auf dem Boden, möglichst versteckt zwischen Gräsern, ist ein höchst unordentlicher Bau und enthält im Mai sechs bis zehn reinweiße Eier von vierzig bis siebenundvierzig Millimeter Längs- und vierundzwanzig bis sechsundzwanzig Millimeter Querdurchmesser, die sich von denen der Waldohreule nur durch die schlanke Eiform, die im ganzen geringere Größe, die feinere und glattere Schale und die kleineren und weniger tiefen Poren unterscheiden. Auch die Sumpfeule ist im Horste außerordentlich kühn und angriffslustig. Jeder sich nahende Raubvogel wird wütend angegriffen und ebenso wie jede Krähe in die Flucht geschlagen. Dem Menschen, der die Brut rauben will, ergeht es nicht anders: einer meiner Bekannten im Spreewalde wurde bei solcher Gelegenheit so ernstlich bedroht, daß er sich kräftig verteidigen mußte, um Gesicht und Augen vor dem kühn herabstoßenden Vogel zu schützen.
Obschon die Sumpfeule zuweilen Übergriffe sich erlauben mag, muß man sie doch als einen höchst nützlichen Vogel betrachten und sollte sich über ihr Erscheinen freuen, anstatt sie zu befehden.
*
Ein schlanker Leib mit ziemlich großem Kopfe und stark gekrümmtem Schnabel, sowie verhältnismäßig glatt anliegendes, buntfarbiges Gefieder, dicke, kurze Federohren und ein wenig bemerklicher Schleier kennzeichnen die Zwerge unserer Familie ( Scops), die ihrer geringen Größe wegen Zwergohreulen genannt werden.
Die Zwergohreule, Posseneule, Waldteufelchen usw. ( Scops carniolica) ist fünfzehn bis achtzehn Zentimeter lang und sechsundvierzig bis einundfünfzig Zentimeter breit; die Fittichlänge beträgt vierzehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Auf der Oberseite herrscht ein durch Aschgrau gedämpftes Rotbraun vor, das schwärzlich gewässert und längsgestreift, auf dem Flügel aber weiß und in der Schultergegend rötlich geschuppt ist; die Färbung der ganzen Unterseite mag als ein verworrenes Gemisch von Braunrostgelb und Grauweiß bezeichnet werden. Der Schleier ist undeutlich, die Federohren sind mittellang. Der Schnabel ist blaugrau, der Fuß dunkelbleigrau, das Auge hell schwefelgelb. Männchen und Weibchen lassen sich kaum unterscheiden; die Jungen sind etwas trüber gefärbt und minder bunt gezeichnet als die Alten.
Erst von Süddeutschland an nach Süden hin ist die Zwergohreule eine gewöhnliche Erscheinung; nach Nord- und Mitteldeutschland oder Großbritannien verirrt sie sich nur. Horstend trifft man sie einzeln am Rhein und im Alpengebiet, öfter aber schon in Südfrankreich und häufig in ganz Südeuropa; außerdem kommt sie in Mittelasien, nach Osten hin bis Turkestan, mehr oder weniger regelmäßig vor. In Europa ist sie Zugvogel, der ziemlich früh im Jahre, in den letzten Tagen des März oder in den ersten des April, erscheint, aber auch ziemlich bald, im September, spätestens Anfang Oktober wieder wegwandert und seine Reise bis ins tiefste Innere von Afrika ausdehnt.
Die Zwergohreule scheut sich nicht vor dem Menschen, sondern siedelt sich unmittelbar in dessen Nachbarschaft an. Aber es ist doch nicht leicht, sie aufzufinden. Auch sie hält sich bei Tage ganz ruhig, dicht an einen Baumstamm gedrückt oder auch unter Weinlaub verborgen, niedrig über dem Boden sitzend, und schmiegt sich trotz ihrer bunten Zeichnung so innig der Rindenfärbung an oder verliert sich so vollständig in dem Gelaube, daß nur der Zufall sie in Sicht bringt. Erst nach Sonnenuntergang sieht man sie in gewandtem, mehr falken- als eulenartigem Fluge jagend niedrig über dem Boden. Die Stimme, die ich auffallenderweise nie vernommen habe, ist ein weithin tönender Laut, von dem die italienischen Volksnamen des Vogels, »Chiu«, »Ciu« und »Cioui«, Klangbilder sind. Junge Zwergohreulen wispern in eigentümlicher Weise.
Im Verhältnis zu ihrer geringen Größe ist die Zwergohreule ein tüchtiger Räuber. Ihre Jagd gilt vorzugsweise kleinen Wirbeltieren, nicht aber Kerfen, wie man geneigt ist zu glauben. In dem Magen der getöteten fand ich hauptsächlich Mäuse; meine gefangenen aber fielen mörderisch auch kleine Vögel an, und eine von ihnen, die ich frei im Zimmer herumfliegen ließ, fing mit großer Gewandtheit und Geschicklichkeit vor meinen Augen eine Fledermaus, die durch die offene Tür hereingekommen war, und erwürgte sie im Umsehen.
Die Niststätte befindet sich in Baumhöhlungen und enthält frühestens gegen Ende des Mai kleine, rundliche, weiße Eier, deren Längsdurchmesser einunddreißig, und deren Querdurchmesser sechsundzwanzig Millimeter beträgt. In den ersten Tagen des Juli erhielten wir ein noch blindes Junges, wenige Tage später deren drei, die von uns mit Sorgfalt gepflegt und nach kurzer Gefangenschaft ungemein zahm wurden. Sie ließen sich von uns nicht bloß berühren, sondern auch, ohne wegzufliegen, auf dem Finger im Zimmer umhertragen, nahmen uns vorgehaltene Speise aus der Hand und ergötzten uns durch ihr munteres, possenhaftes Wesen aufs höchste. Von einer jung aufgezogenen Zwergohreule schreibt mir mein Bruder, daß sie der liebste Gespiele seines Kindes sei. Die Haltung verursacht keine Schwierigkeit. Ich zweifle nicht, daß es gelingen wird, von gefangenen Zwergohreulen Junge zu erzielen. Zwei meiner Pfleglinge hatten sich gepaart und drei Eier gelegt. Das Weibchen brütete eifrig, starb aber leider, ehe die Eier gezeitigt waren.
*
Nachtkäuze ( Syrniinae) nennt man alle Eulen mit großem rundem Kopf ohne Federohren, aber einer außergewöhnlich großen Ohröffnung und ihr entsprechendem deutlichen Schleier. Die in Deutschland geeigneten Ortes überall vorkommende Art ist der Wald- oder Baumkauz ( Syrnium aluco). Der Kopf ist außergewöhnlich groß, die Ohröffnung aber minder ausgedehnt als bei anderen Arten der Familie, der Hals dick, der Leib gedrungen, der große, zahnlose Schnabel stark und gekrümmt, der Schwanz kurz. Die Grundfärbung des Gefieders ist entweder ein tiefes Grau oder ein lichtes Rostbraun, der Rücken, wie gewöhnlich, dunkler gefärbt als die Unterseite, der Flügel durch regelmäßig gestellte lichte Flecken gezeichnet. Der Schnabel ist bleigrau, das Auge tief dunkelbraun, der Lidrand fleischrot. Die Länge beträgt vierzig bis achtundvierzig, die Breite etwa hundert, die Fittichlänge neunundzwanzig, die Schwanzlänge achtzehn Zentimeter.
Das Verbreitungsgebiet des Waldkauzes erstreckt sich vom siebenundsechzigsten Grade nördlicher Breite bis Palästina. Am häufigsten tritt er in der Mitte, seltener im Osten, Süden und Westen Europas auf. In Deutschland bewohnt er vorzugsweise Waldungen, aber auch Gebäude. Während des Sommers sitzt er, dicht an den Stamm gedrückt, in laubigen Baumwipfeln; im Winter verbirgt er sich lieber in Baumhöhlungen, meidet daher Waldungen mit jungen und höhlenlosen Bäumen. An einem hohen Baume, der sich für ihn passend erweist, hält er mit solcher Zähigkeit fest, daß man ihn, laut Altum, bei jedem Spaziergange durch Anklopfen hervorscheuchen kann; ja einzelne derartige Bäume werden so sehr von ihm bevorzugt, daß, wenn der Inwohner geschossen wird, nach einiger Zeit jedesmal wieder ein anderer Waldkauz dasselbe Versteck als Wohnung sich ausersieht. Solche Eulenbäume stehen sowohl im Walde selbst als am Rande desselben, auch auf Örtlichkeiten an viel befahrenen Landwegen. Bestimmend für seinen Aufenthalt ist außerdem größerer oder geringerer Reichtum an entsprechender Beute. Wo es Mäuse gibt, siedelt sich der Waldkauz sicherlich an, falls die Umstände solches einigermaßen gestatten; wo Mäuse spärlich auftreten, wohnt er entweder gar nicht, oder er wandert aus. Vor dem Menschen scheut er sich nicht, nimmt daher selbst in bewohnten Gebäuden Herberge, und wenn ein Paar einmal solchen Wohnsitz erkoren, findet das Beispiel sicherlich Nachahmung. Dann sieht man ihn des Nachts auf Dachfirsten, Schornsteinen, Gartenmauern und anderen Warten sitzen und von ihnen aus sein Jagdgebiet überschauen.
Der Waldkauz, dem Anschein nach einer der lichtscheuesten Vögel, die wir kennen, weiß sich jedoch auch am hellen Mittag so vortrefflich zu benehmen, daß man die vorgefaßte Meinung ändert, sobald man ihn genauer kennengelernt hat. »Ich habe ihn«, sagt mein Vater, »mehrmals bei Tage in den Dickichten gesehen; er flog aber allemal so bald auf und so geschickt durch die Bäume, daß ich ihn nie habe erlegen können.« Die Possenhaftigkeit der kleinen Eulen und Tagkäuze fehlt ihm gänzlich; jede seiner Bewegungen ist plump und langsam; der Flug, der unter starker Bewegung der Schwingen geschieht, zwar leicht, aber schwankend und keineswegs schnell; die Stimme ein starkes, weit im Walde widerhallendes »Huhuhu«, das zuweilen so oft wiederholt wird, daß es einem heulenden Gelächter ähnelt, außerdem ein kreischendes »Rai« oder wohltönendes »Kuwitt«. Daß er seinen Anteil an der »wilden Jagd« hat, unterliegt wohl keinem Zweifel, und derjenige, dem es ergeht, wie einstmals Schacht, wird schwören können, daß ihn der wilde Jäger selbst angegriffen habe. »Einst«, so erzählt der eben Genannte, »jagte mir ein Waldkauz durch sein Erscheinen nicht geringen Schrecken ein. Es war im Januar abends, als ich mich, ruhig mit der Flinte im Schnee auf dem Anstande stehend, urplötzlich von den weichen Flügelschlägen wie von Geistererscheinungen umfächelt fühlte. In demselben Augenblick geschah es aber auch, daß ein großer Vogel auf meinen etwas tief über das Gesicht gezogenen Hut flog und daselbst Platz nahm. Es war der große Waldkauz, der sich das Haupt eines Menschenkindes zur Sitzstelle gewählt, um sich von hier aus einmal nach Beute umschauen zu können. Ich stand wie eine Bildsäule und fühlte es deutlich, wie der nächtliche Unhold mehrere Male seine Stellung veränderte und erst abzog, als ich versuchte, ihn für diese absonderliche Zuneigung an den Fängen zu ergreifen.«
Der Waldkauz frißt fast ausschließlich Mäuse. Naumann beobachtete allerdings, daß einer dieser Vögel nachts einen Bussard angriff, so daß dieser sein Heil in der Flucht suchen mußte, erfuhr ferner, daß ein anderer Waldkauz vor den Augen seines Vaters einen Seidenschwanz aus der Schlinge holte, und wir wissen endlich, daß die jungen Tauben in Schlägen, die er dann und wann besucht, ebensowenig als die auf der Erde schlafenden oder brütenden Vögel verschont werden: Mäuse aber, und zwar hauptsächlich Feld-, Wald- und Spitzmäuse, bleiben doch die Hauptnahrung. Martin fand in dem Magen eines von ihm untersuchten Waldkauzes fünfundsiebzig große Raupen des Kieferschwärmers. »Eines Abends«, erzählt Altum, »befand ich mich an der Wienburg, eine kleine halbe Stunde von Münster. Das einstöckige Haus ist teilweise umgeben von Gärten, freien Plätzen und Nebengebäuden. Auf dem Hausboden befand sich das Nest des Waldkauzes mit Jungen. Der westliche Himmel war noch hell erleuchtet von den Strahlen der untergegangenen Sonne, als sich ein alter Kauz auf der Firste des Daches zeigte. Unmittelbar darauf nimmt der zweite auf dem Schornsteine Platz. Sie sitzen unbeweglich; doch der Kopf wendet sich ruckweise bald hierhin, bald dorthin. Plötzlich streicht der eine ab, überfliegt den breiten Hausboden und läßt sich jenseits am Rande des Gehölzes fast senkrecht zu Boden fallen, um sofort mit seiner Beute, einer langschwänzigen Maus, also wohl Waldmaus, zurückzufliegen. Kaum ist er mit derselben unter dem Dache verschwunden, so streicht auch der zweite ab und kommt mit Beute beladen sofort zurück. Von da ab waren sie derart mit ihrer Jagd beschäftigt, daß im Durchschnitt kaum zwei Minuten zwischen dem Herbeitragen zweier kleinen Säugetiere verstrichen. Häufig hatten sie kaum ihre Warte eingenommen, so machten sie auch schon wieder einen erneuten Jagdflug, und ich habe nie gesehen, daß sie auch nur ein einziges Mal vergeblich gejagt hätten. Endlich setzte die zunehmende Dunkelheit der Beobachtung ein Ziel.« Eigentümlich für den Waldkauz ist, wie Liebe hervorhebt und auch ich beobachtet habe, daß er immer eine bestimmte Stelle, beziehentlich einen bestimmten Baum aussucht, um Gewölle auszuspeien. Am häufigsten liegen diese in der Nähe von weit in den Wald reichenden und in das freie Feld mündenden Wiesengründen, die der Vogel des Nachts vorzugsweise aufsucht; man findet sie aber auch mitten in jungem Stangenholz, weitab von jeder freien Stelle, und ebenso, wie ich hinzufügen will, unter einzelnen, weit vom Walde entfernten Waldbäumen. Wahrscheinlich wirft der Waldkauz das Gewölle besonders des Nachts aus, wenn er von der Jagd auf kurze Zeit an einem ihm besonders zusagenden, ungestörten Plätzchen ausruht.
Um die Zeit, wenn im Frühjahre die Waldschnepfen streichen, Mitte März also, hört man, wie Naumann sagt, im Walde »das heulende Hohngelächter« unseres Waldkauzes erschallen. Der Wald wird um diese Zeit laut und lebendig, da der Kauz selbst am Tage seine Erregung bekundet. Je nach dem Stande der Witterung und der Nahrung beginnt das Paar mit seinem Brutgeschäft früher oder später, in den Rheinlanden zuweilen schon im Februar, in Mitteldeutschland meist im März, bei einigermaßen ungünstiger Witterung hier und selbst in Ungarn aber auch erst im April und sogar Anfang Mai. Eine Baumhöhle, die dem brütenden Vogel leichten Zugang gewährt und ihn vor Regen schützt, wird zur Ablegung der Eier bevorzugt, eine passende Stelle im Gemäuer oder unter Dächern bewohnter Gebäude oder ein Raubvogelhorst, Krähen- oder Elsternest jedoch ebensowenig verschmäht. Im Neste selbst findet man zuweilen etwas Genist, Haare, Wolle und dergleichen, jedoch nur die Unterlage, die auch der Vogel vorfand. Die zwei bis drei Eier sind rundlich, länglich oder eiförmig, rauhschalig und von Farbe weiß. Das Weibchen scheint allein zu brüten, und zwar, wie Päßler meint, sofort, nachdem es das erste Ei gelegt hat. Das Männchen hilft bei Auffütterung der Jungen, gegen die beide Alten die größte Liebe an den Tag legen. Sobald die Jungen ihre volle Selbständigkeit erlangt haben, beginnen sie in der Gegend umherzustreichen, und wenn diese gerade arm an Mäusen ist, ziehen alle fort, wie man, laut Liebe, am sichersten an den Gewöllplätzen beobachten kann, indem man nach dem Wegzuge der Jungen auf allen alten Plätzen dieser Art frische Gewölle, auf den neu angelegten hingegen keine mehr sieht.
Keine andere Eule hat von dem Kleingeflügel mehr zu leiden als der Waldkauz. Was Flügel hat, umflattert den aufgefundenen Unhold, was singen oder schreien kann, läßt seine Stimme vernehmen. Singdrossel und Amsel, Grasmücke, Laubvögel, Finke, Braunelle, Goldhähnchen und wer sonst noch im Walde lebt und fliegt, umschwirrt den Lichtfeind, bald jammernd klagend, bald höhnend singend, bis dieser endlich sich aufmacht und weiter fliegt.
Gefangene können sehr zahm werden. Nach Liebes Erfahrung eignet sich der Waldkauz unter allen Eulenarten am besten für die Aufzucht. Er scheut das Licht so wenig, daß er sich um Mittag ein warmes, sonnenbeschienenes Plätzchen auswählt und hier unter allerhand erheiternden Gebärden die Sonne durch die gesträubten Federn hindurch auf die Haut scheinen läßt. Die Gesellschaft des Menschen erhält ihn den ganzen Tag über munter, zumal wenn man sich Mühe gibt, mit ihm zu spielen, wofür er wenigstens in seinen ersten Lebensjahren ersichtlich dankbar ist. Hat man ihn jung aus dem Neste gehoben und ihn beim Aufziehen alltäglich zweimal auf der Faust gekröpft, so daß er das Futter mit dem Schnabel aus der Hand nehmen muß, so gewöhnt er sich bald derartig an den Gebieter, daß er ihm alle Liebkosungen erweist, die er sonst unter Blinzeln, Gesichterschneiden und leisem Piepen nur seinesgleichen zuteil werden läßt. Liebe hat Käuze so weit gezähmt, daß sie auf seinen Ruf herbeiflogen, sich auf die Faust setzten und mit dem krummen Schnabel seinen Kopf krauten. Ganz ähnliche Beobachtungen habe ich an meinen Pfleglingen gewonnen. Einmal hielt ich ihrer sieben in einem und demselben Käfig. Hier lebten sie zwei Jahre im tiefsten Frieden, und nie machte sich unter ihnen Futterneid bemerklich. Wenn der eine fraß, schauten die andern zwar aufmerksam, aber sehr ruhig zu, und eigentliche Kämpfe um die Nahrung kamen niemals vor. Anders benahmen sie sich einem Toten oder Kranken ihrer Art gegenüber. Ersterer wurde ohne Bedenken aufgefressen, letzterer grausam erwürgt. Ein Paar meiner Pfleglinge legte vier Eier und bebrütete sie lange Zeit unter Mithilfe von zwei seiner Käfiggenossen.
Außer vorstehend beschriebener Art beherbergt Europa noch zwei Nachtkäuze, die unserem Buche nicht fehlen dürfen, weil beide in Deutschland erlegt wurden, der eine von ihnen sogar als Brutvogel vermutet werden kann. Diese Art ist die Habichtseule ( Syrnium uralense), einer der größten aller Käuze. Die Länge beträgt fünfundsechzig bis achtundsechzig, die Breite etwa einhundertundzwanzig, die Fittichlänge vierzig, die Schwanzlänge zweiunddreißig Zentimeter. Von der Grundfärbung, einem düsteren Grauweiß, heben sich auf der Oberseite dunkelbraune Längsstreifen ab. Das von dem Schleier umrahmte Gesicht zeigt auf graulichweißem Grunde äußerst feine, schwärzliche, vom Auge aus speichenartig verlaufende Striche; der Schleier erscheint weiß und schwarz gefleckt. Die Unterseite ist auf gelblichweißem Grund durch schmale braune Schaftflecke längsgezeichnet, die Befiederung der Füße endlich gleichmäßig schmutzigweiß. Das verhältnismäßig große Auge ist tief dunkelbraun, das Augenlid dunkel kirschrot, der Schnabel wachsgelb. Pallas entdeckte die Habichtseule im Ural; spätere Forscher fanden sie in beinahe ganz Osteuropa und ebenso in Mittelasien, vom Ural bis zum Stillen Weltmeere. In Deutschland ist sie wiederholt, so am vierten April des Jahres 1878 im Reviere Kranichbruch in Ostpreußen wahrscheinlich am Nistplatze erlegt worden. In Österreich, Ungarn, Polen, Rußland, Finnland ist sie geeigneten Ortes nicht allzuselten, auch in Siebenbürgen eine so regelmäßige Erscheinung, daß kundige Jäger sie recht oft im Walde treffen.
Entsprechend der geringen Kenntnis unserer Eule läßt sich ein erschöpfendes Lebensbild gegenwärtig noch nicht zeichnen. Man weiß, daß sie ebensowohl auf Felsen als in alten, hochstämmigen Waldungen ihren Wohnsitz nimmt und hier, trotz ihrer großen und weittönenden Stimme, ein ziemlich verstecktes Leben führt, im Spätherbste jedoch öfter in den Ebenen, entweder in kleinen Gehölzen oder sogar im freien Felde, beobachtet wird; es ist ferner bekannt, daß sie auch bei Tage vortrefflich sieht und im Gegensatze zu dem verwandten Waldkauze um diese Zeit zuweilen ihrer Jagd obliegt; man hat ebenso erfahren, daß sie gegen Störung höchst empfindlich ist und, wenn sie Gefahr vermutet, sofort ihren Stand verläßt; eine Beobachtung endlich, die von dem Bruder Naumanns herrührt, läßt glauben, daß sie an Kühnheit den Tageulen kaum nachsteht. Letztere Eigenschaft bewies diejenige, die der eben Genannte im Jahre 1819 in Anhalt fliegen sah, in auffallender Weise. Sie verfolgte anfänglich einen Mäusebussard und stieß unablässig nach ihm, bis beide sich im Walde verloren. Bald darauf sah sie der Beobachter vom Walde aus wieder aufs freie Feld streichen und einen Fischreiher anfallen. Letzterer suchte unter kläglichem Geschrei sein Heil in der Flucht, wehrte aber ihre heftigen, schnell wiederholten Stöße mit dem Schnabel glücklich ab. Sie stieß stets in einer Höhe von etwa drei Metern in schiefer Richtung nach dem Reiher herab und trieb ihn so wohl eine Viertelstunde weit weg. Hieraus läßt sich schließen, daß die Habichtseule ihre Jagd nicht auf Mäuse und andere kleine Nagetiere beschränken dürfte, vielmehr auch auf größere Säugetiere und Vögel, als da sind Hasen, Kaninchen, Birk- und Schneehühner, ausdehnen wird.
An ihren Brutplätzen, zerklüfteten Felswänden oder hochgelegenen Buchenwaldungen, findet sie sich spätestens im April ein. Die Liebe erregt auch sie, und man vernimmt jetzt ihren weithin hörbaren Ruf, der von einzelnen mit dem Meckern einer Ziege verglichen wird und ihr den Namen »Habergeiß« eingetragen hat, nach andern dagegen ein lautes Heulen, und zwar ein Gemisch des Geschreies vom Uhu und Waldkauz, das dann und wann an das Rucksen der Ringeltaube erinnert. Wodzicki fand im Frühjahre zwei Nester, das eine zwei längliche, weiße Eier, das andere zwei mit grauen Daunen bekleidete Junge enthaltend.
In der Gefangenschaft nimmt sie nach Nordmann ebenso erheiternde Stellungen wie die Zwergeule an, ergreift die hingereichte Nahrung immer mit einem heftigen Sprunge und zeigt in allen Bewegungen größere Tatkraft als eine gleichzeitig in der Gefangenschaft sich befindende Schnee-Eule.
Die zweite an dieser Stelle noch zu erwähnende Art ist der Bartkauz oder die Lapplandseule ( Syrnium barbatum), eine der größten aller Eulen. Die Länge beträgt siebzig, die Breite einhundertvierzig Zentimeter, die Fittichlänge achtundvierzig und die Schwanzlänge achtundzwanzig Zentimeter. Ähnlich gebaut wie unser Waldkauz, jedoch schlanker und verhältnismäßig langschwänziger, zeichnet sie sich durch reiche Befiederung und großen, kreisrunden Schleier mit regelmäßiger Zeichnung besonders aus. Die vorherrschende Färbung des Gefieders der Oberseite ist ein düsteres Graubraun, jede Feder durch dunkelbraune, zackige Schaftflecke und weißliche, gerade oder wurmförmig gebogene Binden gesperbert, die der Unterseite ein mehr oder minder lichtes, leicht rötlich überhauchtes Grau, das in der Kropfgegend durch dunkelgraue Längs-, an den Brustseiten und auf den Füßen aber durch schmale Querflecken gezeichnet wird. Der Schleier zeigt auf weißgrauem Grunde acht bis zehn sehr regelmäßig umeinander verlaufende, das Auge umgebende mattschwarze Kreise, die Kehlgegend einen einfarbig schwarzen Fleck in Gestalt eines Kinnbartes, der durch etwas Weiß an beiden Seiten noch mehr hervorgehoben wird. Das verhältnismäßig kleine Auge hat glühend hochgelbe Iris und rotbräunliche Lider; der Schnabel ist wachsgelb. Das Verbreitungsgebiet des Bartkauzes erstreckt sich über den hohen Norden der Alten Welt, insbesondere über Lappland, Finnland, Nordrußland und Sibirien bis zum Ochotskischen Meer. In Deutschland hat man den, wie es scheint, überall seltenen Vogel bisher nur in Ostpreußen und Schlesien erlegt.
In Skandinavien folgt auch der Bartkauz dem Zug der Lemminge und streift dann nicht allzu selten bis zur Mitte des Landes nach Süden herab, tritt auch in einzelnen Jahren, entsprechend dem Gedeihen seines Lieblingswildes, häufiger oder seltener auf. Wie er lebt, wie er jagt, wie er sich andern Tieren gegenüber verhält, ist unbekannt. Ein Horst wurde von Ullenius Anfang Juni in Lappmarken gefunden und das brütende Weibchen bei dieser Gelegenheit erlegt. Der Horst stand in einem Kiefernwald auf einem drei Meter hohen Baumstumpf, in dem sich durch Ausfaulen eine Höhlung gebildet hatte. Ein weißes Ei von der Größe des Uhu-Eies lag im Nest, ein anderes unbeschädigtes unter demselben am Fuße des Nistbaumes. Andere Horste fand Wolley, und zwar entweder auf hohen Bäumen oder in Baumhöhlen. Sie enthielten drei und vier, nach Verhältnis der scheinbaren Größe des Vogels außerordentlich kleine, den des Uhus und der Schneeeule an Größe merklich nachstehende Eier. Wir selbst sahen auf unserer Reise nach Sibirien am untern Ob zwei gefangene Bartkäuze im Besitz einiger Ostjaken, die die Vögel ihrer Angabe nach aus einem frei auf einem Baum stehenden flachen Horst in einem benachbarten Weidenbestand gefunden hatten und ihre Pfleglinge mit Fischen ernährten. Diese Vögel erinnerten mich in jeder Beziehung an unsern Baumkauz, hatten, abgesehen von ihren gelben Augen, denselben gutmütigen Ausdruck, waren auch ebenso sanft und zahm, bewegten und gebärdeten sich genau in derselben Weise wie dieser.
*
Dem munteren Steinkauz zum Verwechseln ähnlich ist ein zweiter Nachtkauz, der in Deutschland überall, jedoch nirgends häufig gefunden worden ist, der Rauchfußkauz ( Nyctale tengmalmi). Ihn kennzeichnen der sehr breite Kopf mit außerordentlich großen Ohröffnungen und vollkommenem Schleier, die abgerundeten Flügel, der ziemlich lange Schwanz, die kurzen, ungemein dichten und lang befiederten Füße und das weiche, seidenartige Gefieder. Der Schleier ist weißgrau, schwarz getuscht, der Oberkörper mäusegrau, durch große weißliche Flecken gezeichnet, der Unterkörper weiß mit deutlichen und vertuschten mäusebraunen Querflecken; die Schwung- und Schwanzfedern sind mäusegrau mit weißen unterbrochenen Binden, von denen fünf bis sechs auf den Steuerfedern stehen. Der Schnabel ist horngelb, das Auge lebhaft goldgelb. Junge Vögel sind einfarbig kaffeebraun, auf den Flügeln und dem Schwanze weißlich gefleckt. Die Länge beträgt dreiundzwanzig bis fünfundzwanzig, die Breite sechsundfünfzig, die Fittichlänge achtzehn, die Schwanzlänge elf Zentimeter.
Nord- und Mitteleuropa, Nordwestasien und Nordamerika bis zur Nordgrenze der Vereinigten Staaten bilden, soweit bis jetzt bekannt, das Verbreitungsgebiet des Rauchfußkauzes; da man ihn jedoch außerdem in Nepal gefunden hat, läßt sich annehmen, daß er in Asien viel weiter verbreitet ist, als bisher festgestellt werden konnte, und wahrscheinlich in allen größeren Waldungen zwischen Mitteleuropa und Nordamerika auftritt. In Deutschland lebt er in jedem größeren Gebirgswald, wird aber niemals häufig bemerkt und gehört deshalb in den Sammlungen immer zu den Seltenheiten. Soviel man bis jetzt erfahren hat, verläßt er auch den Wald nur ausnahmsweise. Eine geeignete Baumhöhlung wird zum Mittelpunkt seines Gebietes, und das Paar hält an ihm mit großer Zähigkeit fest.
»Er ist«, sagt mein Vater, »ein einsamer, furchtsamer, licht- und menschenscheuer Vogel, der sich am Tage sorgfältig verbirgt. Gegen das Tageslicht ist er sehr empfindlich. Ich hatte ein Weibchen, das im Winter ermattet im Walde gefunden wurde, einige Zeit lebendig. Dieses suchte immer die dunkelsten Orte im Zimmer und öffnete auch hier die Augen nur wenig. Brachte man es in das volle Tageslicht, dann schloß es die Augen fast ganz und hüpfte, sobald man es frei ließ, sogleich wieder seinem Schlupfwinkel schwerfällig zu. Es knackte mit dem Schnabel wie andere Eulen, war aber sehr wenig wild und ungestüm. Ein Freund von mir hielt einen rauchfüßigen Kauz längere Zeit lebendig, der nach seiner Erzählung ein allerliebstes Tier war. Er wurde bald zahm, knackte aber doch mit dem Schnabel, wenn man ihn neckte, sträubte dabei seine Federn und hob die Flügel etwas; doch drückte er sich bei weitem nicht so nieder wie der Uhu. Kleine Mäuse verschluckte er ganz, jedoch ungern am Tage; größere zerstückelte er, fraß aber das Fell mit und spie es in Klumpen nebst den darin eingewickelten Knochen wieder aus. Mit zwei Mäusen hatte er den Tag hinlänglich genug. Er saß, wie der meinige, meist mit etwas eingezogenen Fußwurzeln und locker anliegenden Federn.«
Später war mein Vater so glücklich, einen gefangenen Rauchfußkauz mehrere Jahre am Leben zu erhalten. Dieser Vogel gewöhnte sich bald an die Menschen, brachte aber, als er noch in der Stube war, fast den ganzen Tag in dem dunkelsten Winkel des Zimmers zu und kam nur abends hervor. Dann hüpfte und flatterte er in seinem Raum umher und war äußerst munter. Er fraß anfangs nur des Nachts; als er aber später bloß bei Tage gefüttert wurde, gewöhnte er sich an die ihm früher so verhaßte Helligkeit und suchte zuletzt seinen dunklen Käfig gar nicht mehr auf. Er nahm meinem Vater die ihm vorgehaltene Nahrung aus der Hand, und zwar regelmäßig mit den Fängen, selten mit dem Schnabel, trug die Beute in einen Winkel und bedeckte sie mit sich selbst, indem er alle Federn sträubte. Auch er trank nur wenig, badete sich aber oft, bei warmer Witterung fast täglich. Bei strenger Kälte fror er und setzte sich dann gern auf den Boden mit angezogenen Füßen, in der Absicht, diese zu erwärmen. Seine Stimme, die wie ein schwaches Hundegebell »Wa, wa, wa« klang, wurde hauptsächlich in der Morgen- und Abenddämmerung vernommen.
Der Rauchfußkauz brütet ebenfalls in Baumhöhlungen und legt im April oder Mai drei bis vier Eier, die zartschaliger und kleiner als die des ungefähr gleichgroßen Steinkauzes sind.
Mäuse bilden auch des Rauchfußkauzes liebstes Wild; nebenbei fängt er Spitzmäuse und Kerbtiere, gelegentlich auch kleine Vögel oder Fledermäuse. Es hält gar nicht so leicht, Rauchfußkäuze zu erlangen. Nicht einmal Tellereisen oder Leimruten vor der Nistöffnung führen regelmäßig zum Ziele. Mit dem Gewehr freilich erlegt man den Vogel leichter, wenn man so glücklich war, ihn zu sehen. Außer dem Menschen mögen ihm wohl nur wenig Tiere gefährlich werden, Wiesel und andere Nestplünderer vielleicht den jungen und größere Eulen möglicherweise den alten Vögeln. Das kleine Geflügel haßt und neckt auch ihn.
*
Eine der ausgezeichnetsten Sippen der Familie umfaßt die Schleierkäuze ( Strix). Ihr Auge ist verhältnismäßig klein und gewölbter als bei andern Eulen, die Ohrmuschel aber, dem sehr ausgebildeten Schleier entsprechend, ungemein groß. Der Schleier selbst unterscheidet sich dadurch wesentlich von dem andrer Eulen, daß er nicht rund, sondern herzförmig gestaltet ist. Unser Schleierkauz oder die Schleier-, Perl-, Flammen-, Herz-, Turm-, Kirchen- und Schnarcheule ( Strix flammea) ist auf dem Oberkörper auf dunkel aschgrauem, an den Seiten des Hinterkopfes und Nackens auf rotgelblichem Grund durch äußerst kleine schwarze und weiße Längsflecke gezeichnet. Das Oberflügeldeckgefieder ist tief aschfarben, heller gewässert und mit schwarzen und weißen Längsspritzfleckchen geziert, die Unterseite auf dunkel rostgelbem Grunde braun und weiß gefleckt, der Schleier rostfarben oder rostfarben in der oberen Hälfte, rostfarbigweiß in der untern. Die Schwingen sind rostfarbig. Das Auge ist dunkelbraun; Schnabel und Wachshaut sind rötlichweiß, die Füße schmutzig blaugrau. Das Weibchen zeigt regelmäßig eine etwas düsterere Färbung als das Männchen. Die Länge beträgt zweiunddreißig, die Breite neunzig, die Fittichlänge achtundzwanzig, die Schwanzlänge zwölf Zentimeter.
Kirchtürme, Schlösser, alte Gebäude und Ritterburgen sind auch bei uns zulande und im übrigen Europa die bevorzugten, wenn nicht ausschließlichen, Felsen und Baumhöhlungen die ursprünglichen Aufenthaltsorte des über ganz Mittel- und Südeuropa, Kleinasien und Nordafrika verbreiteten Schleierkauzes. Vom hohen Norden unsers Erdteiles an wird man ihn nur in größeren Gebirgswaldungen vermissen; ebenso meidet er das Hochgebirge über dem Pflanzengürtel. Er ist ein Standvogel im eigentlichen Sinn des Wortes, der nicht einmal streicht. Da, wo wir heute Schleierkäuze finden, sind sie seit Menschengedenken bemerkt worden. Nur die jüngern Vögel lassen sich zuweilen außerhalb des Jagdgebietes der Alten sehen; denn sie müssen sich erst einen festen Wohnsitz erwerben, und diesem Zweck gelten ihre größeren Ausflüge. Tagsüber sitzen sie ruhig in dem dunklen Winkel der betreffenden Gebäude, auf dem Gebälk der Türme oder Kirchböden, in Mauernischen, in Taubenschlägen und an ähnlichen Orten. Läuten der Glocken in unmittelbarer Nähe ihres Schlafplatzes, Aus- und Einschwärmen der Tauben eines Schlages, in dem sie sich angesiedelt haben, stört sie nicht im geringsten; sie haben sich an den Menschen und sein Treiben ebensogut gewöhnt wie an das Gelärm der Tauben, mit denen sie in bester Freundschaft verkehren. Wenn sie sitzen, haben sie mit andern Eulen Ähnlichkeit, fallen aber doch durch ihre schlanke, hohe Gestalt und namentlich durch das unbeschreibliche, herzförmige Gesicht, das die wunderbarsten Verzerrungen ermöglicht, jedermann auf. Durch Beobachtung an gefangenen wissen wir zur Genüge, daß ihr Schlaf ein sehr leiser ist. Es gelingt dem Menschen niemals, sie zu übertölpeln; denn das geringste Geräusch ist hinreichend, sie zu erwecken. Beim Anblick des Beschauers pflegen sie sich hoch aufzurichten und leise hin und her zu schaukeln, indem sie sich auf den Beinen wiegend seitlich hin und her bewegen. Einige Grimassen werden bei solchen Gelegenheiten auch geschnitten; alle Bewegungen aber sind stetiger und langsamer als bei den meisten übrigen Eulen. Rückt ihnen eine vermeintliche Gefahr nahe auf den Hals, so fliegen sie weg und beweisen dann, daß sie auch bei Tage sehr gut sehen können. Nach Sonnenuntergang verlassen sie das Gebäude durch eine bestimmte, ihnen wohlbekannte Öffnung, die sie auch bei Tage unfehlbar zu finden und gewandt zu benutzen wissen, und streifen nun mit geisterhaft leisem und schwankendem Flug niedrig über dem Boden dahin. Ein heiseres Kreischen, das Naumann die widerlichste aller deutschen Vogelstimmen nennt, abergläubischen Menschen auch sehr entsetzlich vorkommen mag, verkündet ihre Ankunft, und wenn man seine Aufmerksamkeit der Gegend zuwendet, von der dieses Kreischen hertönt, sieht man den bleichen Vogel gewiß; denn er umschwärmt ohne Scheu den abends sich ergehenden Menschen und fliegt ihm oft wie ein Schatten nahe um das Haupt. In hellen Mondscheinnächten treiben sich die Schleierkäuze bis gegen Sonnenaufgang ununterbrochen im Freien umher, zeitweilig auf Gebäuden ausruhend und dann wieder eifrig jagend; in dunkleren Nächten arbeiten sie bloß des Abends und gegen Morgen.

Schleiereule ( Strix flammea)
Mäuse, Ratten, Spitzmäuse, Maulwürfe, kleine Vögel und große Kerbtiere bilden die Nahrung des Schleierkauzes. Es ist ihm oft nachgesagt worden, daß er in Taubenschlägen Unfug stifte; dem widerspricht aber die Gleichgültigkeit der Tauben, ihrem seltsamen Gesellen gegenüber. »Ich habe ihn«, sagt Naumann, »sehr oft unter meinen Tauben aus- und einfliegen sehen. Die Tauben, die diesen Gast bald gewohnt wurden und sich um ihn nicht kümmerten, blieben stets im ungestörten Besitz ihrer Eier und Jungen, ebensowenig fand ich je eine Spur von einem Angriff auf eine alte Taube. Oft sah man im Frühling ein Paar viele Abende hintereinander in meinem Gehöft; es schien auf dem Taubenschlag brüten zu wollen und flog, sobald es gegen Abend zu dämmern anfing, spielend aus und ein, ließ, bald im Schlage selbst, bald dicht vor demselben, seine fatale Nachtmusik fast ununterbrochen erschallen und – keine Taube rührte sich. Stieg man am Tage leise auf den Schlag, so sah man die Eulen ruhig auf einer Stange oder in einem Winkel vertraulich mitten unter den Tauben sitzen und schlafen und nicht selten neben sich einen Haufen Mäuse liegen; denn sie tragen sich, wenn sie eine glückliche Jagd machen und vielleicht auch eine Vorempfindung von übler Witterung fühlen, solche Vorräte zusammen, damit sie in zu finsteren und stürmischen Nächten, wenn sie nicht jagen können, keinen Hunger leiden dürfen. Mein Vater fing sogar einmal eine dieser Eulen, die in so tiefen Schlaf versunken war, daß sie durch das Geprassel der fliehenden Tauben nicht geweckt wurde, mit den Händen. Kleine Vögel greifen sie wohl im Schlafe an; denn in den Städten würgen sie nicht selten die in Vogelbauern vor den Fenstern hängenden Lerchen, Nachtigallen, Finken, Drosseln und dergleichen; auch die gefangenen Vögel holen sie zuweilen aus den Dohnen und Schlingen der nahen Dohnenstege. Manche sind sehr sanft, andere wieder raubgierig. Einer meiner Bekannten erhielt einmal einen Schleierkauz, der ungefähr seit acht Tagen in der Gefangenschaft war, setzte ihn in seine stockfinstere Stube und eilte schnell ein Licht zu holen. Hierüber verfloß kaum eine Minute, und doch sah er zu seinem Ärger, als er mit dem Licht in die Stube trat, daß die Eule bereits seine Mönchsgrasmücke hinter dem Ofen von ihrem Sitz geholt, getötet und bereits halb aufgefressen hatte. Die Eule fraß oft fünfzehn Feldmäuse in einer Nacht. Auch Aas verschmäht in den Zeiten der Not der Schleierkauz nicht.«
Über das Fortpflanzungsgeschäft des Schleierkauzes sind sehr auffallende Beobachtungen gemacht worden. In den älteren Naturgeschichten steht, daß die Brutzeit in die Monate April und Mai falle; diese Angabe erleidet jedoch Ausnahmen. Man hat nämlich junge Schleiereulen wiederholt auch im Oktober und November, um diese Zeit sogar noch Eier, auf denen die Alte sehr eifrig brütete, gefunden. Die Liebe erregt auch den Schleierkauz und begeistert ihn zu lebhaftem Schreien. Beide Gatten jagen sich spielend miteinander von Turm zu Turm. Ein eigentlicher Horst wird nicht gebaut; die sechs bis neun länglichen, rauhschaligen, glanzlosen, vierzig Millimeter langen und dreißig Millimeter dicken Eier liegen ohne alle Unterlage in einem passenden Winkel auf Schutt und Getrümmer. Die Jungen sehen, wie alle Zunftverwandten, anfangs außerordentlich häßlich aus, werden aber von ihren Eltern ungemein geliebt und auf das reichlichste mit Mäusen versorgt. Will man sich, um sie für die Gefangenschaft zu gewinnen, Mühe sparen, so darf man sie nur in ein weitmaschiges Gebauer sperren: die Alten füttern sie hier wochen- und monatelang ununterbrochen. Pflegt man sie selbst, solange sie noch jung sind, so werden sie bald in hohem Grade zahm, lassen sich dann ohne Widerstreben berühren, auf der Hand umhertragen, ja selbst zum Aus- und Einfliegen gewöhnen. Nach meinem Dafürhalten gehören diese schönen und gutmütigen Tiere zu den angenehmsten Eulen, die man überhaupt im Käfig halten kann. Ihr Gesichterschneiden ergötzt jedermann; sie verziehen den Schleier oft so, daß sie, wie mein Vater sagt, als ein wahres Zerrbild des menschlichen Gesichts erscheinen.
Da der Schleierkauz unbedingt zu den nützlichsten Vögeln gezählt werden muß, verdient die folgende Aufforderung von Lenz vollste Beachtung aller Verständigen. »Für die Schleiereule und den Steinkauz sollten überall in Giebeln der Land- und Stadtgebäude Einrichtungen zu Nest und Wohnung sein. In jeder Giebelspitze meiner Gebäude ist eine Öffnung von der Größe, wie sie für Tauben genügt. Diese führt in einen inwendig angebrachten Kasten, der links und rechts einen Nestplatz hat. Auf diesen darf das Licht des Eingangs nicht fallen; der Vogel muß also vom Eingang aus durch einen Brettergang einen halben Meter tief in das Innere des Kastens gehen, dort links oder rechts schwenken und so zum linken oder rechten Nest gelangen; der Eingang zu jedem Nest ist also vom hellen Eingang des Kastens weggerichtet. Nach dem Innern des Hauses zu ist der ganze Kasten fest vernagelt, damit ihn keine unbefugte Hand öffnen und eine Störung in das behagliche Leben der kleinen Erziehungsanstalt bringen kann. In jeder Giebelspitze der großen Scheuern Holsteins befindet sich in der Regel eine Öffnung, durch die eine Schleiereule bequem hindurch kann. Nach den von W. Claudius angestellten Untersuchungen stört der Landmann in Holstein die Ruhe seiner Eule nie absichtlich und schützt sie gegen Verfolgung. Die Vögel fliegen also nach Belieben aus und ein, jagen in und außer der Scheuer lustig den Mäusen nach, vertragen sich mit den Hauskatzen vortrefflich und bauen ihr Nest in dem dunklen Raum.«
*