
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Kurols. Pisangfresser. Hornvögel. Eisvögel. Plattschnäbler.
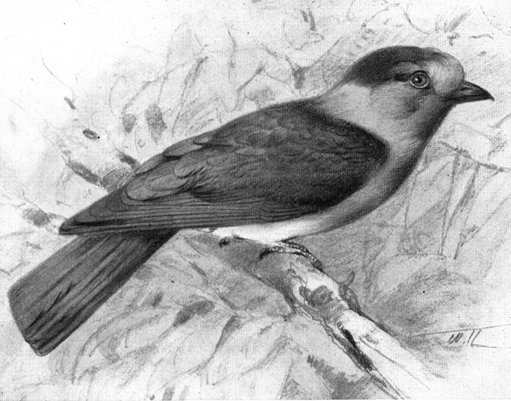
Kurol (Leptosomus discolor)
Der Kurol, einer der auffallendsten Vögel des an absonderlichen Tiergestalten so reichen Madagaskar, ist von den ordnenden Forschern viel hin und her geworfen und bald als Kuckuck, bald als Rake angesehen, schließlich aber zum Urbilde einer besonderen gleichnamigen Familie ( Leptosomidae) erhoben worden. Mit den genannten Vögeln und ebenso mit den Pisangfressern zeigt er Verwandtschaft. Sein Schnabel ist, so kurz er auch erscheinen mag, in Wirklichkeit lang und stark, nach hinten verbreitert und deshalb weit gespalten, besonders ausgezeichnet aber dadurch, daß die vor der Wurzel gelegenen, mit schmiegsamer Haut überdeckten Nasenlöcher gänzlich von weichen, buschigen, zu beiden Seiten der Oberkinnlade entspringenden, nach aufwärts und gegeneinander sich wölbenden Federn eingehüllt sind. Der Kurol ( Leptosomus discolor) erreicht eine Länge von vierundvierzig Zentimetern und ist auf Vorderkopf, Hals, Kropf und Oberbrust tief bläulichgrau, auf dem etwas gehäubten Scheitel schwarz, auf dem Rücken, den kleinsten Flügeldecken und Schulterfedern, die schönen, kupferroten Glanz zeigen, metallisch grün, auf den großen Flügeldecken mehr kupferrötlich, unterseits grau, auf dem Bauche und unter den Schwanzdecken weiß gefärbt. Die Iris ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß tiefgelb. Beim Weibchen sind Kopf und Hals rotbraun und schwarz gebändert.
Ebenso auffallend wie Gestalt und Färbung sind auch Lebensweise, Sitten und Gewohnheiten des Kurol, über den Newton, Roch und Pollen ausführlich berichtet haben. Zuzeiten begegnet man ihm in Gesellschaften von zehn oder zwölf Stück, die sich hauptsächlich an den Rändern der Waldungen aufhalten, zu andern Zeiten an ähnlichen Orten in sehr großer Menge, jedoch in kleineren Gesellschaften, unter denen die Anzahl der Männchen die der Weibchen so bedeutend überwiegt, daß Pollen glaubt, auf jedes der letzteren mindestens drei Männchen rechnen zu dürfen.
Ein absonderliches Geschöpf ist der Kurol in jeder Beziehung. Unablässig tönt sein Schrei, der durch die Silben »Tühutühutühu« ausgedrückt werden kann und gegen das Ende hin an Stärke zunimmt, durch die Waldungen, zuweilen so ununterbrochen und laut, daß er geradezu lästig werden kann. Hierbei bläst er Kehle und Vorderhals so weit auf, daß diese Teile den Anschein eines herabhängenden Sackes gewinnen. Aber so eifrig er auch ruft, als so träge und geistlos erweist er sich, sobald er sich auf einen Baumzweig gesetzt hat. Hier verweilt er in sehr senkrechter Stellung unbeweglich, als ob er ausgestopft wäre, und gestattet nicht nur, daß der Jäger auf Schußweite herankommt und aus einer Gesellschaft einen nach dem andern erlegt, sondern läßt sich im buchstäblichen Sinne des Wortes totschlagen, ohne an Flucht zu denken. Ganz verschieden zeigt sich derselbe Vogel, wenn er fliegt und sich einmal bis zu einer gewissen Höhe erhoben hat. Hier tummelt er sich ganz nach Art unserer Blaurake mit Lust und Behagen in der Luft umher, steigt über einer bestimmten Stelle des Waldes rasch und hoch senkrecht auf und läßt sich sodann, indem er die Flügel fast gänzlich schließt, wieder herabfallen, gleichzeitig ein Pfeifen ausstoßend, das so täuschend an die Stimme des Adlers erinnert, daß Roch und Newton lange Zeit in Zweifel blieben, ob der Vogel, der die wundervollen Flugspiele vor ihren Augen ausführte, der Kurol oder ein gefiederter Räuber sei. Erst nachdem sie mit dem Fernglase wiederholt beobachtet hatten, mußten sie die Überzeugung gewinnen, unsern Vogel vor sich zu sehen, und bemerkten bei dieser Gelegenheit, daß ein ruhig auf dem Baume sitzender Genosse nicht selten dem in der Luft spielenden antwortete.
Nach Pollens Befund lebt der Kurol vorzugsweise von Heuschrecken, jagt aber auch auf Chamäleons und Eidechsen und verschafft wohl dadurch seinem Fleisch einen unangenehmen Geruch, ähnlich dem, den wir an unserm Kuckuck wahrnehmen.
Bestimmte Kunde über die Fortpflanzung vermochte Pollen nicht zu gewinnen. Während seines Aufenthaltes in Mayotte sah er einen Kurol in der Höhle eines großen Baumes Binsen zu einem Nest zusammentragen, weiß aber nichts Weiteres mitzuteilen. Daß ein so auffallender Vogel die Aufmerksamkeit der Eingeborenen sich zugelenkt hat, erscheint begreiflich.
Pisangfresser ( Musophagidae) nennen wir die Mitglieder einer kleinen Familie, so wenig passend der Name auch erscheinen mag, da die betreffenden Vögel schwerlich von besagten Früchten sich nähren. Ihre Größe schwankt zwischen der eines Raben und der unseres Hähers. Große, zusammenhängende Waldungen Mittel- und Südafrikas sind die Heimat der Pisangfresser. In baumlosen Gegenden findet man sie nicht. Sie leben gesellig, in kleinen Trupps, die nach meinen eigenen Beobachtungen von drei bis zu fünfzehn Stück anwachsen können, halten sich viel im Gezweige der Bäume auf, kommen aber auch oft auf den Boden herab. Einzelne scheinen mit ziemlicher Regelmäßigkeit ein weites Gebiet zu durchstreifen; dies aber geschieht in einer unsteten, unruhigen Weise unter viel Gelärm und Geschrei. Ihr Flug ist nicht besonders ausgezeichnet, jedoch, wie die kurzen Flügel vermuten lassen, gewandt und mancherlei Wendungen fähig. Ihre Bewegungen im Gezweige der Bäume sind sehr geschickt. Aufmerksam auf alles, was um sie vorgeht, zeigen sie sich vorsichtig und werden, wenn sie sich verfolgt sehen, bald außerordentlich scheu. Sie verzehren Blattknospen, Früchte, Beeren und Körner, die sie in den Kronen der Bäume, in Gebüschen und auf dem Boden zusammenlesen. Diese Nahrung bestimmt selbstverständlich ihren Aufenthalt. Sie beleben deshalb vorzugsweise Gegenden, die reich an Wasser und somit auch reich an Früchten sind. Dank dieser Nahrung lassen sie sich auch leicht an die Gefangenschaft gewöhnen und bei einiger Pflege jahrelang selbst bei uns erhalten. Einzelne Arten gehören zu den angenehmsten Stubenvögeln, die man haben kann. Sie erfreuen durch die Pracht ihres Gefieders wie durch ihr munteres Wesen und durch ihre Anspruchslosigkeit.
Die Helmvögel oder Turakos ( Corythaix) bilden den Kern der Familie, verbreiten sich über alle Teile des oben angegebenen Gebietes und können dort, wo sie vorkommen, nicht übersehen werden. Ihre Hauptmerkmale liegen in dem kleinen, kurzen, dreieckigen Schnabel, dessen oberer Teil mit schwachem Haken über den unteren sich herabbiegt, und den teilweise von den Stirnfedern überdeckten Nasenlöchern. Das Gefieder ist reich, auf dem Kopfe helmartig verlängert, von vorherrschend grüner Färbung, während die Schwingen regelmäßig prachtvoll purpurrot aussehen. Die verschiedenen Arten ähneln sich außerordentlich, ebensowohl was die Färbung als was die Lebensweise anlangt.
In Abessinien lebt der Helmbuschturako oder weißwangige Helmvogel ( Corythaix buffoni). Der Helm bildet einen breiten, anliegenden, hinterseits scharf abgestutzten Federbusch und hat schwarze, ins Grüne scheinende Färbung; der übrige Kopf, Hals, Mantel und die Unterseite bis zum Bauche sind schön lauchgrün, der Bauch und die übrigen Unterteile dunkel aschgrau, die Schwingen mit Ausnahme der letzten Armschwingen tief karminrot, ein Fleck vor dem Auge und ein anderer, der sich fast senkrecht über dem Ohr am Halse herabzieht, endlich schneeweiß. Ein aus kleinen Warzen bestehender Ring von zinnoberroter Farbe umzieht das lichtbraune Auge. Der Schnabel ist an der Spitze blutrot, an der Spitze des Oberschnabels bis zu den Nasenlöchern aber grün; der Fuß ist braungrau. Die Länge beträgt 45, die Breite 57, die Fittichlänge 17,5, die Schwanzlänge 21,5 Zentimeter. Das Weibchen ist um einen Zentimeter kürzer und um zwei Zentimeter schmäler, unterscheidet sich aber sonst nicht im geringsten von dem Männchen.

Helmbuschturako (Corythrix Ieucotis)
Gelegentlich meines Jagdausfluges nach Habesch habe ich wiederholt Gelegenheit gehabt, den Helmvogel zu beobachten. Man begegnet ihm erst ziemlich hoch oben im Gebirge, kaum jemals unter sechshundert Meter unbedingter Höhe, und von hier an bis über zweitausend Meter aufwärts, in bewaldeten, wasserreichen Tälern, da, wo die Kronleuchtereuphorbie auftritt, entweder in Scharen oder in kleinen Familien, die ungefähr nach Art unseres Hähers leben. Er ist rastlos und unruhig, streift bei Tage fortwährend hin und her, kehrt aber immer mit ziemlicher Regelmäßigkeit zu bestimmten Bäumen des Gebietes zurück, namentlich zu den Sykomoren oder Tamarinden, die ringsum von Niederwald umgeben sind. Solche Bäume werden gewissermaßen zum Stelldichein einer Gesellschaft; auf ihnen sammeln sich die Vögel des Trupps, die sich während des Futtersuchens zerstreuten, und von hier aus treten sie neue Wanderungen an.
Wenn man einen solchen Baum einmal erkundet hat und sich um die Mittagszeit oder gegen Abend unter ihm aufhält, fällt es nicht schwer, die prächtigen Geschöpfe zu beobachten. Die ankommenden machen sich sehr bald bemerklich, sei es, indem sie von Zweig zu Zweig hüpfen oder tänzelnd auf einem Aste entlanglaufen, oder aber, indem sie ihre eigentümliche, dumpf und hohl lautende Stimme vernehmen lassen. Diese Stimme läßt sich schwer wiedergeben. Sie klingt bauchrednerisch und täuscht im Anfang den Beobachter über die Entfernung des schreienden Vogels. Ich habe versucht, sie durch die Silben »Jahuhajagaguga«, die im Zusammenhang miteinander ausgestoßen werden, zu übertragen.
Der Helmvogel verbringt den größten Teil seines Lebens im Gezweige der Bäume. Nur auf Augenblicke kommt er zum Boden herab, gewöhnlich da, wo niedere Euphorbien die Gehänge dicht bedecken. Hier hält er sich einige Minuten auf, um irgendwelche Nahrung aufzunehmen. Dann erhebt er sich rasch wieder und eilt dem nächsten Baume zu, verweilt auf diesem einige Zeit und fliegt nun weiter, entweder nach einem nächsten Baume oder wiederum nach dem Boden hernieder. Der ganze Flug tut dies, aber nicht gleichzeitig, sondern ganz nach Art unserer Häher. Ein Glied der Gesellschaft nach dem andern verläßt den Baum ton- und geräuschlos, aber alle folgen genau dem ersten und sammeln sich rasch wieder. In den Kronen der Bäume ist der Vogel außerordentlich gewandt. Er hüpft sehr rasch von Zweig zu Zweig, oft mit Zuhilfenahme seiner Flügel, sonst aber auch der Länge nach auf einem Aste fort. Der Flug erinnert ebensowohl an den unserer Häher wie an den der Spechte. Er geschieht in Bogenschwingungen, die jedoch nicht sehr tief sind. Mehrere rasche, fast schwirrende Flügelschläge heben den Helmvogel zur Höhe des Bogens empor; dann breitet er, aber nur auf Augenblicke, seine Flügel aus, ihre ganze Pracht entfaltend, sinkt ziemlich steil abwärts und erhebt sich von neuem. Dabei wird der Hals ausgestreckt, der Kopf erhoben, der Schwanz aber abwechselnd gebreitet und zusammengelegt, je nachdem der Vogel niederfällt oder sich erhebt.
In dem Magen der von mir getöteten habe ich nur Pflanzenstoffe gefunden, namentlich Beeren und Sämereien. Zu einzelnen Gebüschen, deren Beeren gerade in Reife standen, kamen die Helmvögel sehr häufig herab, immer aber hielten sie sich hier nur kurze Zeit auf. Sie naschten gewissermaßen bloß von den Früchten und eilten dann sobald als möglich ihren sicheren Laubkronen zu. Heuglin gibt auch Raupen und Kerbtiere überhaupt als Nahrungsstoffe an, und Lefevre will kleine Süßwasserschnecken in den Magen der von ihm erlegten Helmvögel gefunden haben.
Aus dem Legschlauche eines von mir erlegten Weibchens schnitt ich im April ein vollkommen reifes Ei von reinweißer Farbe, das dem unserer Haustaube an Größe und Gestaltung ungefähr gleichkam, sich aber durch seine feine Schale und seinen großen Glanz auszeichnete. Das Nest habe ich leider nicht gefunden; doch zweifle ich nicht, daß es in Baumhöhlungen angelegt wird. Ich will ausdrücklich hervorheben, daß ungeachtet der Brutzeit die meisten Helmvögel, die ich fand, in Trupps, nicht aber in Familien zusammenlebten.
Über die Gefahren, denen der freilebende Helmvogel ausgesetzt ist, habe ich keine Beobachtungen sammeln können. Es läßt sich annehmen, daß die verschiedenen Sperber und Edelfalken seiner Heimat ihm nachstellen; darauf deutet wenigstens seine große Vorsicht, sein Verbergen im dichten Gezweige, sein Einzelfliegen und das ängstlich kurze Verweilen auf dem Boden hin. Doch habe ich eben nichts Sicheres in Erfahrung bringen können. Der Abessinier verfolgt den Helmvogel nicht, und ebensowenig fällt es ihm ein, das schöne Tier gefangen an sich zu fesseln. Daher mag es denn wohl auch kommen, daß der Vogel dem Europäer gegenüber nicht gerade scheu ist. Aber er wird es, sobald er Verfolgungen erfahren hat. Schon seine Rastlosigkeit erschwert die Jagd. Der ganze Trupp gaukelt sozusagen beständig vor dem Jäger her und entschwindet diesem da, wo die Örtlichkeit nur einige Hindernisse entgegensetzt, gewöhnlich sehr bald. Am sichersten führt der Anstand unter den gedachten Lieblingsbäumen zum Ziele. Hier darf man fast mit Bestimmtheit auf Beute rechnen. »Eine bewunderungswürdige Gewandtheit«, sagt Heuglin, »zeigt unser Vogel im Klettern. Flügellahm zu Boden geschossen, läuft er rasch dem nächsten Baume zu, wie ein Sporenkuckuck am Stamme hinauf und ist im Nu im Laubwerk oder in den Schlingpflanzen verschwunden.«
Das Gefangenleben der Helmvögel haben wir namentlich seit Errichtung der Tiergärten kennengelernt. Ich habe mehrfach Turakos gepflegt und zähle sie zu den anmutigsten Käfigvögeln, die uns die Äquatorländer liefern. Mit Ausnahme der Mittagstunden, die sie ruhend verbringen, bewegen sie sich fortwährend, entfalten dabei ihre volle Schönheit und gereichen jedem größeren Gebauer zur höchsten Zierde. Namentlich in freistehenden Fluggebauern nehmen sie sich prachtvoll aus. In den Früh- und Abendstunden sind sie am lebhaftesten; bei größerer Tageshelle ziehen sie sich in das Dunkel der Blätter oder eines gegen die Sonnenstrahlen geschützten Raumes zurück. Die Sonne meiden sie ebenso wie starke Regengüsse, die ihr trockenes Gefieder so einnässen, daß sie zum Fliegen fast unfähig werden. Mit ihren Käfiggenossen vertragen sie sich ausgezeichnet, oder richtiger, sie bekümmern sich kaum um dieselben. Ich habe sie mit den verschiedenartigsten Vögeln in einem und demselben Käfig gehalten, ohne jemals wahrnehmen zu müssen, daß sie mit irgendwelchem Genossen desselben Raumes Streit angefangen hätten. Selbst wenn einer von diesen unmittelbar neben ihnen sich niederläßt, sich förmlich an sie schmiegt, ändert sich die Harmlosigkeit ihres Wesens nicht.
Ihre Gefangenenkost ist sehr einfach; sie besteht hauptsächlich aus gekochtem Reis, untermischt mit Grünzeug der verschiedensten Art, und einigen Früchten. Sie bedürfen viel Nahrung, sind aber im höchsten Grade anspruchslos. Ihre Stimme vernimmt man selten. Gewöhnlich stoßen sie ein Geknarr aus, bei besonderer Aufregung aber rufen sie laut und abgebrochen: »Kruuk, kruuk, kruuk«; andere Laute habe ich nicht vernommen.
Verreaux fand, daß die zwölf oder vierzehn Flügelfedern, die sich durch die prachtvolle purpurviolette Farbe auszeichnen, ihre Schönheit verlieren, sobald sie durchnäßt werden, ja daß sie abfärben, wenn man sie in diesem Zustande mit den Fingern berührt und reibt. Diese Tatsache ist seitdem allen aufgefallen, die Helmvögel hielten und ihnen in reinen Gefäßen, zumal in Näpfen aus weißem Porzellan, Badewasser reichten. Ein Pärchen, das Enderes beobachtete, färbte während seines Bades den Inhalt eines mittelgroßen Gefäßes so lebhaft, daß das Wasser schwachroter Tinte glich, badete sich aber täglich mehrere Male und sonderte dementsprechend eine erhebliche Menge von Farbstoff ab. Solange die Federn naß waren, spielte ihre purpurrote Färbung stark ins Blaue; nachdem sie trocken geworden waren, leuchteten sie ebenso prachtvoll purpurn wie früher. Während der Mauser färbten sie bei weitem nicht so stark ab als früher. Genau dasselbe habe ich an den von mir gepflegten Helmvögeln bemerkt. Auch nach dem Tode des Vogels mindert sich die Absonderung des Farbstoffes nicht; so wenigstens beobachteten Westerman und Schlegel. Im Tiergarten zu Amsterdam wurde ein Helmvogel von Krämpfen befallen und wie gewöhnlich unter solchen Umständen mit kaltem Wasser begossen. Der Vogel blieb in derselben Lage, wie er gefallen war, liegen, lebte noch einige Stunden und starb endlich. Es zeigte sich jetzt, daß er auf der einen Seite trocken geworden, auf der dem Boden zugekehrten aber naß geblieben war, und man bemerkte nun, daß dieses noch nasse Rot des linken Flügels in Blau verwandelt worden war, während die rote Färbung des vor dem Tode getrockneten rechten Flügels in vollkommener Schönheit sich erhalten hatte. An getrockneten Bälgen äußern Waschungen mit Wasser nicht den mindesten Einfluß, und nur dann, wenn ein Vogelbalg in verdünntem Ammoniak oder in Seifenwasser gelegen hat, kann man wahrnehmen, daß die Flügel abfärben.
*
Was die Pfefferfresser für die Neue, sind die Hornvögel ( Bucerotidae) für die Alte Welt. Sie bilden eine vereinzelt dastehende Vogelfamilie und haben streng genommen mit andern Vögeln keine Ähnlichkeit, erinnern meiner Ansicht nach aber immer noch mehr an den Pfefferfresser als an die Eisvögel, in denen man ihre nächsten Verwandten zu erkennen meint. Es hält nicht schwer, sie zu kennzeichnen; denn der lange, sehr dicke, mehr oder weniger gebogene und meist mit sonderbaren Auswüchsen, sogenannten Hörnern, versehene Schnabel bildet, so verschieden er auch gestaltet sein mag, ein so bezeichnendes Merkmal, daß sie mit andern Vögeln nicht verwechselt werden können. Sie sind aber auch im übrigen auffallend gestaltet. Der Leib ist sehr gestreckt, der Hals mittel- oder ziemlich lang, der Kopf verhältnismäßig klein, der aus zehn Federn bestehende Schwanz mittel- oder sehr lang, die Flügel kurz und stark abgerundet, die Füße niedrig, kurz und heftzehig, das Gefieder der Oberseite ziemlich kleinfederig, das der Unterseite haarig zerschlissen. Bei vielen Arten bleiben Kehle und Augengegend nackt, und das obere Augenlid trägt starke, haarartige Wimpern. Die Mannigfaltigkeit der Familie ist ausfallend; fast jede Art kann auch als Vertreter einer Sippe betrachtet werden, und jede Art unterscheidet sich außerdem noch in den verschiedenen Altersstufen ihres Lebens. Bei Untersuchung des inneren Baues fällt vor allem die Leichtigkeit der Knochen auf. Nicht bloß der ungeheuere Schnabel, sondern auch die meisten Knochen bestehen aus sehr großen, äußerst dünnwandigen Zellen, die luftführend sind. Bei vielen, vielleicht bei allen Arten dehnt sich das Luftfüllungsvermögen auch bis auf die Haut aus, die nur schwach an dem Körper haftet, an einzelnen Stellen nicht mit demselben verbunden zu sein scheint und zahlreiche, mit Luft gefüllte Zellen besitzt.
Südasien, die Malaiischen Inseln, Mittel- und Südafrika sind die Heimat der Hornvögel, von denen man etwa fünfzig in Gestalt und Färbung, Sitten und Gewohnheiten sehr übereinstimmende Arten kennt. Asien scheint den Brennpunkt ihres Verbreitungsgebietes zu bilden; aber auch in Afrika werden sie durch viele Arten vertreten. Sie finden sich vom Meeresstrande an bis zu einer unbedingten Höhe von dreitausend Meter, regelmäßig in dichten und hochstämmigen Waldungen. Alle Arten leben paarweise, sind aber der Geselligkeit zugetan und vereinigen sich deshalb oft mit ihresgleichen, mit verwandten Arten und selbst mit gänzlich verschiedenen, vorausgesetzt, daß letztere dieselbe Lebensweise teilen. Wie die Tukans verbringen auch sie den größten Teil ihres Lebens aus den Bäumen. Die Mehrzahl hat einen höchst ungeschickten Gang, bewegt sich aber mit verhältnismäßig bedeutender Gewandtheit im Gezweige der Bäume. Der Flug ist bei allen Arten besser, als man glauben möchte, wird jedoch selten weit in einem Zuge fortgesetzt, obwohl man nicht annehmen kann, daß er ermüdet; denn einzelne schweben oft halbe Stunden lang kreisend in hoher Luft umher. Bei den meisten Arten geschieht er mit so vielem Geräusch, daß man den fliegenden Hornvogel eher hört, als man ihn sieht.
Die Sinne, namentlich Gesicht und Gehör, sind wohlentwickelt, die übrigen wenigstens nicht verkümmert. Alle Hornvögel sind vorsichtige, scheue, achtsame, mit einem Wort kluge Geschöpfe. Die Stimme ist ein mehr oder weniger dumpfer, ein- oder zweisilbiger Laut, der aber mit großer Ausdauer hervorgestoßen wird und zur Belebung des Waldes wesentlich beiträgt.
Die Nahrung ist gemischter Art. Die meisten Hornvögel greifen, wenn sie können, kleine Wirbeltiere und Kerfe an, nehmen sogar Aas zu sich, und alle, ohne Ausnahme, fressen verschiedene Früchte und Körner. Einige sind Allesfresser in des Wortes vollgültigster Bedeutung.
Höchst eigentümlich ist die Art und Weise der Fortpflanzung. Sämtliche Arten, über deren Brutgeschäft bestimmte und eingehende Beobachtungen vorliegen, brüten in geräumigen Baumhöhlen, aber unter Umständen, wie sie bei keinem andern Vogel sonst noch vorkommen. Das brütende Weibchen wird bis auf ein kleines rundes Verbindungsloch vollständig eingemauert und vom Männchen, das die Atzung durch besagtes Loch in das Innere des Raumes reicht, währenddem ernährt. Die Bruthöhle wird also buchstäblich zu einem Kerker, und in ihm muß das Weibchen so lange verweilen, bis die Jungen ausgeschlüpft oder flugfertig sind. Unterdessen mausert das Weibchen, verliert wenigstens seine Federn vollständig, so daß es zeitweilig gänzlich unfähig zum Fliegen ist. Das Männchen aber sorgt unverdrossen für die Ernährung von Weib und Kind und muß sich, sagt man, dabei so anstrengen, daß es gegen Ende der Brutzeit hin »zu einem Gerippe« abmagert.
Die freilebenden Hornvögel, zumal die größeren Arten, haben wenig Feinde; denn die meisten Raubvögel scheuen wohlweislich die Kraft der gewaltigen Schnäbel, müssen es sich im Gegenteil gefallen lassen, gefoppt und geneckt zu werden. Auch der Mensch behelligt jene wenig, hält einige sogar für geheiligte Wesen. Demungeachtet scheinen sie überall in ihm ihren ärgsten Feind zu erkennen und weichen ihm mit größter Vorsicht aus. Aber wie alle klugen und vorsichtigen Tiere werden sie, wenn sie in Gefangenschaft gelangen, bald zahm und beweisen dann eine so innige Anhänglichkeit an ihren Pfleger, daß dieser es ihnen gestatten kann, nach Belieben sich zu bewegen, da sie nur ausnahmsweise die ihnen gewährte Freiheit mißbrauchen.
Als Vertreter der indischen Arten der Familie mag zuerst der Doppelhornvogel Erwähnung finden. Die von ihm vertretene Sippe ( Dichoceros) kennzeichnet der große, hohe, breite, über das erste Schnabeldritteil hinausreichende, einen beträchtlichen Teil des Vorderkopfes überdeckende, hinten abgestutzte, vorn in zwei stumpfe Spitzen geteilte Schnabelaufsatz.
»Homrai« nennen die Nepalesen den Doppelhornvogel ( Dicoceros bicornis). Sein Gefieder ist der Hauptsache nach schwarz; der Hals, die Spitzen der oberen Schwanzdecken, der Bauch und die Unterschwanzdeckfedern, ein Flügelfleck, die Handschwingen an der Wurzel, sämtliche Schwingen an der Spitze und endlich die Steuerfedern, mit Ausnahme eines breiten, schwarzen Bandes vor der Spitze, sind mehr oder weniger reinweiß. Das Auge ist scharlachrot, der Oberschnabel, einschließlich des Aufsatzes, rot, in Wachsgelb übergehend, der Unterkiefer gelb, rot an der Spitze, der Wurzelteil des Schnabels bleischwarz, die nackte Augenhaut schwarz, der Fuß dunkelbraun. Die Länge beträgt 1,2 Meter, die Fittichlänge 50 bis 52 Zentimeter, die Schwanzlänge 44 Zentimeter, die Länge des Schnabels 26 Zentimeter, vom Hinteren Teil des Aufsatzes bis zur Spitze 34 Zentimeter, der Aufsatz selbst mißt 20 Zentimeter in der Länge und 8,5 Zentimeter in der Breite. Der Homrai verbreitet sich über die Hochwaldungen Indiens vom äußersten Süden an bis zum Himalaya und kommt übrigens auch auf Sumatra vor. Laut Jerdon haust er in Indien an Bergwänden bis fünfzehnhundert Meter über dem Meer, meist aber tiefer, gewöhnlich paarweise, seltener in kleinen Flügen.

Doppelhornvogel (Dichoceros bicornis)
Malerisch schildert Hodgson das Auftreten und Wesen des Homrai. Der Vogel wählt mit Vorliebe offene und bestellte Rodungen, wie sie in der Nähe der Flüsse mitten in den Waldungen angelegt werden, zu seinem Aufenthalt. Er lebt gesellig und zeichnet sich durch seine ernsten und ruhigen Gewohnheiten und Bewegungen ebenso aus wie durch Selbstvertrauen und Würde. Auf dem Wipfel eines hohen phantastischen Baumes sieht man die großen absonderlichen und selbstbewußten Vögel stundenlang bewegungslos sitzen, ihren Hals eingezogen und fast versteckt zwischen den Flügeln, den Leib auf die Fußwurzeln niedergebogen. Gelegentlich erhebt sich einer zu kurzem Flug, in der Regel in Begleitung eines oder zweier Gefährten, und strebt einem andern hohen Baum zu. Niemals begibt er sich, soweit Hodgsons Beobachtungen reichen, zum Boden herab oder setzt sich auch nur auf einen niedrigen Baum. Zwanzig oder dreißig dieser Vögel findet man gewöhnlich in unmittelbarer Nachbarschaft, sechs oder acht auf demselben Baum, dann und wann einige halb unterdrückte Laute ausstoßend, die ebenso seltsam sind wie ihre Gestalt und Sitten. Diese Laute erinnern an das Quaken eines Ochsenfrosches, übertreffen dasselbe auch kaum an Stärke. Wenn aber der unerbittliche Jäger solcher feierlichen Versammlung sich aufdrängt und, ohne tödlich zu verwunden, einen der Vögel vom Baum herabschießt, setzt ihn das brüllende Geschrei des gefährdeten Homrai in höchstes Erstaunen. Denn mit nichts anderm kann man die dann vernehmbaren heftigen Laute vergleichen als mit dem Schreien eines Esels. Ihre Gewalt ist außerordentlich und wohl eine Folge der ungewöhnlich knochigen Luftröhre und Stimmritze. Bei jedem dieser Laute erhebt der Vogel Hals und Kopf, so daß der Schnabel fast senkrecht steht, und senkt ihn dann wieder abwärts.
»Der Homrai«, so fährt Hodgson fort, »fliegt mit ausgestrecktem Hals und eingezogenen Beinen, wagerecht gehaltenem und etwas ausgebreitetem Schwanz. Sein ermüdender Flug beschreibt eine gerade Linie und wird unterhalten durch schwerfällige, gleichmäßige, aber rasch nacheinander wiederholte Schläge der Flügel, die, obschon sie groß genug sind, doch verhältnismäßig kraftlos zu sein scheinen, wahrscheinlich infolge des lockeren Zusammenhaltens der Wirbelsäule.« Alle Flügelschläge werden von einem lauten, sausenden Geräusche begleitet, das nach Jerdon noch in einer Entfernung von einer englischen Meile vernehmbar sein soll. Auf dem Boden ist der Doppelhornvogel, wenn auch nicht gänzlich fremd, so doch sehr ungeschickt. Seine Füße sind nicht zum Gehen, wohl aber bewunderungswürdig geeignet, einen starken Zweig zu umklammern. Auch bieten die Bäume, wie Hodgson hervorhebt, dem Vogel alles, was er zum Leben bedarf, Nahrung und Ruhe auf derselben Stelle. Dann und wann fällt es dennoch einem Homrai ein, das Gezweige zu verlassen und auf den Boden herabzufliegen.
In Fruchtgärten wird der Homrai zuweilen sehr lästig. Im Jahre 1867 wurde ein Garten von den Homrais so arg heimgesucht, daß ein Dutzend von ihnen abgeschossen werden mußte. Sie erschienen auf den Bäumen, kletterten hier fast wie Papageien umher, indem sie den Schnabel zu Hilfe nahmen, und entleerten die Kronen von allen Früchten, die an ihnen hingen. In dem betreffenden Garten standen Orangenbäume, die sehr große, lockerschalige Früchte trugen. Diese fand Horne, der Besitzer des Gartens, oft dem Anschein nach unberührt am Zweige hängen, innerlich aber vollständig entleert. Daß man nach solchen Wahrnehmungen den Homrai als ausschließlichen Pflanzenfresser betrachtet, wird erklärlich; Beobachtungen an gefangenen aber erschüttern eine solche Anschauung wesentlich. Auch hier nehmen zwar die Hornvögel Früchte aller Art mit Vorliebe an, einige Sorten von diesen so ungemein begierig, daß man dieselben geradezu als Leckerbissen betrachten darf; außer Pflanzennahrung aber verlangen sie auch tierische Stoffe. Einzelne von ihnen zeigen sich als förmliche Raubtiere, die jedes lebende und schwächere Wesen in ihrer Nähe überfallen und umbringen. Sie entvölkern ein Fluggebauer, in das man sie bringt, in kürzester Frist. Denn trotz ihres anscheinend ungeschickten Wesens wissen sie sich ihrer Mitbewohner bald zu bemächtigen, lauern, ruhig auf einer und derselben Stelle sitzend, auf den unachtsamen Vogel, der in ihre Nähe kommt, fangen ihn durch plötzliches Hervorschnellen des Schnabels im Sitzen oder im Fliegen, schlagen ihn einigemal gegen den Boden, stellen sich sodann mit dem Fuß auf die glücklich erlangte Beute und verzehren dieselbe mit so ersichtlichem Behagen, daß man schwerlich an unnatürliche, erst in der Gefangenschaft erlernte Gelüste glauben darf. Jeder Bissen, den sie nehmen, wird vorher in die Luft geworfen und mit dem Schnabel wieder aufgefangen. Ihre Fertigkeit in dieser Beziehung ist überraschend und steigert sich durch Übung bald so, daß sie die ihnen zugeworfenen Leckereien fast unfehlbar ergreifen, mögen dieselben kommen, von welcher Seite sie wollen. Die Homrais verschmähen zwar nicht gänzlich das Wasser, wie Hodgson behauptet, trinken aber in der Tat nur äußerst selten; bei ausschließlicher Fütterung mit frischen Früchten nur alle vierzehn Tage, bei gemischter Nahrung hingegen alle drei bis vier Tage einmal.
Über das Brutgeschäft liegen mehrere Beobachtungen vor. Horne hatte überaus günstige Gelegenheit, die Vögel beim Nestbau zu beobachten. »Im April 1868«, so erzählt er, »erhielt ich Mitteilung von zwei Nestern, die beide in hohlen Baumwollbäumen angelegt waren, nachdem die Vögel mit ihren Schnäbeln den Mulm herausgehoben und so die Höhlung zu erwünschter Weite vervollständigt hatten. In jedem Fall erhielt ich drei Eier, und beide Male schien die Öffnung mit Kuhdünger oder einer ihm ähnelnden Masse verschlossen zu sein. Ich vermochte jedoch, der großen Höhe wegen, nicht, dies genau zu bestimmen, und da ich jedesmal sechs bis acht englische Meilen weit zu gehen hatte, fehlte mir die Gelegenheit, den Hergang der Sache zu beobachten. Der Vogel, den ich aus einem der Nester entnehmen ließ, hatte viele von den ohnehin locker sitzenden Federn verloren und war in einem sehr schlechten Zustand. Glücklicher als bisher sollte ich zu Ende desselben Monats sein. Auf einer Blöße, sehr nahe bei meiner Veranda, stand, umgeben von andern Bäumen, ein stolzer Sisubaum mit einer Höhle in der ersten Gabelung, um deren Besitz Papageien und Raken langwierige Streitigkeiten ausfochten. Ich hatte oft gewünscht, daß diese Höhle von Doppelhornvögeln ausersehen werden möge, und war höchst erfreut, wahrzunehmen, daß nach langer Beratung und wiederholter Besichtigung, nach endlosem Schreien der Raken und Kreischen der Papageien ein Pärchen jener Vögel am 26. April Anstalten traf, sich in Besitz derselben zu setzen. Die Höhlung hatte ungefähr dreißig Zentimeter Tiefe und innen genügenden Raum. Am 29. April begab sich das Weibchen in das Innere und erschien fortan nicht wieder vor der Höhle. Es hatte gerade Platz, um auch seinen Kopf zu verstecken, wenn es verborgen zu sein wünschte oder Unrat von unten nach oben bringen wollte. Die Höhle befand sich etwa drei Meter über dem Boden und meiner Veranda gerade gegenüber, so daß ich jeden Vorgang mit Hilfe eines Fernglases vollkommen genau beobachten konnte. Nachdem das Weibchen sich in das Innere zurückgezogen hatte, zeigte sich das Männchen sehr geschäftig, es zu atzen, und brachte ihm gewöhnlich eine kleine Frucht der heiligen Feige. Am 30. April begann jenes eifrig an dem Verschluß zu arbeiten und benutzte hierzu vornehmlich seinen eigenen Unrat, den es vom Boden der Höhle heraufholte, rechts und links anklebte und mit der flachen Seite seines Schnabels wie mit einer Mauerkelle bearbeitete. Das Männchen sah ich niemals etwas anderes tun als Futter zutragen, niemals auch fand ich eine ausgeworfene Frucht unter dem Baum und immer nur sehr wenig Unrat, welch letzterer dem Anschein nach von dem Weibchen selbst ausgeworfen wurde, nachdem der Verschluß hergestellt worden war. Das Männchen erschien in der Nähe des Baumes, flog zu der Höhlung, klammerte sich mit den Klauen an der Rinde fest und klopfte mit dem Schnabel an. Auf dieses Zeichen hin erschien das Weibchen und empfing die Frucht, worauf das Männchen wieder davonflog. Die Öffnung, die anfänglich bei fünfzehn Zentimeter Höhe noch drei oder vier Zentimeter Breite hatte, wurde zuletzt so eng geschlossen, daß man an der weitesten Stelle eben den kleinen Finger durchstecken konnte. Doch ist hierbei nicht zu vergessen, daß der Schnabel beim Öffnen immerhin noch einen Spielraum von acht bis zehn Zentimeter hatte, da die Öffnung eine schlitzförmige war. Das Zukleben des äußeren Loches nahm zwei oder drei Tage in Anspruch. Von dieser Zeit an wurde der Unrat des Weibchens, den es bisher hauptsächlich zum Verkleben verwendet hatte, ausgeworfen. Ein dritter Nashornvogel, der sich in der Gegend umhertrieb, sah dem Hergang aufmerksam zu, stritt sich dann und wann mit dem erwählten Männchen, trug dem Weibchen aber niemals Futter zu. Am 7.Mai, nachdem ich meiner Meinung nach dem Weibchen genug Zeit zum Legen gegönnt hatte, bestieg ich mit Hilfe einer Leiter den Baum, öffnete das Nest und zog das Weibchen, das sich in sehr gutem Zustand befand, mit einiger Schwierigkeit aus der Höhlung heraus, um die von mir gewünschten drei Eier zu erhalten. Anfänglich vermochte es kaum zu fliegen, war dies jedoch nach geraumer Zeit wieder imstande. Die Eingeborenen, die die Gewohnheiten dieser Vögel sehr gut kennen, erzählten mir, daß das Weibchen die Wand durchbreche, sobald seine dem Ei entschlüpften Jungen nach Futter begehren, und diese Angabe dürfte in der Tat richtig sein.«
Auch die fernere Entwicklung des jungen Doppelhornvogels scheint langsam zu verlaufen; wenigstens versichert Hodgson, daß er erst im vierten oder fünften Jahre zu voller Ausbildung gelange. Blyth hingegen behauptet nach Beobachtungen an gefangenen Doppelhornvögeln, daß drei Jahre zur Entwicklung genügen.
Über das Gefangenleben des Vogels teilt Tickell nachstehendes mit. »Der Homrai wird, wenn er jung aufgezogen ist, sehr zahm, bleibt aber immer kühn und bedroht diejenigen, die er nicht kennt, mit seinem gewaltigen und gefährlichen Schnabel. Einer ließ sich keine Liebkosungen gefallen, wie es kleinere Arten der Familie tun. Er flog im Garten umher, hielt sich hier auf großen Bäumen oder auch auf dem Hausdach auf, kam zuweilen zum Boden herab, hüpfte hier mit schiefen Sprüngen umher, fiel dabei gelegentlich auch auf die Handwurzel nieder und suchte sich im Grase Futter zusammen. Einmal sah man ihn einen Frosch fangen, aber wieder wegwerfen, nachdem er ihn untersucht hatte. Bei seinen morgendlichen Spaziergängen näßte er sich oft das Gefieder ein, dann pflegte er sich, wenn die Sonne kam, mit ausgespannten Flügeln ruhig hinzusetzen, um die Federn wieder zu trocknen, übrigens schienen zwei andere gefangene zu beweisen, daß ihnen die Nässe durchaus nicht unangenehm war; denn sie setzten sich oft stundenlang den heftigsten Regengüssen aus und ließen sich vollständig einnässen. Die laute Stimme vernahm man niemals, sondern bloß ein schwaches, murmelndes Grunzen. Seine Gefräßigkeit war großartig; er konnte eine Paradiesfeige ohne Mühe hinabwürgen.« Ich will nur noch hinzufügen, daß die Homrais bei geeigneter Pflege, namentlich bei gleichmäßiger Wärme, jahrelang die Gefangenschaft ertragen und sich im Käfig recht wohl zu fühlen scheinen. Unter sich zeigen sie sich ebenso verträglich als andern kleineren Vögeln gegenüber unverträglich. Während einer der von mir beobachteten gefangenen einen vertrauensvoll an ihm vorüberfliegenden Tukan aus der Luft griff, abwürgte und auffraß, kamen unter verschiedenartigen Hornvögeln, wenigstens solchen gleicher Größe, ernstere Zänkereien und Streitigkeiten nicht vor, höchstens spielende Zweikämpfe, die sich sehr hübsch ausnehmen. Beide hocken einer dem andern gegenüber nieder, springen plötzlich vorwärts, schlagen unter hörbarem Klappen die Schnäbel zusammen und ringen nun förmlich miteinander. Zuweilen scheint aus solchen Spielen Ernst werden zu wollen; immer aber bemerkt man, daß es nichts anderes sein soll als eben nur ein Spiel. Verschiedenartige Hornvögel bekunden gegenseitiges Einverständnis wenigstens dadurch, daß sie ihre Rufe beantworten.

Südafrikanischer Hornrabe (Bucorvus cafer)
Der berühmteste aller afrikanischen Hornvögel ist der Hornrabe, »Abbagamba« der Abessinier ( Bucorvus abyssinicus, bzw. guineensis, cafer), Man kennt daher von ihm verschiedene geographisch getrennte Rassen. Unsere beiden Abbildungen stellen zwei von diesen dar, nämlich den »Südafrikanischen Hornraben« ( Bucorvus cafer) und den »Guineahornraben« ( Bucorvus guineensis). Herausgeber Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Bucorvus). Er gehört zu den größten Arten der Familie, ist kräftig gebaut, kurzflügelig, kurzschwänzig, aber ziemlich hochbeinig. Sein Schnabel ist sehr groß, schwach gebogen, seitlich abgeplattet, stumpfspitzig, in der Mitte der Schneiden klaffend, aber nur mit einem kurzen, obschon ziemlich hohen Auswuchse über der Wurzel des Oberschnabels verziert. Der Aufsatz beginnt auf der Scheitelmitte, reicht ungefähr bis zum ersten Dritteil der Schnabellänge vor, ist vorn entweder offen und dann röhrenartig oder abgeschlossen und hat ungefähr die Form eines nach vorn gekrümmten Helmes, dessen breiter und flacher Oberteil von den sanft gerundeten, nach unten zu eingebogenen und mit der Schnabelwurzel verschmolzenen Seitenteilen durch eine Längsreihe kantig abgesetzt ist. Die sehr kräftigen Beine unterscheiden sich von denen anderer Hornvögel durch die Höhe der Läufe, die zweimal die Länge der Mittelzehe beträgt, und die sehr dicken Zehen, deren äußere und mittlere im letzten Gliede verwachsen und deren innere und mittlere im vorletzten Gliede durch eine Spannhaut verbunden sind. In dem Fittich, in dem die sechste Schwinge die längste ist, überragt die Spitze nur wenig die Oberarmfedern. An dem mittellangen Schwanze, dessen Länge ungefähr der Hälfte der Fittichlänge gleichkommt, verkürzen sich die äußeren Federn nicht erheblich. Die Augen und die Kehlgegend sind nackt und sehr lebhaft gefärbt. Das Gefieder ist, bis auf die zehn gelblich-weißen Handschwingen, glänzend schwarz, das Auge dunkelbraun, der Schnabel, mit Ausnahme eines Fleckes am Oberschnabel, der hinten rot, vorn gelb ist, schwarz, der Augenring wie die Kehle dunkel bleigrau, letztere breit hochrot gesäumt. Das Weibchen unterscheidet sich hauptsächlich durch etwas geringere Größe und das weniger entwickelte nackte Kehlfeld. Die Länge beträgt nach eigenen Messungen 1,13, die Breite 1,83 Meter, die Fittichlänge 57, die Schwanzlänge 35 Zentimeter.
Das Wohngebiet des Hornraben erstreckt sich über ganz Mittel- und Südafrika. Man kennt ihn aus Habesch und den benachbarten Ländern, dem ganzen südlichen Sudan, Westafrika vom Senegal bis zum Kapland und ebenso von der ganzen Südostküste Afrikas. In den von mir bereisten Teilen Afrikas kommt er südlich des siebzehnten Breitengrades ziemlich überall, jedoch nicht allerorten in gleicher Häufigkeit vor; denn er bewohnt mehr die waldigen Steppenländer und die Gebirge als die eigentlichen Urwaldungen oder die baumlosen Gegenden. In Habesch steigt er, laut Heuglin, bis zu viertausend Meter im Gebirge empor, wird jedoch häufiger in einem Gürtel zwischen ein- und zweitausend Meter angetroffen. Nach der Brutzeit vereinigen sich zuweilen mehrere Paare mit ihren Jungen, und es kann dann geschehen, daß man ihrer zehn bis zwölf Stück gemeinschaftlich umherwandern sieht. Gewöhnlich lebt der Hornrabe paarweise und nicht unter seinen Gattungsverwandten, ist auch kein Baumvogel im eigentlichen Sinn des Wortes, sondern schreitet rabenartig auf der Erde umher, hier Nahrung suchend, und nimmt nur, wenn er aufgescheucht wird, auf Bäumen seine Zuflucht oder erwählt sie zu seinen Ruhesitzen. Einzeln stehende, dicht belaubte Hochbäume auf Lichtungen und Triften oder an Talgehängen, die weite Aussicht gestatten, werden, nach Heuglin, ähnlichen Orten bevorzugt. Doch begnügt sich der Abbagamba im Notfall auch mit einem höheren Felsblock oder einer Bergkuppe, die ihm weite Umschau gestattet. »Naht«, sagt Heuglin, »Gefahr, die das ruhige Auge bald erkennt, so flüchtet er womöglich hinter Steine, Büsche und Hecken oder geht etwas mühsam auf, streicht in mäßiger Höhe und meist in gerader Linie, die Flügel kurz, kräftig und geräuschvoll schlagend, ein gutes Stück weit und läßt sich gewöhnlich auf einer erhabenen Stelle der Erde, auf Felsen oder dürren Baumästen nieder, um seinen Feind zu beobachten.«
Der Vogel ist eine so auffallende Erscheinung, daß ihn jeder Eingeborene kennt und er sich überall eine gewisse Achtung erworben hat. Bei Erregung gebärdet sich namentlich das Männchen sehr sonderbar, breitet seinen Schwanz aus und legt ihn wieder zusammen, ganz nach Art des Truthahnes, bläst seinen Kehlsack auf, schleift seine Flügel auf dem Boden und gibt sich überhaupt ein gewaltiges Ansehen. Der Gang ist rabenartig, aber etwas wackelnd, der Flug keineswegs schwach, wie behauptet wird, sondern im Gegenteil leicht und schön, auch auf große Strecken hin schwebend, sobald der Vogel erst eine gewisse Höhe erreicht hat. Doch liebt es auch der Hornrabe nicht, in einem Zuge weite Strecken zu durchmessen, sondern fällt, wenn er aufgescheucht wurde, bald wieder ein. Sind Bäume in der Nähe, so pflegt er zunächst diesen sich zuzuwenden und von der Höhe aus umherzuspähen. Erscheint ihm etwas bedenklich, so erhebt er sich hoch auf den Füßen und schaut mit geöffnetem Schnabel ängstlich den Ankommenden entgegen. Der erste Laut, der von einem ausgestoßen wird, gibt dann das Zeichen zur Flucht für die ganze Gesellschaft. Scheu und vorsichtig ist er unter allen Umständen, und deshalb hält es schwer, sich ihm zu nahen. Selbst beim Futtersuchen wählt er sich am liebsten solche Stellen, die nach allen Seiten hin freie Umschau gestatten.
In dem Magen eines männlichen Hornraben, den ich zerlegte, fand ich unter Dungkäfern und Heuschrecken einige Würmer und ein ziemlich großes Chamäleon. Gourney gibt Schnecken, Eidechsen, Frösche, Ratten, Mäuse, verschiedene Heuschrecken, Käfer und andere Kerbtiere, Monteiro Lurche, Vögel, Eier, Käfer, Mandiokawurzeln und Grundnüsse als seine Nahrung an. »Er jagt«, sagt Gourney, »am liebsten da, wo das Gras weggebrannt wurde, hackt mit seinem kräftigen Schnabel in den harten Boden, dreht hastig Erdklumpen um, so daß der Staub davonfliegt, nimmt die gefangenen Kerbtiere, wirft sie in die Luft, fängt sie wieder auf und läßt sie in den Schlund hinabrollen. Größere Schlangen tötet er auf folgende Art: Wenn einer der Vögel ein derartiges Kriechtier entdeckt hat, kommt er mit drei oder vier andern herbei, nähert sich von der Seite mit ausgebreiteten Schwingen und reizt mit diesen die Schlange, dreht sich aber im rechten Augenblick plötzlich um, versetzt ihr einen gewaltigen Hieb mit dem Schnabel und hält geschwind wieder seinen schützenden Flügelschild vor. Diese Angriffe werden wiederholt, bis die Schlange tot ist. Geht diese zum Angriff über, so breitet der Hornrabe beide Flügel aus und schützt damit den Kopf und die verwundbarsten Teile.«
Die Stimme ist ein dumpfer Laut, der wie »Bu« oder »Hu« klingt. »Locken sich Männchen und Weibchen«, sagt Heuglin, »so stößt der eine, wahrscheinlich das Männchen, diesen dumpfen, weit hörbaren Laut aus, und auf ihn antwortet der andere ebenso, aber um eine Oktave höher. Diese Unterhaltung der Gatten, die fast unzertrennlich sind, dauert oft wohl eine Viertelstunde lang ununterbrochen fort, bis irgendeine äußere Störung sie beendet.« Gegen die Paarungszeit hin, die im Sudan in die Monate unseres Herbstes fällt, rufen die Hornvögel öfter und erregter als sonst, bewegen sich auch in so eigentümlicher Weise, daß Heuglin von einer Balze derselben sprechen kann. »Beide Gatten treiben sich merklich aufgeregt und in erhabener Stellung, die Kehlhaut aufgeblasen, fauchend auf Lichtungen umher und stoßen Töne aus, die aus einer großen, hohlen Tonne zu kommen scheinen.«
Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß der Hornrabe in hohlen Bäumen brütet, und durch Heuglin, daß er kleine, runde, rauhschalige, weiße Eier legt. Ob das Gelege aus mehr als einem einzigen Ei besteht, und ob das Weibchen eingemauert wird, ist, soviel mir bekannt, zurzeit noch nicht entschieden. Die Baumhöhlung, die ich auffand, zeigte keine Spur von einer derartigen Arbeit und enthielt nur ein einziges Junges. Dasselbe war ziemlich flügge und bis auf den Mittelteil der Schwungfedern rein schwarz. Von einem Horn auf der Schnabelwurzel war noch keine Spur zu sehen. Wir versuchten die Alten beim Neste zu schießen und brachten das schon ausgehobene Junge deshalb wieder in die Nisthöhle zurück; keines der scheuen Eltern aber ließ sich erblicken. Das Junge wurde mit rohem Fleisch ernährt und zeigte sich bald sehr zutraulich. Es war auf unserer Barke nicht gefesselt, sondern konnte sich nach Belieben bewegen, hatte sich aber bald einen bestimmten Platz ausgewählt und kehrte zu diesem unter allen Umständen zurück. In Chartum durfte der Hornrabe im Hofe umherspazieren und treiben, was er wollte; er machte auch von der ihm geschenkten Freiheit umfassenden Gebrauch, übrigens wußte er sich auch sonst zu unterhalten. Er verfolgte unsere zahmen Ibisse, jagte nach Sperlingen oder trabte in lächerlicher Weise, scheinbar nutzlos, im Hofe auf und nieder, sprang zuweilen vom Boden auf, führte die wunderlichsten Bewegungen mit dem Kopfe aus usw. Nicht selten bestieg er eine unserer Lagerstätten, legte sich hier gemütlich nieder, breitete die Flügel aus und steckte seinen Kopf bald unter den Bauch, bald unter die Flügel. Gegen uns war er durchaus nicht bösartig; er ließ sich streicheln, aufheben, forttragen, besehen und untersuchen, ohne jemals in Zorn zu geraten, gebrauchte überhaupt seinen furchtbaren Schnabel niemals.
Die Eingeborenen Afrikas stellen dem Hornraben nicht nach, weil sie sein Fleisch nicht zu verwerten, den erbeuteten überhaupt nicht zu benutzen wissen. Hiervon machen, soviel mir bekannt, nur die Bewohner Schoas eine Ausnahme, da unter ihnen, laut Heuglin, seine Federn als gesuchter Schmuck tapferer Krieger gelten und von denen getragen werden, die einen Feind erschlagen oder ein größeres Jagdtier getötet haben. Hier und da soll der Vogel zu den heiligen, in Abessinien dagegen zu den unreinen Tieren gezählt werden. Eine eigentümliche Jagdweise ist in Kordofân üblich. »Man pflegte den Hornraben«, sagt Rüppell, »für mich regelmäßig lebend einzufangen, indem man ihn durch stetes Nachjagen zu Pferde so lange verfolgte, bis er, aufs äußerste ermüdet, sich nicht mehr aufschwingen konnte.«
*
Einem der prachtvollsten, durch Sagen und Märchen vielfach verherrlichten Vögel unseres Erdteiles zuliebe hat eine zahlreiche, etwa hundertfünfundzwanzig Arten zählende Familie den sehr unpassenden Namen Eisvögel erhalten; denn die bei weitem größte Anzahl der hierher zu zählenden Leichtschnäbler lebt in dem warmen Gürtel der Erde und weiß nichts von Eis und Winter. Die Eisvögel ( Alecedinidae) kennzeichnen sich durch kräftigen Leib, kurzen Hals, großen Kopf, kurze oder mittellange Flügel, kurzen oder höchstens mittellangen Schwanz, langen, starken, geraden, winkeligen, spitzigen Schnabel, sehr kleine, drei- oder vierzehige Füße und glattes, meist in prächtigen Farben prangendes Gefieder, das sich nach dem Geschlechte kaum, nach dem Alter wenig unterscheidet. Die Eisvögel sind Weltbürger und ziemlich gleichmäßig verteilt, obgleich die Familie, wie zu erwarten, sich erst innerhalb des warmen Gürtels in ihrer vollen Reichhaltigkeit zeigt. Alle Arten der Familie bevorzugen die Nachbarschaft kleinerer oder größerer Gewässer, aber nicht alle sind an das Wasser gebunden, nicht wenige, vielleicht sogar die meisten, im Gegenteil zu Waldvögeln im eigentlichsten Sinne geworden, deren Lebensweise dann mit jener ihrer wasserliebenden Verwandten kaum noch Ähnlichkeit hat.
Ihre Begabungen sind eigentümlicher Art. Zu gehen vermögen sie kaum, im Fliegen sind sie ebenfalls ungeschickt, und nur das Wasser beherrschen sie in einem gewissen Grade; sie tauchen in absonderlicher Weise und verstehen auch ein wenig zu schwimmen. Unter ihren Sinnen steht das Gesicht obenan; ziemlich gleich hoch entwickelt scheint das Gehör zu sein; über die übrigen Sinne haben wir kein Urteil. Die hervorragendste Eigenschaft scheint unbegrenztes Mißtrauen zu sein. Sie bekunden ungemein große Anhänglichkeit an ihre Brut.
Fische, Kerbtiere, Krebse und dergleichen bilden ihre Nahrung; an Lurchen, Kriech- und andern Wirbeltieren, die den verwandten Liesten sehr häufig zum Opfer fallen, vergreifen sie sich wohl niemals. Ruhig und still auf einem günstigen Zweige über dem Wasser sitzend, oder nach Art fischender Seeschwalben und Möwen über demselben auf- und niederstreichend, sehen sie in die Tiefe hinab und stürzen sich plötzlich mit mehr oder minder großer Kraft auf den erschöpften Fisch, verschwinden hierbei gewöhnlich unter der Oberfläche des Wassers, arbeiten sich durch kräftige Flügelschläge wieder empor und kehren zum alten oder einem ähnlichen Sitze zurück, warten, bis der von ihnen erfaßte Fisch erstickt ist, führen seinen Tod auch wohl dadurch herbei, daß sie ihn mit dem Kopf gegen den Ast schlagen, schlingen ihn hierauf, den Kopf voran, ganz wie er ist, hinunter und verfahren genau wie vorher.
Die Vermehrung der Eisvögel ist ziemlich bedeutend; denn alle Arten ziehen eine zahlreiche Brut heran. Zum Nisten wählen sie sich steile Erdwälle, in denen sie eine tiefe Höhle ausgraben, deren hinteres Ende zur eigentlichen Nestkammer erweitert wird. Ein Nest bauen sie nicht, häufen aber nach und nach so viele, hauptsächlich aus Fischgräten bestehende Gewölle in ihrer Nestkammer an, daß im Verlaufe der Zeit doch eine Unterlage entsteht.
Dem menschlichen Haushalt bringen die Eisvögel keinen Nutzen, aber auch eigentlich keinen Schaden. In fischreichen Gegenden fällt die Masse der Nahrung, die sie bedürfen, nicht ins Gewicht, und die bei uns lebende Art ist so klein, daß von einer durch sie bewirkten Beeinträchtigung des Menschen kaum gesprochen werden kann.

Eisvogel (Alcedo ispida)
Unser Eisvogel oder Königsfischer ( Alcedo ispida) kennzeichnet sich durch sein prachtvoll gefärbtes Gefieder, das oben metallisch, unten seidig glänzt. Die Federn des Hinterkopfes sind zu einer kleinen Holle verlängert. Mit einem andern europäischen Vogel läßt sich der Königsfischer nicht verwechseln, mit ausländischen Arten seiner Familie aber wohl. Oberkopf und Hinterhals sind auf düster grünschwarzem Grunde mit schmalen, dicht stehenden, meerblauen Querbinden gezeichnet, Schultern, Flügeldecken und die Außenfahne der braunschwarzen Schwingen dunkel meergrün, die Flügeldeckfedern mit rundlichen, meerblauen Spitzenflecken geziert, die mittleren Teile der Oberseite schön türkisblau, ein Streifen über den dunkleren Zügeln und ein Längsfleck am unteren Augenrande bis hinter die Ohrgegend sowie die ganze Unterseite und die unteren Schwanz- und Flügeldecken lebhaft zimmetrostrot, Kinn und Kehle rostgelblichweiß, ein breiter Streifen, der sich von der Schnabelwurzel und unter dem Zimmetrot der Ohrgegend hinabzieht, die Enden der oberen Brustseitenfedern, die seitlichen Schwanzdecken und die Schwanzfedern endlich dunkel meerblau. Die Iris ist tiefbraun, der Schnabel schwarz, die Wurzel der unteren Hälfte rot, der kleine Fuß lackrot. Die Länge beträgt siebzehn, die Breite siebenundzwanzig bis achtundzwanzig, die Fittichlänge sieben, die Schwanzlänge vier Zentimeter. Ganz Europa, von Jütland, Dänemark, Livland und Estland an nach Süden hin, sowie der westliche Teil Mittelasiens sind die Heimat des Eisvogels.
Bei uns zulande sieht man den prachtvollen Vogel überall, immer aber nur einzeln. Er fällt wegen seines schönen Gefieders ebenso auf als wegen seiner sonderbaren Lebensweise und ist deshalb wohlbekannt, obgleich seinerseits bemüht, den Blicken des Menschen möglichst sich zu entziehen. Am liebsten bewohnt er kleine Flüsse und Bäche mit klarem Wasser, und ihnen zuliebe steigt er auch hoch im Gebirge empor, in den Alpen, laut Tschudi, bis zu eintausendachthundert Meter unbedingter Höhe. An trüben Gewässern fehlt er meist, wenn auch nicht immer. Flüsse oder Bäche, die durch Wälder fließen oder wenigstens an beiden Ufern mit Weidicht bestanden sind, bieten ihm Aufenthaltsorte, wie er sie vor allen andern leiden mag, und wenn sie so viel Fall haben, daß sie im Winter wenigstens nicht überall zufrieren, verweilt er an ihnen auch in dieser schweren Zeit. Sind die Verhältnisse nicht so günstig, so muß er sich wohl oder übel zum Wandern bequemen, und gelegentlich dieser Wanderungen fliegt er bis nach Nordafrika hinüber.
Gewöhnlich sieht man ihn nur, während er pfeilschnell über den Wasserspiegel dahineilt; denn der, der ihn im Sitzen auffinden will, muß schon ein Kundiger sein. Namentlich in der Nähe bewohnter Ortschaften oder überhaupt in der Nähe regen Verkehrs wählt er sich zu seinen Ruhesitzen stets möglichst versteckte Plätzchen und Winkel aus, beweist darin ein großes Geschick, scheint sich auch sehr zu bemühen, bis er den rechten Ort gefunden hat. Daß der schließlich gewählte Platz der rechte ist, erkennt man bald, weil alle Eisvögel, die einen Fluß besuchen, sich auch stets dieselben Sitzplätze erküren. Die Nacht verbringt er unter einer überhängenden Uferstelle oder selbst im Innern einer Höhlung. Jeder einzelne Eisvogel, oder wenigstens jedes Paar, behauptet übrigens ein gewisses Gebiet und verteidigt dasselbe mit Hartnäckigkeit; es duldet höchstens den Wasserschwätzer und die Bachstelze als Genossen.
Wenn irgendein Vogel »Sitzfüßler« genannt werden darf, so ist es der Eisvogel. Er sitzt buchstäblich halbe Tage lang regungslos auf einer und derselben Stelle, immer still, den Blick auf das Wasser gekehrt, mit Ruhe einer Beute harrend, »kühl bis ans Herz hinan«, so recht nach Fischer Art. »Seine kleinen Füßchen«, sagt Naumann, »scheinen nur zum Sitzen, nicht zum Gehen geeignet; denn er geht äußerst selten und dann nur auf einige Schrittchen, etwa auf der kleinen Fläche eines Steines oder Pfahles, aber nie auf flachem Erdboden.« Ungestört wechselt er seinen Sitz bloß dann, wenn er verzweifelt, von ihm aus etwas zu erbeuten. Ist das Glück ihm günstig, so bringt er weitaus den größten Teil des Tages auf derselben Stelle zu. Wenn man ihn geduldig beobachtet, sieht man ihn plötzlich den Hals ausstrecken, sich nach vorn überbeugen, so daß der Schnabel fast senkrecht nach unten gerichtet ist, und plötzlich wie ein Frosch oder richtiger wie ein Pfeil in das Wasser stürzen, ohne daß er dabei die Flügel gebraucht. Gewöhnlich verschwindet er vollkommen unter dem Wasser, arbeitet sich aber durch einige Flügelschläge bald wieder zur Oberfläche empor, schwingt sich von neuem zu seinem Sitze hinauf, schüttelt das Wasser vom Gefieder ab, putzt dieses vielleicht auch ein wenig und nimmt die vorige Stellung ein. Das Fliegen erfordert, wie es scheinen will, alle Kraft und Anstrengung des Vogels; denn die kurzen Schwingen können den schweren Rumpf kaum fortschleppen und müssen so rasch bewegt werden, daß man die einzelnen Bewegungen nicht mehr unterscheiden kann. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb ist der Flug reißend schnell, aber auch sehr einförmig. Der Eisvogel schießt, solange er kann, in einer geraden Linie dahin, immer gleich hoch über dem Wasser hinweg, und dreht und wendet sich nur mit dem Gewässer, entschließt sich wenigstens höchst ungern, den Fluß oder Bach zu verlassen. Weiter als fünf- oder sechshundert Schritte dehnt er einen solchen Flug nicht leicht aus; ungestört fliegt er nie weiter als bis zu dem nächsten Sitzplatze. Manchmal sieht man ihn sich über das Gewässer erheben, plötzlich flatternd oder rüttelnd, sich still halten, sorgsam nach unten schauen und mit einem Male von dieser Höhe aus in die Tiefe stürzen. Derartige Künste, die bei andern Gliedern seiner Familie üblich sind, betreibt er insbesondere über breiten Gewässern, deren Ufer ihm geeignete Warten nicht gewähren.
Die Nahrung besteht vorzugsweise aus kleinen Fischen und Krebsen, nebenbei aber auch aus Kerbtieren, mit denen namentlich die Brut großgefüttert wird. Er ist gefräßig und bedarf zu seiner Sättigung mehr, als man anzunehmen pflegt. Zehn bis zwölf fingerlange Fischchen müssen ihm tagtäglich zum Opfer fallen, wenn den Erfordernissen seines Magens Genüge geschehen soll. Hinsichtlich der Art der Fische zeigt er sich nicht wählerisch, fängt vielmehr jeden, dessen er habhaft werden kann, und weiß selbst eine ziemlich große Beute zu bewältigen. Auf diese lauert er, nach Naumanns Ausdruck, wie die Katze auf die Maus. Er säugt nur mit dem Schnabel, stößt deshalb oft fehl und muß sich zuweilen sehr anstrengen, ehe ihm eine Beute wird. Die Art und Weise seines Fanges erfordert Umsicht in der Wahl seiner Plätze; denn das Wasser, in welchem er fischt, darf nicht zu seicht sein, weil er sich sonst leicht durch die Heftigkeit seines Stoßes beschädigen könnte, darf aber auch nicht zu tief sein, da er sonst seine Beute oft fehlt. Anhaltender Regen, der das Gewässer trübt, bringt dem Eisvogel Not, ja selbst den Untergang, und ebenso wird ihm der Winter nicht selten zum Verderben; denn seine Jagd endet, sobald er die Fische nicht mehr sehen kann. Im Winter muß er sich mit den wenigen offenen Stellen begnügen, die die Eisdecke eines Gewässers enthält; aber er ist dann dem Ungemach ausgesetzt, unter das Eis zu geraten und die Öffnung nicht wieder zu finden. Auf diese Weise verliert mancher Eisvogel sein Leben. Zuweilen wird ihm auch ein glücklicher Fang verderblich; er versucht einen zu großen Fisch hinabzuwürgen und erstickt dabei. Fischgräten, Schuppen und andere harte Teile seiner Nahrung speit er in Gewöllen wieder von sich.
Während der Paarzeit zeigt sich auch der Eisvogel sehr erregt. Er läßt dann seine Stimme, ein hohes, schneidendes, oft und schnell wiederholtes »Tit tit« oder »Si si«, das man sonst selten, meist von dem erzürnten Vogel vernimmt, häufig ertönen und fügt den gewöhnlichen Lauten noch besondere zu, beträgt sich auch in ganz eigentümlicher Weise. »Das Männchen«, sagt mein Vater, »setzt sich dann auf einen Strauch oder Baum, oft sehr hoch, und stößt einen starken, pfeifenden, von dem gewöhnlichen Rufe verschiedenen Ton aus. Auf diesen kommt das Weibchen herbei, neckt das Männchen und fliegt weiter. Das Männchen verfolgt es, setzt sich auf einen andern Baum und schreit von neuem, bis das Weibchen abermals sich nähert. Bei diesem Jagen, das ich nur des Vormittags bemerkt habe, entfernen sich beide zwei- bis dreihundert Schritte vom Wasser und sitzen mit hoch aufgerichtetem Körper auf den Feldbäumen, was sie sonst nie tun. Sobald sich der Eisvogel zu Ende März oder im Anfang April gepaart hat, sucht er sich einen Platz für das Nest aus. Dieser ist allemal ein trockenes, schroffes, vom Grase ganz entblößtes Ufer, an dem keine Wasserratte, kein Wiesel und kein anderes Raubtier hinauf klettern kann. In dieses, einer senkrechten Wand ähnelnde Ufer hacken die Eisvögel dreißig bis sechzig Zentimeter vom oberen Rande ein rundes Loch, das gewöhnlich fünf Zentimeter im Durchmesser hat, einen halben bis einen Meter tief ist, etwas aufwärts steigt und am Ausgang unten zwei Furchen zeigt. Am hinteren Ende erweitert sich dieses Loch zu einer rundlichen, backofenähnlichen Höhle, die acht bis zehn Zentimeter in der Höhe und zehn bis dreizehn Zentimeter in der Breite hat. Diese Höhlung ist unten mit Fischgräten ausgelegt, wie gepflastert, wenig vertieft, trocken und oben glatt wie an ihrem Ausgang. Auf den Fischgräten liegen die sechs bis sieben, sehr großen, fast rundlichen, glänzend weißen, wegen des durchschimmernden Dotters rotgelb aussehenden Eier. Sie sind die schönsten unter allen, die ich kenne, von einer Glätte, von einem Glanze und, ausgeblasen, von einer Weiße wie die schönste Emaille. An Größe kommen sie fast einem Singdrosselei gleich, so daß es mir unbegreiflich ist, wie sie der Eisvogel mit seinen kurzen und harten Federn alle bedecken und erwärmen kann. Merkwürdig ist es, wie fest ein brütender Eisvogel auf seinen Eiern oder seinen nackten Jungen sitzt. Man kann am Ufer pochen, wie man will, er kommt nicht heraus; ja, er bleibt noch ruhig, wenn man anfängt das Loch zu erweitern, und verläßt seine Brut erst dann, wenn man ihm ganz nahe auf den Leib kommt. Das Männchen hat ziemlich fern, hundert bis dreihundert Schritte von dem Nest, seinen Ruheplatz, auf dem es die Nacht und auch einen Teil des Tages zubringt.«
Naumann gibt an, daß man in einzelnen Nestern bis elf Eier findet, und berichtet noch einiges über das Jugendleben der Vögel. »Das Weibchen«, sagt er, »brütet allein, und das Männchen bringt ihm, während jenes fast unausgesetzt vierzehn bis sechzehn Tage lang über den Eiern sitzt, nicht nur Fische zur Nahrung, sondern trägt auch beiläufig dessen Unrat aus dem Neste weg, was beide Gatten nachher auch mit dem der Jungen tun. Die unlängst aus den Eiern geschlüpften Jungen sind häßliche Geschöpfe. Sie sind ganz nackt, mehrere Tage blind und von so ungleicher Größe, daß ich sogenannte Nestküchlein gefunden habe, die kaum halb so groß als die andern waren. Ihr Kopf ist groß, der Schnabel aber noch sehr kurz und der Unterschnabel meistens zwei Linien länger als der Oberkiefer. Sie sind höchst unbeholfen, zittern öfters mit den Köpfen, sperren zuweilen den weiten Rachen auf, wispern leise, wenn sie hungrig sind oder wenn sie gefüttert werden, und kriechen durcheinander wie Gewürme. Zu dieser Zeit werden sie von den Alten mit Kerbtierlarven, und vorzüglich mit Libellen, denen diese zuvor Kopf und Flügel abstoßen, gefüttert. Später bekommen sie auch kleine Fische, und wenn ihnen nach und nach die Federn wachsen, so scheinen sie überall mit blauschwarzen Stacheln bekleidet zu sein, weil die Federn in sehr langen Scheiden stecken und diese nicht so bald aufplatzen. Sie sitzen überhaupt lange im Neste, ehe sie zum Ausfliegen fähig werden, und ihre Ernährung verursacht den Alten viele Mühe, weshalb sie sich denn auch in dieser Zeit ungemein lebhaft und tätig zeigen. Die ausgeflogenen Jungen werden in die ruhigsten Winkel der Ufer, besonders in Gesträuch, Flechtwerk oder zwischen die ausgewaschenen Wurzeln am Ufer stehender Bäume geführt, so daß ein kleiner Umkreis die ganze Familie beherbergt, jeder einzelne also unweit des andern einen solchen Sitz hat, wo er wenigstens von der Uferseite her nicht so leicht gesehen werden kann. Die Alten verraten sie, wenn man sich zufällig naht, durch ängstliches Hin- und Herfliegen in kurzen Räumen und durch klägliches Schreien, während die Jungen sich ganz still und ruhig verhalten. Stößt man sie aus ihrem Schlupfwinkel, so flattert das eine da-, das andere dorthin, und die Alten folgen bald diesem, bald jenem unter kläglichem Schreien. Es währt lange, ehe sie sich Fische fangen lernen.«
Die seit der Veröffentlichung der Mitteilungen meines Vaters und Naumanns gesammelten Beobachtungen haben ergeben, daß die Brutzeit des Eisvogels sich nicht auf die Monate Mai und Juni beschränkt. So erhielt Walter einmal schon am sechsten April, ein anderes Mal in der Mitte dieses Monats vollzählige Gelege. Ebenso können verschiedene Umstände das Fortpflanzungsgeschäft verzögern. Wenn das Frühjahr spät eintritt, wenn die Flüsse oder Bäche längere Zeit Hochwasser haben, wenn die Brut geraubt oder die Nesthöhle zerstört wurde usw., muß der Eisvogel bessere Zeiten abwarten, und so kann es geschehen, daß man noch im September unerwachsene Junge in den Nesthöhlen findet. Nach den eingehenden Beobachtungen Kutters, der binnen drei Jahren nicht weniger als dreißig fast durchgängig besetzte Bruthöhlen untersuchen konnte, ist letzteres nur dann der Fall, wenn die erste Brut vernichtet wurde. Denn ungestört brütet der Eisvogel bloß einmal im Jahre.
Es ist nicht bekannt, daß irgendein Raubtier dem Eisvogel nachstellt. Der erwachsene entgeht durch seine Lebensweise vielen Verfolgungen, denen andere Vögel ausgesetzt sind, und die Nesthöhle ist in seltenen Fällen so angelegt, daß ein Wiesel oder eine Wasserratte zu ihr gelangen kann. Auch der Mensch behelligt unsern Fischer im ganzen wenig, nicht etwa aus Gutmütigkeit oder Tierfreundlichkeit, sondern weil sich der scheue Gesell vor jedermann in acht nimmt und seine Jagd den Sonntagsschützen zu schwer fällt. Der Kundige, der seine Gewohnheiten kennt, erlegt ihn ohne sonderliche Mühe und weiß sich auch des lebenden Vogels zu bemächtigen. Nicht immer gelingt es, das schöne Geschöpf an die Gefangenschaft zu gewöhnen. Jung aus dem Neste genommene Eisvögel lassen sich mit Fleisch und Fischen großfüttern und dann auch längere Zeit am Leben erhalten; alt eingefangene sind ungestüm und ängstlich, verschmähen oft das Futter und flattern sich bald zu Tode. Doch fehlt es auch bei ihnen nicht an Ausnahmen. Mir wenigstens ist es mehr als einmal gelungen, alt eingefangene Vögel einzugewöhnen und lange Zeit am Leben zu erhalten. Ja, ich habe dieselben immer nur durch Unglücksfälle verloren. Ohne alle Umstände gehen alte Eisvögel an das Futter, wenn man sie gleichzeitig mit den Jungen einfängt. Aus Liebe zu diesen vergessen sie den Verlust der Freiheit, fischen von der ersten Stunde an eifrig und gewöhnen sich und ihre Jungen an den Käfig und die ihnen gereichte Kost. An solchen gefangenen nimmt man mit Erstaunen wahr, wie gefräßig sie sind. Hat man sie endlich gezähmt und kann man ihnen einen passenden Aufenthalt gewähren, so sind sie wirklich reizend. Im Tiergarten zu London sind für die Königsfischer und andere Wasservögel besondere Vorkehrungen getroffen worden. Man hat hier einen großen Käfig errichtet, dessen Boden teilweise ein tiefes Wasserbecken ist, und dessen Wandungen alle Bequemlichkeiten bieten, wie Fische sie verlangen. In dem Becken wimmelt es von kleinen Fischen, über demselben sind bequeme Warten; kurz, das Ganze ist so behaglich eingerichtet wie nur möglich. In diesem Käfig befinden sich die dort lebenden Eisvögel vortrefflich. Sie können es hier beinahe wie an ihren Bächen treiben, führen ihre Fischerei wenigstens ganz in derselben Weise aus wie in der Freiheit. Ich darf wohl behaupten, daß mich dieser deutsche Vogel, den ich vor Jahren hier zum ersten Male in der Gefangenschaft sah, damals ebenso angezogen hat wie irgendein anderes Tier der so außerordentlich reichhaltigen Sammlung.
*
Die Stoßfischer ( Ceryle) unterscheiden sich von den Königsfischern hauptsächlich durch den Bau der Flügel und des Schwanzes. Erstere sind bedeutend länger und spitzer als bei den Königsfischern, letzterer ist ziemlich lang und verhältnismäßig breit; die Flugwerkzeuge sind also weit mehr entwickelt als bei jenen. Das Gefieder ist noch dicht und glatt anliegend, aber nicht mehr prächtig gefärbt, ja fast glanzlos, und je nach dem Geschlecht mehr oder weniger verschieden. Die Sippe ist namentlich in Amerika zahlreich vertreten, fehlt aber auch in Afrika und Asien nicht; ein Glied derselben ist wiederholt in Europa vorgekommen und hat deshalb hier Bürgerrecht erlangt. Sie umfaßt die stärksten, gewandtesten und demzufolge auch die raubgierigsten Mitglieder der Familie: die » Fischtiger«, wie wenigstens einige von ihnen Cabanis genannt hat.
Das Mitglied, das uns zunächst angeht, ist der Graufischer ( Ceryle rudis), derselbe, der sich von Ägypten und Syrien aus wiederholt nach Europa verflogen hat. Seine Färbung ist eine sehr bescheidene, das Gefieder der Oberseite schwarz und weiß gescheckt, das der unteren Seite bis auf ein oder zwei schwarze Brustbänder und einige dunkle Flecke auf dem Schnabel reinweiß. Die schwarzen Federn des Ober- und Hinterkopfes zeigen schmale weiße Seitensäume, die des Mantels, der Schultern, des Bürzels und der Flügeldecken breite weiße Endränder. Das Weiß der Kopf- und Halsseiten wird durch einen breiten, schwarzen Streifen unterbrochen. Die Handschwingen und deren Deckfedern sind schwarz, die Armschwingen dagegen weiß und die Schwanzfedern endlich weiß, von dem Endrande durch eine breite schwarze Querbinde und diese wiederum auf der Innenfahne durch einen weißen Randfleck geziert. Das Auge ist dunkelbraun. Die Länge beträgt sechsundzwanzig, die Breite siebenundvierzig, die Fittichlänge dreizehn, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Das Weibchen unterscheidet sich dadurch untrüglich vom Männchen, daß es nur ein schwarzes Brustband besitzt, während jenes deren zwei zeigt.
Ich erinnere mich noch recht wohl der Überraschung, die mir der Graufischer bereitete, als ich kaum den Fuß auf afrikanischen Boden gesetzt hatte. Schon auf dem Mahmudiehkanal, der Alexandrien mit dem Nile verbindet, hatte ich wiederholt einen großen Vogel, nach Art des Turmfalken rüttelnd, in der Luft schweben oder auf den Stangen der Schöpfeimer sitzen sehen, ohne mir erklären zu können, welcher Art derselbe angehören möge. Ein glücklicher Schuß belehrte mich hierüber, und mit wahrem Frohlocken betrachtete ich den erbeuteten Graufischer, der damals in meinen Augen eine große Seltenheit war. Diese Ansicht änderte sich sehr bald; denn die nächstfolgenden Tage schon überzeugten mich, daß der Graufischer, wenn auch nicht zu den häufigsten Vögeln des Landes, so doch zu denen gehört, die man überall und zu jeder Zeit zu sehen bekommt und ohne Mühe in beliebiger Anzahl erlegen kann.
Gewöhnlich sieht man diesen Eisvogel auf den erwähnten Stangen der Schöpfeimer sitzen, seine weiße Brust dem Strome zugekehrt. Steht eine Palme oder Mimose unmittelbar am Nilufer und ist einer ihrer Zweige zum Aufsitzen geeignet, so nimmt er auch hier seinen Stand, und ebensogern läßt er sich auf dem Holzwerke der Schöpfräder nieder, die durch Ochsen bewegt werden und die allen Reisenden wohlbekannte, von allen verwünschte »Nilmusik« hervorbringen. Der Graufischer teilt die Scheu seines zierlichen Vetters nicht. Er fühlt sich sicher in seiner Heimat; denn er weiß, daß er dem Ägypter trauen darf und von ihm nichts zu befürchten hat. Unmittelbar über dem Knaben, der die das Schöpfrad bewegenden Rinder mit der Peitsche antreibt, und buchstäblich im Bereiche der Geisel, sitzt er so ruhig, als ob er von dem gedachten Knaben gezähmt und abgerichtet wäre und in ihm seinen Gebieter und Beschützer zu erblicken habe; neben und über den wasserschöpfenden Weibern fliegt er so dicht vorbei, daß es aussieht, als wolle er diese vom Strome vertreiben. Gegen die Gewohnheit unseres Eisvogels ist er ein umgänglicher Vogel, das heißt wenig futterneidisch, vielmehr sehr gesellig. Das Pärchen hält treuinnig zusammen, und wo der eine sitzt, pflegt auch der andere zu rasten.
Seinen Fischfang betreibt unser Vogel nicht wie der Königsfischer gewöhnlich vom hohen Sitze aus, sondern indem er sich rüttelnd über dem Wasser erhält und aus solcher Höhe sich in dasselbe hinabstürzt. Der Flug ist von dem des Eisvogels gänzlich verschieden. Die Flügel werden zwar auch noch rasch, aber doch nicht »schnurrend« bewegt, und man kann die einzelnen Schläge noch sehr wohl unterscheiden. Demgemäß ist der Flug zwar nicht so reißend wie beim Königsfischer, aber viel gewandter, d. h. größerer Abwechslung fähig. Der Eisvogel schießt dahin wie ein abgeschossener Bolzen, der Graufischer fliegt fast wie ein Falke, schwenkt und wendet sich nach Belieben, hält sich rüttelnd minutenlang fest, zieht eine Strecke weiter, wenn er während seines Stillstehens keine Beute bemerkte, und beginnt dort von neuem zu rütteln. Beim Angriff auf die Beute legt er die Flügel knapp an den Leib und stürzt nun in etwas schiefer Richtung pfeilschnell ins Wasser, verschwindet unter den Wellen und arbeitet sich nach einiger Zeit mit kräftigen Flügelschlägen wieder empor. War er im Fange glücklich, so fliegt er sofort seinem gewöhnlichen Sitzorte zu und verschlingt hier die gemachte Beute, oft erst nachdem er sie wiederholt gegen den Ast geschlagen, wie dies andere seiner Verwandtschaft zu tun pflegen. Wenn er nicht zum Jagen ausfliegt, streicht er mit gleichmäßigem Flügelschlage ziemlich niedrig über dem Wasser weg, möglichst in gerader Linie einem zweiten Sitzorte zu, in dessen Nähe er sich plötzlich aufschwingt. Über Tag ist er gewöhnlich still, gegen Abend wird er lebendiger, zeigt sogar eine gewisse Spiellust, und dann vernimmt man auch oft seine Stimme, einen lauten, schrillenden, oft wiederholten Schrei, den ich mit Buchstaben nicht ausdrücken kann.
Die Brutzeit beginnt in Ägypten, wenn der Nil annähernd seinen tiefsten Stand erreicht hat, also im März oder im April.
Welche Feinde der Graufischer hat, vermag ich nicht zu sagen. Ich habe nie gesehen, daß ein Raubvogel einen Angriff auf ihn versucht hätte, und kenne kein anderes Raubtier, das ihm gefährlich werden könnte.
*
Die Lieste ( Halcyoninae) unterscheiden sich von den Eisvögeln durch die mehr entwickelten, bei einzelnen sogar sehr ausgebildeten Flugwerkzeuge. Auch ist der Schnabel, der dem der Eisvögel im ganzen ähnelt, regelmäßig viel breiter als bei jenen, und ebenso pflegen die Füße stärker und hochläufiger zu sein. Das Gefieder ist lockerer und besitzt nicht die fette Glätte wie das der Eisvögel, prangt übrigens ebenfalls in lebhaften Farben; einzelne Arten gehören zu den prächtigsten aller Vögel.
Afrika, Südasien und Australien nebst den zwischen diesen beiden Erdteilen gelegenen Eilanden sind die Heimat der zahl- und gestaltenreichen Gruppe. In Amerika und Europa fehlen sie gänzlich. Sie sind mehr oder weniger Waldvögel, und nur die wenigsten bekunden eine Vorliebe für das Wasser. Einzelne sollen zwar mehr oder weniger nach Art der Eisvögel fischen; die Mehrzahl aber kommt hinsichtlich der Lebensweise eher mit den Bartvögeln überein. Viele Arten haben sich vom Wasser gänzlich unabhängig gemacht und beleben die trockensten Gegenden, vorausgesetzt, daß sie nicht baumlos sind; denn Bäume scheinen zu ihrem Wohlbefinden unumgänglich notwendig zu sein.
Die Riesenlieste ( Paralcyon) kennzeichnen sich nicht bloß durch ihre bedeutende Größe, sondern auch durch den großen, langen und dicken Schnabel, der an der Wurzel breit und flach gedrückt, längs der Firste gerade, an der Spitze seitlich zusammengedrückt und schwachhakig über den Unterkiefer herabgebogen ist, die kurzläufigen, aber verhältnismäßig starken Füße, mit langen und ziemlich dicken Zehen, die mittellangen und stumpfspitzigen Flügel, in denen die dritte Schwinge die längste, die zweite aber nur wenig kürzer als diese ist, und den mittellangen und breiten Schwanz. Das Gefieder ist reich, locker anliegend und seine Färbung eine ziemlich unscheinbare.
Unter den Mitgliedern dieser Sippe, die ausschließlich dem Festlande Neuhollands angehört, ist der Jägerliest oder Riesenfischer ( Paralcyon gigas) das bekannteste; denn dieser Vogel stellt sich nicht bloß jedem Europäer, der Australien betritt, persönlich vor, sondern ist auch, und namentlich in der neueren Zeit, so oft nach Europa gekommen, daß er gegenwärtig keiner größeren Tiersammlung fehlt. Kopf, Hals und alle Unterteile sind weiß, schmutzig rostfahl verwaschen, Stirne und Vorderkopf schmal dunkelbraun. Die rotbraunen oberen Schwanzdecken und Schwanzfedern sind mit breiten, schwarzen Querbinden, die rötlichen Steuerfedern mit breiten, weißen Endsäumen geziert. Die Iris ist tiefbraun, der Oberschnabel schwarz, der untere blaßgelb, der Fuß dunkelbraun. Die Länge beträgt fünfundvierzig bis siebenundvierzig, die Breite fünfundsechzig, die Fittichlänge einundzwanzig, die Schwanzlänge sechzehn Zentimeter.
Der Jägerliest findet sich, nach Gould, nicht in Vandiemensland oder in Westaustralien, sondern scheint allein dem Südosten Neuhollands, den Landstrichen zwischen dem Spensergolf und der Moretonbucht anzugehören. Er bindet sich keineswegs an eine bestimmte Örtlichkeit, sondern besucht eine jede; jene üppigen Büsche längs der Küste wie den dünn bestandenen Wald der Höhe. Aber nirgends ist er häufig zu nennen. Er findet sich überall, allerorten jedoch nur einzeln. Seine Nahrung ist gemischter Art, allein immer dem Tierreiche entlehnt. Kriech- und Kerbtiere sowie Krabben scheinen bevorzugt zu werden. Er stürzt sich mit Hast auf Eidechsen, und gar nicht selten sieht man ihn mit einer Schlange im Schnabel seinem Sitzplatze zufliegen. »Einmal«, sagt der ›alte Buschmann‹, »sah ich ein Paar lachende Hänse auf dem abgestorbenen Aste eines alten, grauen Baumes sitzen und von hier aus von Zeit zu Zeit nach dem Boden herabstoßen. Sie hatten, wie sich bei genauerer Untersuchung ergab, eine Teppichschlange getötet und bewiesen durch ihr Geschwätz und Gelächter lebhafte Freude darüber. Ob sie übrigens Schlangen fressen, vermag ich nicht zu sagen; denn die einzigen Kriechtiere, die ich je in ihrem Magen gefunden habe, waren kleine Eidechsen.« Übrigens raubt der Jägerliest auch kleine Säugetiere; Gould schoß einst einen Vogel dieser Art, bloß um zu sehen, was er im Schnabel trüge, und fand, daß er eine seltene Beutelratte erjagt hatte. Daß er junge Vögel nicht verschont und namentlich den Nestern gefährlich werden mag, läßt sich erwarten. Wasser scheint nicht zu den Bedürfnissen des Jägerliests zu gehören; den freilebenden Vogel findet man, wie bemerkt, selbst in den trockensten Waldungen, und auch die gefangenen zeigen weder des Trinkens noch des Badens halber besonderes Verlangen nach diesem Elemente.
Die Brutzeit fällt in die Monate August und September. Das Paar sucht sich dann eine passende Höhlung in einem großen Gummibaume aus und legt hier seine wundervollen perlweißen Eier auf den Mulm in der Tiefe dieser Höhle. Wenn die Jungen ausgeschlüpft sind, verteidigen die Alten den Brutplatz mutig und furchtlos, und den, der die Brut rauben will, greifen sie sogar tätlich an und versetzen ihm nicht ungefährliche Bisse.

Jägerliest (Paralcyon gigas)
Die gefangenen Lieste gehören nicht zu den anspruchsvollen Tieren, begnügen sich vielmehr mit sehr einfacher Nahrung, mit grob geschnittenen Fleischstückchen, Mäusen und Fischen nämlich, und verschmerzen vielleicht schon deshalb den Verlust ihrer Freiheit. Gibt man ihnen einen geräumigen Käfig, so gewinnen sie bald ihre ganze Heiterkeit wieder und betragen sich genau ebenso wie in ihrem heimatlichen Lande. Gewöhnlich sitzen sie ruhig auf dem passendsten Platze, wenn sie paarweise gehalten werden, dicht nebeneinander. Der Hals wird dabei so eingezogen, daß der Kopf unmittelbar auf den Schultern liegt, das Gefieder lässig getragen. Zur Abwechslung sträubt einer oder der andere das Kopfgefieder so, daß der Kopf fast noch einmal so groß erscheint als sonst und einen sehr ernsthaften Ausdruck gewinnt; zuweilen wird auch mit dem Schwanze gewippt. Dieser Bewegungen ungeachtet erscheint der Riesenfischer träge, verdrossen und schläfrig; aber er erscheint auch nur so. Wer wissen will, wes Geistes Kind er vor sich hat, muß das unruhig sich bewegende, listig blitzende Auge beobachten; er wird dann wenigstens zu der Überzeugung gelangen, daß der Vogel seine Umgebung fortwährend beachtet und alles, was vorgeht, bemerkt.
Wie sehr die Jägerlieste nach Tieren mit Haut, Federn, Schuppen oder Haaren verlangen, erkennt man, sobald man ihnen solche, wenn auch nur von fern, zeigt. Anscheinend ohne Widerstreben begnügen sie sich mit den ihnen sonst gereichten Fleischbrocken und lassen äußerlich keinen Mangel erkennen; sobald sie aber eines der bezeichneten Tiere erblicken, verändert sich ihr ganzes Wesen. Das Kopfgefieder sträubt sich, die Augen leuchten heller, und der Schwanz wird mehrmals nacheinander kräftig gewippt; dann stürzt sich der Riesenliest eiligst auf die willkommene Beute und gibt, sobald er sie gepackt hat, durch lautes Schreien, in das der Genosse regelmäßig einzustimmen pflegt, seiner Freude Ausdruck. Erheiternd in hohem Grade ist das Schauspiel, das man sich bereiten kann, wenn man den Vögeln eine größere lebende Schlange bietet. Ohne Besinnen überfällt der Riesenfischer auch diese; mit derselben Gier wie eine Katze die Maus packt er sie, und ebenso wie mit jener verfährt er, um sie zu töten. Doch die Zählebigkeit des Opfers bereitet ihm Schwierigkeiten, und das jubelnde Gelächter wird jetzt gleichsam zum Schlachtgesange. Früher oder später überwältigt er sein Opfer aber dennoch und verzehrt es, wenn nicht im ganzen, so doch stückweise. Obgleich ich nicht imstande bin, dafür den Beweis zu führen, zweifle ich doch nicht im geringsten, daß er mit kleineren giftigen Schlangen ebensowenig Umstände machen wird wie mit giftlosen. Als beachtenswert erwähne ich noch, daß der Vogel Fische in der Regel gänzlich verschmäht. Er ist ein Jäger des Waldes, nicht aber ein Fischer wie seine wasserkundigen Familienverwandten.
*
Die Plattschnäbler ( Todidae) gehören wegen ihrer Schnabelbildung zu den auffallendsten Vögeln, die man kennt. Sie sind klein und zierlich gestaltet, flachschnäbelig, kurzflügelig und kurzschwänzig. Das Gefieder, das bei beiden Geschlechtern in gleicher Schönheit prangt, besteht aus weichen, glatt anliegenden Federn; am Schnabelgrunde stehen Borsten.

Grüntodi (Todus viridis)
Der Todi oder Grünplattschnabel ( Todus viridis), zeigt auf allen oberen Teilen einschließlich der Kopf- und Halsseiten, des Schwanzes sowie der Außenfahne der schwarzen Schwingen eine prachtvoll glänzende grasgrüne Färbung und am unteren Augenrande einen sehr schmalen, roten Saum. Die Kinn- und Kehlfedern sind lebhaft karminrot, an der Spitze aber äußerst schmal silberweiß, einige Federn an den Bauchseiten endlich, die einen Büschel bilden, an der Spitze zart rosenrot gefärbt. Die Länge beträgt 12, die Breite 17, die Fittichlänge 4,5, die Schwanzlänge 3,8 Zentimeter. Das Wohngebiet beschränkt sich auf die Insel Jamaika.
Auf der Insel Kuba wird vorstehend beschriebene Art durch den Bunttodi ( Todus multicolor) vertreten. Der Vogel stimmt in Größe und Färbung im wesentlichen mit dem Grünplattschnabel überein, unterscheidet sich aber von ihm durch einen deutlich blauen Halsseitenfleck.
»In allen Teilen von Jamaika, die ich bereist habe«, sagt Gosse, »ist der Grünplattschnabel ein sehr gemeiner Vogel. Auf dem Gipfel der Bluefieldberge, in einer Höhe von ungefähr tausend Meter über dem Meere und vorzugsweise da, wo ein fast undurchdringliches Dickicht den Boden deckt, findet er sich überall. Sein glänzendes, grasgrünes Gewand und die rotsamtene Kehle lenken bald die Aufmerksamkeit ihm zu, und er gestattet jedermann, sich ihm zu nähern; denn er ist ein außerordentlich kirrer Vogel, wie es scheint, mehr aus Gleichgültigkeit als infolge großer Vertrauensseligkeit. Wenn er aufgescheucht wird, fliegt er höchstens nach dem nächsten Zweige. Sehr häufig haben wir ihn mit unserm Kerbtiernetze gefangen oder mit einer Gerte zu Boden geschlagen; ja, gar nicht selten ergreifen ihn die Knaben mit der Hand. Wegen dieser Zutraulichkeit ist er allgemein beliebt und hat eine Menge Schmeichelnamen erhalten.
Niemals habe ich den Plattschnabel auf dem Boden gesehen. Er hüpft zwischen den Zweigen und Blättern, sucht hier nach kleinen Kerbtieren und stößt gelegentlich seinen klagenden oder zischenden Lockruf aus. Häufiger noch gewahrt man ihn, ruhig auf einem Zweige sitzend, den Kopf eingezogen, den Schnabel nach oben gerichtet und das Gefieder gesträubt, so daß er viel größer erscheint, als er wirklich ist. Dann sieht er herzlich dumm aus; aber es scheint mehr so, als es der Fall ist; denn wenn man ihn näher betrachtet, bemerkt man bald, daß die hellglänzenden Augen sich bald hier-, bald dorthin richten, und daß der Vogel dann und wann zu einem kurzen Fluge sich erhebt, etwas aus der Luft wegschnappt und wieder auf seinen Zweig zurückkehrt, um das Gefangene dort zu verschlingen. Er hat nicht die Kraft, Kerbtieren zu folgen; aber er wartet, bis dieselben innerhalb eines bestimmten Umkreises sich zeigen, und fängt sie dann mit Sicherheit weg. Niemals habe ich gesehen, daß ein Plattschnabel Pflanzennahrung zu sich genommen hätte, obwohl ich zuweilen kleine Sämereien unter Käfern und Hautflüglern in seinem Magen gefunden habe. Einer, den ich im Käfig hielt, schnappte mit unkluger Gier Würmer weg, schlug dieselben heftig gegen seine Sitzstangen, um sie zu zerteilen, und verschlang sie dann; ein anderer, den ich im Netze gefangen und in dem Räume freigelassen hatte, begann sofort auf Fliegen und andere kleine Kerbtiere Jagd zu machen und betrieb diese, mit ebensoviel Ausdauer als Erfolg, vom frühen Morgen an bis zum Dunkelwerden. Von der Ecke des Tisches, von quer gespannten Leinen oder Gesimsen aus flog er dann und wann in die Luft und kehrte, nachdem das Schnappen seines Schnabels einen Fang angezeigt hatte, wieder auf denselben Standort zurück. Er guckte in alle Ecken und Winkel, selbst unter die Tische, in der Absicht, hier die kleinen Spinnen aus ihren Netzen herauszufangen. Dieselbe Beute suchte er auch von der Decke und von den Wänden ab und fand immer etwas. Meiner Schätzung nach gewann er in jeder Minute einen Fang; man kann sich also einen Begriff machen von der außerordentlichen Zahl an Kerbtieren, die er vertilgt. In dem Raume, den er bewohnte, stand Wasser in einem Becken; aber ich habe ihn, obschon er sich zuweilen auf den Rand seines Gefäßes setzte, nie trinken sehen; dies tat er selbst dann nicht, wenn er seinen Schnabel in das Wasser steckte. So eifrig er sich seinen eigenen Geschäften hingab, so wenig bekümmerte er sich um unsere Gegenwart; zuweilen setzte er sich uns freiwillig auf Kopf, Schulter oder Finger, und wenn er einmal saß, gestattete er, daß man die andere Hand über ihn deckte und ihn wegnahm, obschon ihm das unangenehm zu sein schien; denn er sträubte und bemühte sich, wieder frei zu werden. Die Gefangenschaft schien er leicht zu ertragen, aber leider ging er durch einen unglücklichen Zufall zugrunde.«
Der Bunttodi lebt, laut Gundlach, in Waldungen und Gebüschen, besonders an abhängigen Stellen. An solchen Orten ist er sehr gemein, wenn er ruhig sitzt, jedoch nicht immer leicht zu entdecken, falls man nicht auf die Stimme achtet und, ihr nachgehend, den Vogel aufsucht. Diese Stimme, die Anlaß zu dem wissenschaftlichen Namen gab, lautet wie »Tototo«; außerdem aber vernimmt man, wenn das Vögelchen von einem Zweige zum andern fliegt, noch ein eigentümliches, wohl durch den Flug hervorgebrachtes Geräusch, das Ähnlichkeit mit einer Blähung hat und dem Todi seinen Namen »Pedorrera« verschafft hat. Niemals hüpft der niedliche Gesell nach Art eines Singvogels, sondern stets sitzt er mit aufgerichtetem Schnabel und späht nach Kerbtieren umher, die er dann im Fluge erhascht. Er ist nicht im geringsten scheu; man kann daher bis auf eine kurze Entfernung sich ihm nähern und ihn selbst mit dem Schmetterlingsnetz fangen. Niemals ändert er seine Stellung, und immer setzt er sich auf ein wagerechtes Zweiglein oder auf eine Schlingpflanze, läßt die Seitenfedern gleichsam als Stütze für die Flügel hervortreten und nickt zuweilen mit dem Kopfe. In der Lebensweise werden die absonderlichen Verwandtschaften des Vogels deutlich. Wie ein Schnäpper fängt er die Fliegen weg, und wie ein Eisvogel nistet er in Erdlöchern. Im kleinen Käfig kann man ihn nicht halten, wohl aber in einem größeren Gebauer, den man mit grünen Bäumchen ausgeschmückt hat. Aber auch hier bleibt er nur kurze Zeit am Leben.
Hill hatte Gelegenheit, das Brutgeschäft mit aller Gemächlichkeit zu beobachten. Ein Paar Todis hatten sich einen sonderbaren Ort zum Nisten ausgesucht, eine Kiste nämlich, die zur Zucht von Blumen benutzt und mit Erde gefüllt worden war. Ein Astloch in der Wand dieser Kiste mochte die Wahl bestimmt haben, denn dieses Loch diente als Eingang zu der Höhle, die im Innern der Kiste, das heißt in der sie füllenden Erde, ausgegraben wurde. Obgleich die Vögel die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten und oft gestört wurden, trieben sie doch ihr Brutgeschäft ganz unbekümmert und zogen glücklich die Familie groß. Sie schienen sich möglichst zu bemühen, dem Menschen den Ort ihres Nestes nicht zu verraten, und benutzten beim Aus- oder Einschlüpfen immer einen Augenblick, in dem die Aufmerksamkeit der Besucher durch irgend etwas von ihnen abgelenkt worden war. Als die Familie ausgeflogen war, untersuchte man die Kiste näher und fand in der Erde einen vielfach gewundenen Gang, der bis zur Mitte führte und hier in die Nistkammer mündete.
Zu den Prachtvögeln der Alten Welt zählen die Bienenfresser ( Meropidae), ebenso eigenartig gestaltete wie schön gefärbte und in ihrem Tun und Treiben ansprechende Mitglieder der Ordnung. Mit Ausnahme dreier Arten, die eine besondere Unterfamilie bilden, stimmen alle Bienenfresser, etwas über dreißig an der Zahl, unter sich so wesentlich überein, daß das von einem Gesagte mit wenig Abänderungen auch für die andern Gültigkeit hat. Ihr Leib ist sehr gestreckt, der Schnabel länger als der Kopf, an der Wurzel ziemlich stark, spitzig, oben und unten sanft gebogen, scharfrückig und scharfschneidig, mit kaum eingezogenen Rändern und etwas längerem, aber nicht übergekrümmtem Oberschnabel, ohne Kerbe vor der Spitze. Die Füße sind sehr klein und kurz. Die Flügel sind lang und spitzig; unter den Schwingen ist die zweite die längste. Der Schwanz ist lang, entweder gerade abgeschnitten oder mehr oder weniger gegabelt oder auch sanft abgerundet. Das Gefieder ist kurz und etwas derb, seine Färbung fast ausnahmslos eine sehr prachtvolle und bunte.

Mittelländischer Bienenfresser (Merops apiaster)
Die warmen Länder der Alten Welt sind die eigentliche Heimat der Bienenfresser; nur eine einzige Art kommt in Neuholland vor. Sie bewohnen sehr verschiedene Örtlichkeiten, niemals aber solche, denen Bäume gänzlich mangeln. Von der Küste des Meeres an trifft man sie bis zu einem Höhengürtel von zweitausend Meter über dem Meere, und es scheint nicht, als ob einzelne Arten die Tiefe, andere die Höhe bevorzugen. Die im Norden lebenden Bienenfresser ziehen regelmäßig, die südlichen sind Stand- oder Strichvogel. Schon in Ägypten lebt eine Art, die jahraus, jahrein an derselben Stelle verweilt und jährlich zweimal Verwandte über sich wegziehen sieht, ohne vom Wanderdrange ergriffen zu werden; die im Innern Afrikas wohnenden Arten dagegen streichen den Jahreszeiten entsprechend; sie erscheinen an ihren Brutplätzen mit Beginn der Regenzeit und verlassen die Heimat wieder, wenn die winterliche Dürre eintritt. Alle Arten ohne Ausnahme sind höchst gesellige und ungemein friedliche Vögel. Einzelne scharen sich nicht bloß mit ihresgleichen, sondern auch mit verwandten Arten, namentlich während ihrer Reisen. Sie bilden dann gemeinschaftlich Flüge und vermengen sich so vollkommen untereinander, daß man die verschiedenen Arten nicht unterscheiden kann. Auch besondere Gelegenheiten vereinigen oft verschiedenartige Bienenfresser auf längere Zeit. Es ist unmöglich, Bienenfresser zu übersehen. Sie verstehen es, eine Gegend zu beleben. Kaum kann es etwas Schöneres geben als diese, bald nach Art eines Falken, bald nach Art der Schwalben dahinstreichenden Vögel. Sie fesseln unter allen Umständen das Auge, gleichviel, ob sie sich bewegen oder, von dem anmutigen Fluge ausruhend, auf Zweigen und auf dem Boden sitzen. In letzterem Falle, oder wenn sie unter dem Beobachter auf- und niederstreichen, kommt die volle Pracht ihres Gefieders zur Geltung. Wenn sie, wie es zuweilen geschieht, zu Hunderten oder Tausenden auf einzelnen Bäumen oder Gebüschen oder auf dem Boden dicht nebeneinander sich niederlassen, schmücken sie solchen Ruheplatz in unbeschreiblicher Weise. Am meisten fesselt doch immer und immer wieder ihr köstlicher Flug. Ebenso ruhig als stetig, ebenso leicht als zierlich trägt er den Bienenfresser scheinbar ohne alle Anstrengung durch jede beliebige Luftschicht. Im Nu stürzt sich einer von ihnen aus bedeutender Höhe senkrecht zum Boden herab, um ein vorüberfliegendes Kerbtier, das sein ungemein scharfes Auge wahrgenommen, zu fangen; binnen weniger Augenblicke hat er seine frühere Höhe wieder erreicht und fliegt mit den übrigen unter lautem, oft wiederholtem »Guep guep«, dem allen Arten gemeinsamen Lockrufe, weiter. Auf einige Flügelschläge folgt ein Dahingleiten mit halb ausgebreiteten, halb angezogenen Schwingen, das aber mit so großer Schnelligkeit geschieht, daß der Vogel wie ein Pfeil erscheint. Nicht minder anziehend sind diese liebenswürdigen Geschöpfe da, wo sie sich bleibend angesiedelt haben und in größter Nähe betrachten lassen. Pärchenweise sieht man sie auf den hervorragenden niederen Ästen sitzen. Der eine Gatte ruft dem andern von Zeit zu Zeit zärtlich zu; dann erhebt sich dieser zu einem kurzen, raschen Fluge und nimmt ein vorüberfliegendes Kerbtier auf. Während er dem Raube nachfliegt, bleibt jener ruhig sitzen und wartet auf sein Zurückkommen. Ich habe nie gesehen, daß zwei Bienenfresser um eine Beute gestritten hätten, niemals beobachtet, daß unter ihnen Kampf aus irgendeiner Ursache entstanden wäre. Friede und Verträglichkeit herrscht unter allen Umständen unter ihnen, ihr Verein mag so zahlreich sein, wie er sein kann.
Die Nahrung besteht ausschließlich in Kerbtieren, die in der Regel im Fluge gefangen, ausnahmsweise aber auch von leicht zugänglichen Blättern oder selbst vom Boden aufgenommen werden. Merkwürdig ist, daß die Bienenfresser giftstachelige Kerfe verzehren. Versuche, die angestellt wurden, haben zur Genüge bewiesen, daß der Stich einer Biene oder Wespe den meisten Vögeln tödlich ist; genaue Beobachtungen ergaben, daß fast alle Vögel, die derartige Kerbtiere fangen, ihnen vor dem Verzehren den Giftstachel abbeißen; die Bienenfresser hingegen schlingen ohne jegliche Vorbereitung die gefährliche Beute hinab.
Alle Bienenfresser nisten gesellig, und zwar in tiefen, wagerecht in steil abfallende Erdflächen gegrabenen Höhlen. Alle Arten lieben auch während ihres Brutgeschäftes die Gesellschaft ihresgleichen, und deshalb sind die Brutstellen fast ausnahmslos sehr zahlreich besuchte Siedelungen. Der eigentliche Nestplatz ist ein backofenförmig erweiterter Raum am hinteren Ende des Ganges. Ein wirkliches Nest wird nicht erbaut, das aus vier bis sieben reinweißen Eiern bestehende Gelege vielmehr auf den bloßen Sand niedergelegt. Erst nach und nach sammelt sich von den abgebissenen Flügeln der Kerbtiere oder von den ausgespieenen Gewöllen eine Art von Unterlage, sozusagen ein Sitzpolster für die Jungen, an.
*
In Europa lebt als regelmäßiger Sommergast nur eine Art der Familie, der mittelländische Bienenfresser ( Merops apiaster). Er gehört zu den größeren Arten seiner Familie. Die Länge beträgt sechsundzwanzig, die Breite fünfundvierzig, die Fittichlänge vierzehn, die Schwanzlänge zehn bis elf Zentimeter. Das Gefieder ist auf der Stirne weiß, auf dem Vorderkopfe und einem Streifen durch das Auge meerblau mit grünem Scheine, Kinn und Kehle bilden ein hochgelbes, unterseits von einer schmalen Querbinde begrenztes Feld; Ober- und Hinterkopf sind dunkel kastanienbraun, Hinterhals und Flügeldecken heller; Schultern und vordere Mantelgegend nebst dem Bürzel gehen ins Zimmetrostgelbe über. Die Unterseite prangt in schönem Meerblau. Das Auge ist prachtvoll karminrot, der Schnabel schwarz, der Fuß rötlich.
Mit vollstem Rechte wird der Bienenfresser zu den deutschen Vögeln gezählt, da er sich nicht bloß mehrfach in Deutschland gezeigt, sondern auch schon hier gebrütet hat. Allerdings ist sein Vorkommen kein regelmäßiges, aber doch auch nicht gerade ein seltenes, und namentlich in den südöstlichsten Teilen Deutschlands wird der auffallende und leicht kenntliche Vogel sehr oft bemerkt. Von seinem Erscheinen in Gegenden, die weit nördlich seines Verbreitungskreises liegen, haben wir wiederholt Kunde erhalten. Man hat ihn nicht bloß in Mittel- und Norddeutschland, sondern auch in Dänemark, in Schweden, ja selbst in Finnland wahrgenommen.
Viel seltener geschieht es, daß das eine oder andere Pärchen nördlich der Pyrenäen und Alpen zum Brüten schreitet; doch sind auch derartige Fälle beobachtet worden. So hat man Bienenfresser wiederholt an der Donau oberhalb Wien, im Jahre 1792 an der Ohlau in Schlesien und neuerdings in Baden brütend gefunden. Über den letzterwähnten Fall danken wir dem Freiherrn von Schilling, dessen an Ort und Stelle eingezogene Erkundigungen ein ziemlich klares Bild der Einwanderung geben, eingehenden Bericht. Diesem zufolge erschienen vor einigen Jahren, Ende Mai etwa, fünfzig Stück in dem Kaiserstuhlgebirge und siedelten sich unmittelbar hinter dem Dorfe Birkensohl, in einem fruchtbaren Tälchen mit südlicher Richtung, bleibend an, nisteten auch in der jähen Wandung eines verlassenen Doleritbruches. Aber sämtliche Eier wurden durch Unbefugte zerstört, die Ansiedler überhaupt in einer so unwirtlichen, um nicht zu sagen gehässigen Weise behandelt, daß schon Mitte Juli keine einzige der »afrikanischen Schwalben« zu sehen war. Bauern, die einzelne von ihnen erlegt hatten, verkauften dieselben, zu fünf Franken das Stück, nach Kolmar und nach Neubreisach, und der hohe Preis reizte die Begierde der ohnehin mordsüchtigen Aasjäger so, daß ihnen nicht einmal der Gedanke an Schonung gekommen sein mag. Nicht viel anders als in diesem Fall ergeht es dem Bienenfresser wohl überall im gesegneten Deutschland, und dies dürfte einer der Hauptgründe sein, daß er bis jetzt noch nicht zum regelmäßig wiederkehrenden Sommer- und Brutvogel geworden ist. Als solchen trifft man ihn erst im südlichen Europa an. In Spanien, in Italien, Griechenland und auf allen Inseln des Mittelmeeres, in der Türkei, in Ungarn und Südrußland gehört er, stellenweise wenigstens, zu den gemeinsten Vögeln. Aber er bewohnt nicht bloß Europa, sondern verbreitet sich noch weit über Asien. In Palästina, Kleinasien und Persien ist er ebenso häufig wie in Südeuropa. In den Steppen Nordturkestans begegneten wir, in denen des südlichen Turkestan Sewerzow und andere Forscher ihm, wenn auch nicht eben oft. In den Gebirgen Kaschmirs sah ihn Adams in großer Anzahl; auch in China ist er seßhaft. Gelegentlich seines Zuges scheint er halb Asien und ganz Afrika zu durchstreifen. In Indien wird er während des Winters an geeigneten Orten überall beobachtet; in Afrika sah ich ihn mit größter Regelmäßigkeit gelegentlich seiner Wanderungen; er erschien, von Europa kommend, Anfang September und zog bis Mitte Oktober über uns dahin; der Rückzug begann Anfang April und währte bis zur Hälfte des Mai.
Auf seinem Brutplatz erscheint der Bienenfresser flugweise Ausgang April oder Anfang Mai. Mitte Mai haben sich die Flüge einigermaßen zerteilt; doch kommt es ebenso oft vor, daß mehrere sich vereinigen und gemeinschaftlich eine Siedelung bilden, die fünfzig, sechzig und mehr Paare zählen kann. Das eine wie das andere hängt von der Örtlichkeit ab. Findet sich eine höhere, senkrecht abfallende Erdwand, die Raum zur Anlage für viele Nester bietet, so vereinigen sich die Bienenfresser; ist dies nicht der Fall, so sucht sich jeder einzelne so gut zu behelfen, wie es eben geht.
In der Nähe der Siedelung zeigt sich nun das gewöhnliche Sommerleben unseres Vogels. Während alle kleineren Arten der Familie nur ausnahmsweise ihre Warten auf längere Zeit verlassen, sieht man bei gutem Wetter, insbesondere in den Morgen- und Abendstunden, alle Mitglieder eines Verbandes dieser Art in hoher Luft stundenlang umherschwärmen. Der Flug bleibt in Verbindung, kann aber nicht als ein geschlossener bezeichnet werden; denn die einzelnen Vögel verteilen sich über einen weiten Raum, halten nur aufmerksam eine und dieselbe Richtung ein und rufen sich beständig zu. In dieser Weise durchmessen sie mehrere Geviertkilometer, immer gemeinschaftlich. Sie rufen sich auch während der ganzen Jagd durch ihren beständig wiederholten Lockton, das hell klingende »Schürr schürr« oder »Guep guep«, zusammen. Gegen Sonnenuntergang erscheinen alle in der Nähe der Siedelung, verteilen sich hier in Paare und fangen nun bis zum Eintritt der Dämmerung noch Kerbtiere von den Ästen aus. Ihre Nachtruhe verbringen sie, sobald die Nisthöhlen fertig sind, wohl ausschließlich in diesen, bis dahin aber dicht gedrängt auf den Ästen niedriger Gebüsche, die sie zuweilen in so namhafter Menge anfüllen, daß man Dutzende von ihnen mit einem einzigen Schusse erlegen kann. Nachdem die Jungen ausgeflogen sind, vereinen sich noch viel bedeutendere Scharen, und wenn sich solche, wie zuweilen geschieht, auf sandigem Boden niederlassen, verwandeln sie diese Strecke gleichsam in eine blühende Wiese. Ihre Jagd betreiben sie auf Heiden oder ähnlichen Örtlichkeiten lieber als irgendwo anders, und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil diese die meisten Bienen herbeiziehen und sie dort die meiste Beute gewinnen. In die Nähe der Ortschaften kommen sie, solange die Witterung gut ist, selten oder nie. Verändert sich das Wetter, so verändern auch sie die Art und Weise ihrer Jagd. Sobald der Himmel umzogen ist, oder wenn Regen fällt, erheben sie sich nicht in die höheren Luftschichten, wie Schwalben und noch mehr die Segler zu tun pflegen, sondern jagen von den Ästen aus, erscheinen auch gern in unmittelbarer Nähe menschlicher Wohnungen und brandschatzen die Bienenkörbe in empfindlicher Weise. Man sieht sie unter solchen Umständen auf einem passenden Zweige des nächsten Baumes oder auf dem Flugbrettchen des Stockes selbst sitzen und die ausgehenden Bienen wegschnappen.
Stechende Kerbtiere scheinen das Lieblingsfutter des Bienenfressers zu sein; denn ebenso wie er die Bienenstöcke brandschatzt, plündert er die Nester der Wespen, Hummeln und Hornissen. Man hat beobachtet, daß er sich möglichst nahe bei einem Wespenneste niederläßt und im Verlaufe weniger Stunden nach und nach alle fliegenden Bewohner dieses Nestes wegschnappt. Doch verschmäht er auch Heuschrecken, Zikaden, Libellen, Mücken, Fliegen und Käfer nicht, liest letztere sogar von den Gebüschen oder Blumen ab, obwohl er in der Regel nur auf fliegende Beute jagt und jedes vorübersummende Kerbtier, dessen er ansichtig wird, aufnimmt, vorausgesetzt, daß er dasselbe verschlingen kann. Die unverdaulichen Flügeldecken und andere harte Teile der Beute werden, zu Gewöllen geformt, wieder ausgeworfen.
Ende Mai beginnt das Brutgeschäft. Zur Anlage seines Nestes wählt sich der Bienenfresser am liebsten das sandige oder lehmige Ufer eines Flusses. Hier beginnt er ein rundes Loch von fünf bis sechs Zentimeter im Durchmesser auszuhöhlen, wahrscheinlich mit Schnabel und Klauen zugleich, möglicherweise auch mit dem Schnabel allein. Dieses Loch führt wagerecht oder in wenig aufsteigender Richtung weiter und bildet somit eine Höhle, die ein bis zwei Meter tief sein kann. Das Ende des Ganges wird zu einer Kammer von zwanzig bis fünfundzwanzig Zentimeter Länge, zehn bis fünfzehn Zentimeter Breite und acht bis zehn Zentimeter Höhe erweitert, auf deren Boden dann das Weibchen im Juni seine fünf bis acht runden, glänzend weißen Eier niedergelegt. Zuweilen wird, laut Salvin, noch eine zweite Nistkammer hinter der ersten ausgewölbt und mit dieser durch einen etwa dreißig Zentimeter langen Gang verbunden. Fehlt es einer Gegend an senkrecht abfallenden Erdwänden, so entschließt sich der Bienenfresser wohl oder übel, schräge Gänge in den flachen Boden einzugraben. Ob das Weibchen allein brütet, oder ob es vom Männchen abgelöst wird, konnte bisher noch nicht festgestellt werden; man weiß bloß, daß sich beide Eltern in das Geschäft der Aufzucht teilen und fleißig Nahrung zutragen. Schon Ende Juni sieht man Junge mit den Alten umherfliegen und letztere jene füttern. Wenige Wochen später benehmen sich die Jungen ganz wie die Alten, und zur Zeit der Abreise unterscheiden sie sich, soweit es das Betragen angeht, nicht im geringsten von diesen.
Es ist erklärlich, daß der Bienenfresser nicht überall mit günstigem Auge angesehen wird. Die Räubereien, die er sich zuschulden kommen läßt, erregen den Zorn der Bienenzüchter und ziehen ihm rücksichtslose Verfolgung zu. Der Bienenfresser zeigt sich selten scheu, und am wenigsten in der Nähe Beute versprechender Örtlichkeit, läßt sich hier selbst durch Schießen so leicht nicht vertreiben. Erst wiederholte Verfolgung macht ihn vorsichtig und die Jagd auf ihn einigermaßen schwierig. In Griechenland werden in den letzten Sommermonaten außerordentlich viele Bienenfresser geschossen und als schmackhafte Speise mit Vorliebe genossen.
Während man in früheren Jahren voreingenommenermaßen abstand, Bienenfresser überhaupt im Käfige zu halten, hat man dies neuerdings versucht und das überraschende Ergebnis gewonnen, daß sie im Gebauer besser ausdauern, als man dies für möglich erachten konnte. Sogar alt gefangene Bienenfresser gehen unter Umständen an das Futter, verlangen jedoch, daß man ihnen dasselbe reicht, das sie sich in der Freiheit erbeuten, und weisen Ersatzfutter hartnäckig zurück. Ihre Gefräßigkeit übersteigt alle Vorstellungen. Sie fressen mehr als das Doppelte ihres eigenen Gewichtes täglich, und ihre Ernährung ist daher auch ziemlich kostspielig. Jung eingefangene gewöhnen sich, obgleich sie anfänglich gestopft werden müssen, bald an Käfig und Stubenkost, werden zahm, befreunden sich mit dem Pfleger, begrüßen ihn, wenn er sich ihnen naht, nehmen ihm artig das Futter aus der Hand und bereiten dann viele Freude und Vergnügen.
Unter den afrikanischen Arten der Familie verdient der Scharlachspint ( Meropsnubicus) besondere Erwähnung, weil er ebensowohl durch seine Färbung wie durch Lebensweise sich auszeichnet. Die vorherrschende Färbung des Gefieders ist ein dunkles Scharlachrot, das auf Schwingen und Schwanz düsterer, auf Kopf und Brust lichter wird. Die Länge beträgt 34, die Fittichlänge 15, die Länge der beiden mittelsten Schwanzfedern 19, die der übrigen Steuerfedern 11,5 Zentimeter.
Man hat den Scharlachspint in den verschiedensten Ländern der Ostküste Afrikas beobachtet, zuweilen sehr häufig, zuweilen nur einzeln. Ich habe ihn als einen Wander- oder Strichvogel im Ostsudan kennengelernt. Er erscheint in den von mir bereisten Gegenden südlich des fünfzehnten Grades nördlicher Breite mit Beginn der Regenzeit und verweilt hier bis gegen März, tritt jedoch nicht so regelmäßig auf wie in Habesch, Taka, Kordofan und längs des Weißen Nils. In Habesch traf ihn Heuglin, der bessere Gelegenheit hatte, ihn zu beobachten, als ich, als Bewohner aller wärmeren Gegenden, von den Tiefebenen an bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe empor, zuweilen in Flügen von tausend. Sein Wesen ist, wie genannter Beobachter mit Recht hervorhebt, womöglich noch lebhafter und lärmender als das der Verwandten, denen er übrigens in der Art und Weise zu fliegen wie in seinem ganzen Auftreten ähnelt. Während der heißesten Tageszeit sucht er Schutz auf Büschen und Bäumen und bedeckt dieselben dann oft im buchstäblichen Sinne des Wortes. Eine solche dicht gedrängte Schar gewährt einen wundervollen Anblick.
Die Brutzeit fällt in den Anfang der Sommerregen, in den Negerländern am Weißen Flusse schon in den März und April, im Ostsudan zwischen Juni und August. Man findet die Nistansiedelungen sowohl längs der Gewässer im Hochgestade als auf Lichtungen im Waldgürtel, ja selbst in der Steppe, hier jedoch nicht so dicht gedrängt und zuweilen nur solche, die aus einigen Paaren bestehen. Der Vogel gräbt sich sehr tiefe, meist gerade Höhlen, die je nach der Örtlichkeit wagerecht oder schief in die Erde führen. Der Brutkessel ist etwas erweitert und enthält drei bis fünf Eier von stumpf eiförmiger Gestalt, seiner, glatter Schale und rein weißer Färbung, die infolge des durchschimmernden Dotters rosenrot erscheint.
Nach vollendetem Brutgeschäft scharen sich die Scharlachspinte wiederum in größere Flüge und streichen nordwärts bis zu dem sechzehnten Grad nördlicher Breite, namentlich über die weiten Steppen, die ihnen reichliche Nahrung bieten. Am frühesten Morgen schon ertönt ihr lauter, etwas gurgelnder Ruf von den Büschen und Bäumen herab, wo sie Nachtruhe gehalten haben. Dann erhebt sich die ganze Gesellschaft, zieht eine Zeitlang hoch und lärmend umher, bis der Tau abgetrocknet ist, und begibt sich sodann auf die Kerbtierjagd in dürrem Hochgrase und längs der Gewässer. Solange der alle waldlosen Strecken des Sudan bedeckende Graswald noch reich an Kerbtieren ist, finden die Bienenfresser und mit ihnen viele andere Vögel mit Leichtigkeit ihr tägliches Brot; denn sie nähren sich dann fast ausschließlich von Heuschrecken.
Wenn die vernichtende Dürre bereits alles Pflanzenleben ertötet und namentlich die während der Regenzeit paradiesische Steppe in eine traurige Einöde verwandelt hat, zündet der Nomade bei heftigem Winde den Graswald in geeigneter Richtung an. Augenblicklich fast und gewaltig greift das Feuer um sich. Mit der Schnelle des Sturmes selbst jagen die Flammen über die Ebene dahin. Meilenweit breitet das Feuermeer sich aus, eine Wolke von Qualm und Rauch oder dunkle Glut an das Himmelsgewölbe heftend. Mit stets sich vermehrender Gefräßigkeit verschlingt es die dürr gewordenen Gräser; gierig züngelt es selbst an den Bäumen empor, die blattdürren Schlingpflanzen, die ihnen neue Nahrung geben, vernichtend. Nicht selten erreicht es den Urwald und verkohlt hier die Baumstämme, deren Laubdach es verwüstete; nicht selten kommt es an das Dorf heran und schleudert seine zündenden Pfeile auf die aus Stroh erbauten Hütten.
Wenn nun auch der Steppenbrand, ungeachtet der Menge des Brennstoffes und seiner leichten Entzündlichkeit, niemals zum Verderben der schnellfüßigen Tiere werden kann, erregt er doch die ganze Tierwelt aufs äußerste; denn er treibt alles Lebende, das die hohen Gräser verdeckten, wenigstens in die Flucht und steigert diese zuweilen infolge seiner schnellen Verbreitung zur förmlichen Raserei. Alle Steppentiere fliehen schreckerfüllt, wenn sich ihnen das Feuer nähert. Die Antilopen jagen mit dem Sturm um die Wette; Leoparden und andere Raubtiere mischen sich unter sie und vergessen der Feindschaft, des Würgens; unmutig erhebt sich der Löwe, aufbrüllend vor Zorn oder Angst, dann flüchtet er mit den Flüchtenden. Alle Höhlentiere bergen sich im sicheren Bau und lassen das Flammenmeer über sich wegfluten. Auch sie werden nicht von ihm erreicht; die Vernichtung gilt nur dem kriechenden und fliegenden Gewürme. Die Schlangen vermögen es nicht, sich dem eilenden Feuer zu entwinden, die Skorpione, Taranteln und Tausendfüßler werden sicher von ihm eingeholt. Aber nicht bloß die Flammen sind es, die ihnen verderblich werden: denn gerade das Feuer lockt neue Feinde herbei. Scharenweise fliegen Raubvögel herbei, um laufend oder fliegend vor der Feuerlinie ihrer Jagd obzuliegen, und neben ihnen treiben auch Segler, insbesondere aber die Purpurspinte, ihr Wesen. Sie alle wissen es, daß ihnen die Glut des Brandes Beute auftreibt, und sie alle benutzen das günstige Ereignis auf das beste. Man erstaunt über die Kühnheit dieser Tiere und namentlich über den Mut der kleineren, gerade unserer Bienenfresser. Sie stürzen sich aus hoher Luft herab ohne Bedenken durch den dichtesten Rauch, streichen hart über den Spitzen der Flammenlinie dahin, erheben sich wieder, verzehren die erfaßte Beute und verschwinden von neuem in den Rauchwolken.
*
Als die nächsten Verwandten der Bienenfresser betrachtet man die Raken ( Coraciadae), ziemlich große, meist in bunten Farben prangende Vögel, die eine kleine, aus ungefähr zwanzig Arten bestehende, ebenfalls nur auf der Osthälfte der Erde heimische Familie bilden. Der Schnabel ist mittel- oder ziemlich lang, kräftig, gerade, der Fuß kurz, schwachläufig und kurzzehig; die Schwingen sind mittellang oder lang und ziemlich breit; der Schwanz ist in der Regel ebenfalls mittellang, zuweilen sind auch seine beiden äußersten Federn weit über die übrigen verlängert. Das Gefieder ist zerschlissen, aber harsch und rauh. Grün, Blau, Zimmetbraun oder Weinrot sind die vorherrschenden Farben des Gefieders. Die Geschlechter unterscheiden sich wenig, die Jungen unwesentlich von den Alten.
Als die wahre Heimat der Raken sind die Gleicherländer der Alten Welt anzusehen. Trockene und ebene Gegenden bilden den bevorzugten Aufenthalt; in Gebirgen finden sich die Raken ebenso selten wie in besonders fruchtbaren Gegenden. Nur bedingungsweise kann man sie als Waldvögel betrachten. In den dünn bestandenen Steppenwäldern Afrikas fehlen sie allerdings nicht; dagegen meiden sie im Norden wie im Süden zusammenhängende dichte Bestände. Bedingung für ihren Aufenthalt sind große, einzeln stehende Bäume oder Felswände, Felskegel und unbewohnte Gebäude, von denen aus sie weite Umschau haben, und deren Höhlen und Spalten ihnen passende Nistplätze bieten. Hier pflegen sie zu sitzen und ihr Gebiet sorgfältig zu durchspähen. Ein vorbeifliegendes größeres Kerbtier wird genau in derselben Weise aufgenommen, wie von den Fliegenfängern und Bienenfressern geschieht, ein am Boden unvorsichtig dahinlaufendes Mäuschen, eine Eidechse oder ein kleiner Lurch aber auch nicht verschmäht. Zu gewissen Zeiten fressen die Raken ebenso Früchte, obgleich tierische Nahrung immer die bevorzugte bleiben mag.
Alle Raken sind unruhige und unstete Vögel. »Außerordentliche Scheu und die wachsamste Vorsicht«, sagt Gloger, »unermüdliche, wilde Lebhaftigkeit und stete, frohe Munterkeit samt besonderem Hange zum Streiten und Lärmen und bei Alten eine trotzdem nicht zu bezähmende Unbändigkeit in der Gefangenschaft: diese Eigenschaften stechen als Hauptzüge ihres Charakters hervor. Sie sitzen, da sie sich bloß aus Besorgnis, nicht aus Neigung überhaupt verbergen, fast nie lange still, am häufigsten frei und gern auf Baumwipfeln oder auf dürren Astspitzen.« Im Gezweige der Bäume hüpfen sie ebensowenig umher als auf dem Boden: sie gebrauchen zu jeder Ortsveränderung ihre Schwingen. Der gewandte, schnelle und außerordentlich leichte Flug zeichnet sich durch Gauklerkünste der sonderbarsten Art, ein merkwürdiges Überschlagen z. B., in hervorragender Weise aus. Die Stimme ist ein unangenehm harscher Laut, der dem deutschen Namen, einem Klangbilde desselben, ziemlich genau entspricht.
Nur solange die Sorge um die Brut ein Rakenpaar bindet, verweilt es an einem bestimmten Ort; vor und nach der Brutzeit schweift es im Lande umher. Unsere nordische Art zieht regelmäßig, bleibt aber in der Winterherberge nicht in einem bestimmten Gebiete, sondern durchmißt hier, scheinbar unnütz, weite Strecken, wie die in den Gleicherländern lebenden Arten es tun.
Das Nest wird an sehr verschiedenen Orten, immer aber auf dieselbe Weise angelegt. Bei uns zulande nistet die Blaurake in hohlen Bäumen, und deshalb hat man geglaubt, daß nicht bloß sie, sondern alle übrigen Arten hiervon nicht abweichen, während wir jetzt wissen, daß Mauerlöcher, Felsspalten oder selbst Höhlungen in steilen Erdwänden und Gebäuden ebensooft, vielleicht noch öfter zur Aufnahme des Nestes dienen müssen. Dieses selbst ist ein sehr liederlicher Bau, der aus Halmen, Gewürzel, Haaren und Federn besteht. Das Gelege enthält vier bis fünf glänzend weiße Eier. Sie werden von beiden Eltern wechselweise bebrütet und auch die Jungen gemeinschaftlich groß gezogen. Beide Eltern zeigen regen Eifer, soweit es sich um die Bebrütung und Ernährung handelt, vernachlässigen im übrigen aber die Brut sehr, bekümmern sich namentlich nicht im geringsten um die Reinheit des Nestes und gestatten, daß dieses zuletzt zu einem wahrhaften Kothaufen wird. Die Jungen gewinnen bald nach dem Ausfliegen ihre Selbständigkeit und gehen nun ihre eigenen Wege, ohne sich viel um ihre Eltern oder andere ihrer Art zu kümmern. Gleichwohl tut man den Raken Unrecht, wenn man sie ungesellig nennt. Wie ich mich neuerdings an freilebenden wie an gefangenen überzeugt habe, weisen sie einzig und allein Beeinträchtigung ihrer Bedürfnisse zurück. Um einen hohlen Baum entsteht lebhafter Streit unter den verschiedenen Paaren, aber nur dann, wenn es an Brutgelegenheiten mangelt, wogegen dort, wo Erd- und Felswände, altes Gemäuer, verlassene Gebäude und dergleichen Örtlichkeiten zu Nistplätzen erwählt werden, die als ungesellig verschrienen Raken sogar Siedlungen bilden können. Auch auf dem Zuge begegnet man ihnen meist in größeren Scharen; diese aber verteilen sich über einen weiten Raum, um sich im Fange der Beute nicht gegenseitig zu stören.
Wohl auf Bechsteins Behauptung sich stützend, hat man bis auf die neueste Zeit die Meinung festgehalten, daß die Raken nicht gefangen gehalten werden könnten, beziehentlich für den Käfig in keiner Weise sich eignen sollten. Still und ruhig, so sagte man, sitzen die gefangenen auf einer und derselben Stelle, beschmutzen Bauer und Gefieder in häßlicher Weise, gehen nicht an das Futter und ertragen selbst bei der besten Pflege nur kurze Zeit den Verlust ihrer Freiheit. Für alt gefangene Raken mag diese Behauptung bedingungsweise Gültigkeit haben, für jung dem Neste entnommene trifft sie in keiner Weise zu. Pflegt man solche mit Hingebung und Geschick, gewährt man ihnen außerdem einen weiten Raum, so zieht man sich in ihnen Käfigvögel heran, die zu den anziehendsten, weil unterhaltendsten und liebenswürdigsten, zählen und ihrem Pfleger alle aufgewandte Mühe reichlich lohnen.
Nicht bloß die Schönheit des Gefieders, sondern auch das schmackhafte Fleisch zieht den Raken Verfolgung zu. Bei uns zulande hält sich jeder Bauer für berechtigt, den auffallenden Vogel herabzuschießen; in Südeuropa jagt man ihm regelrecht nach. Außerdem haben die alten Raken von den Falken aller Art und die jungen von kletternden Raubsäugetieren zu leiden. Der vernünftige Mensch tut wohl, sie zu schützen. Meine Beobachtungen an gefangenen, die ich jahrelang pflegte und mit den verschiedensten kleinen Vögeln zusammenhielt, haben die Meinung in mir hervorgerufen, daß die ihnen nachgesagte Unart, dann und wann ein Vogelnest zu plündern, irrtümlich ist. Aber selbst wenn eine Rake wirklich einmal an jungen Vögeln sich vergreifen sollte, würde dieser Schaden doch in keiner Weise in Betracht gezogen werden können gegenüber dem sehr erheblichen Nutzen, den der Vogel stiftet.

Blaurake (Coracias garrulus)
Unsere Blaurake oder Mandelkrähe ( Coracias garrulus) entspricht zumeist dem oben gezeichneten Bilde der Familie. Die Sippe, die sie vertritt, kennzeichnet sich durch folgende Merkmale: Der Schnabel ist mittellang, ziemlich stark, gerade, kräftig, an der Wurzel verbreitert, auf der Firste seicht gebogen, an der Spitze hakig, der Lauf kürzer als die Mittelzehe, im Fittiche die zweite Schwinge die längste, der Schwanz gerade abgeschnitten. Das Gefieder ist prachtvoll. Kopf, Hals, Unterseite und Flügeldecken sind zart himmelblau, ins Grüne scheinend, Mantel- und Schulterfedern sowie die hinteren Armschwingen zimmetbraun, die Handschwingen schwarz, an der Wurzel himmelblau, die Armschwingen schwarz, dunkelblau scheinend, die Schwingen überhaupt von unten gesehen tiefblau, die beiden mittelsten Schwanzfedern schmutzig graubräunlich, die übrigen düster himmelblau, die äußerste an der Spitze abgeschrägt schwarz. Die Länge beträgt dreißig bis zweiunddreißig, die Breite siebzig bis zweiundsiebzig, die Fittichlänge zwanzig, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter. Von Skandinavien an südwärts ist die Blaurake überall in Europa gefunden worden; sie verbreitet sich aber viel weiter und durchstreift gelegentlich ihres Zuges ganz Afrika und Südasien.
Erst in den letzten Tagen des April trifft die Blaurake, aus ihrer Winterherberge kommend, bei uns ein, und schon im August begibt sie sich wieder auf die Reise. Junge Vögel wandern, wohl in Gesellschaft älterer ihrer Art, die ihr Brutgeschäft bereits vollendet haben, voran; die älteren folgen später, und um Mitte September haben sie uns alle verlassen. Beim Kommen fliegen die Wanderer von einem Gebüsche oder dünn bestandenen Walde zum andern; auf dem Rückzuge binden sie sich weniger an die früheren Heerstraßen, breiten sich mehr als im Frühjahre über die Gegend aus, wandern gemächlich von diesem Walde zu jenem, ruhen auf den gehäuften Getreidemandeln aus, betreiben ihre Jagd und fliegen weiter, wenn sie sich gesättigt haben. Im Frühjahre begegnet man immer nur einem Paare, im Herbste in der Regel zwar ebenfalls einzelnen, unter Umständen aber auch Gesellschaften, die aus einer Familie im eigentlichen Sinne des Wortes oder aus mehreren Alten und deren Jungen zusammengesetzt zu sein pflegen. Kaum früher und nicht viel später als bei uns zulande gewahrt man die wandernden Raken auch im Süden Europas und im Norden Afrikas, und genau so wie in der Heimat treiben sie es in der Fremde. Während des Frühjahrzuges eilen sie der ersehnten Heimat zu; während des Herbstzuges gönnen sie sich überall Zeit und lassen sich unter Umständen auch wohl durch reichliche Nahrung mehrere Tage an eine und dieselbe Stelle fesseln. Auf den eigentlichen Heerstraßen, beispielsweise im Niltale, kommt man jetzt tagtäglich mit ihnen zusammen. In den Steppen sammeln sich mehr und mehr der reisenden Vögel, und da, wo jene nur weit zerstreute Büsche aufweisen, kann man fast auf jedem derselben eine Rake sitzen und ihre Jagd betreiben sehen. Häuft sich irgendwo leicht zu erwerbende Beute, hat beispielsweise die gefräßige Wanderheuschrecke einen Teil des Steppenwaldes überfallen, so scharen sich die Raken oft in ganz ungewöhnlicher Menge. Ich traf Flüge, die aus einigen fünfzig Stück bestanden; Heuglin aber sah im Oktober 1857 viele Hunderte von ihnen in den von Wanderheuschrecken heimgesuchten Schorawäldern vereinigt. So versprechend aber auch die Steppen Nordafrikas für Raken sein mögen, einen bleibenden Aufenthalt während des Winters nehmen sie hier nicht. Weiter und weiter führt sie die Reise, und erst im Süden des Erdteils, in Natal ebensowohl wie im Damaralande, setzt das brandende Meer ihnen eine Grenze.
Bei uns zulande meidet die Blaurake die Nähe des Menschen fast ängstlich; in südlicheren Gegenden wählt sie zwar ebenfalls mit Vorliebe ungestörte Örtlichkeiten, scheut aber den im allgemeinen freundlicher gesinnten menschlichen Einwohner der Gegend nicht. Alte, zur Aufnahme ihres Nestes passende Bäume findet sie in Südeuropa noch seltener als bei uns zulande; wohl aber fehlt es ihr hier an Ruinen alter oder verlassener Gebäude und nötigenfalls an senkrecht abfallenden Erdwänden oder in Ermangelung einer solchen wohl auch an Klippen, in denen sie eine geeignete Bruthöhlung findet. Aus diesem Grunde begegnet man ihr dort, viel häufiger als bei uns zulande, auch in Gegenden, die sie hierorts meiden würde. In ebenso treuer als anziehender Weise schildert Tristram ihr Treiben in Palästina bald nach der Ankunft im Frühjahre. Hier trifft die Rake bereits um die Mitte des April, von Süden kommend, ein, sammelt sich mit andern ihrer Art gegen Abend zunächst noch in mehr oder minder zahlreichen Gesellschaften auf Bäumen, die Herberge für die Nacht gewähren sollen, und schwatzt und schreit und lärmt ganz ebenso, nur mit etwas mehr Mäßigung als die Saatkrähe auf ihrem Schlafplatze. Nachdem alles durcheinander geschrien, erhebt sich einer oder der andere Vogel von seinem Sitze, fliegt zu einer gewissen Höhe empor und treibt hier, begeistert vom Liebesdrange, die üblichen Spiele, die der Paarung vorauszugehen pflegen. Einige Augenblicke später folgt der ganze Flug, und alles schwebt und fliegt, taumelt und gaukelt durcheinander. Eine Woche später sind die Ankömmlinge verschwunden; aber ein Teil derselben, vielleicht zwanzig oder dreißig Paare, läßt sich in einem der benachbarten Täler wiederfinden, woselbst an einer steil abfallenden Erdwand alle Weibchen eifrig beschäftigt sind, die Nisthöhlungen auszugraben. Fortan erscheint kein Glied der Siedlung mehr auf den vorher so regelmäßig besuchten Bäumen, so nahe die früher beliebten Versammlungsorte dem Nistplatze auch liegen mögen. Die Sorge um die Brut nimmt sie in Anspruch. Anderen begegnet man in der Nachbarschaft der Dörfer, namentlich wenn sich hier verfallene Kirchen und Moscheen befinden; denn selten wird man eines dieser Gebäude besuchen, ohne den Prachtvollen Vogel als Bewohner desselben anzutreffen. Wohin man jetzt auch kommen mag, überall sieht man Raken. Jede Warte ist von einem der spähenden Vögel besetzt, jeder Felsen, jeder Stein, auf dem er gesehen werden und selbst in die Runde schauen kann, durch einen geziert. In unseren, von den Menschen so vollständig in Besitz genommenen Gauen sieht die Rake ihre Lebensbedingungen nicht so leicht erfüllt. Ob infolge vererbter Gewohnheit oder aus andern Gründen, vermag ich nicht zu sagen: bis jetzt hat man sie, soviel mir bekannt, in Deutschland immer nur in hohlen Bäumen brütend gefunden. Damit aber erklärt sich ihr vereinzeltes Vorkommen. Baumhöhlen, geräumig genug, das Nest mit dem brütenden Weibchen und der später heranwachsenden Kinderschar in sich aufzunehmen, sind unerläßliche Bedingungen für regelmäßigen Sommeraufenthalt eines Rakenpaares in einer bestimmten Gegend. Fehlen die Bäume, die seit Menschengedenken bewohnt wurden, so sehen sich die Paare gezwungen, die Gegend zu verlassen.
Wenige Vögel verstehen eine Gegend so zu beleben wie die Blaurake, übersehen kann man sie nicht. Sie ist höchst unstet und flüchtig, solange sie nicht die Sorge um die Brut an ein ganz bestimmtes Gebiet fesselt, schweift während des ganzen Tages umher, von Baum zu Baum fliegend, und späht von den Wipfeln oder von den Spitzen dürrer Aste aus nach Nahrung. Bei trübem Wetter mürrisch und verdrossen, tummelt sie sich bei Sonnenschein oft in hoher Luft umher und führt dabei sonderbare Schwenkungen aus, stürzt sich z. B. Plötzlich aus bedeutender Höhe kopfüber in die Tiefe hernieder und klettert dann langsam wieder aufwärts oder schwenkt sich taubenartig unter hastigen Flügelschlägen, scheinbar zwecklos, durch die Lust, so daß man sie immer leicht erkennen kann. Diese Spiele geschehen unzweifelhaft hauptsächlich zur Freude des Weibchens oder doch des Gatten, werden wenigstens während der Brutzeit viel öfter als sonst beachtet, dienen aber auch, der Bewegungslust der Raken wie überhaupt jeder Erregung Ausdruck zu geben. Ebenso scheint der Vogel manchmal nur seine Flugkunst zeigen oder selbst erproben zu wollen; denn er treibt solche Spiele auch einzeln, gewissermaßen sich selbst zur Freude. Jedenfalls bekundet die Rake fliegend ihre hervorragendsten Begabungen. Im Gezweige hüpft sie nicht umher, bewegt sich vielmehr, wie die meisten übrigen Leichtschnäbler, immer nur mit Hilfe der Flügel von einem Aste zum andern. Flachen Boden meidet sie; doch kommt es vor, daß sie sich demselben fliegend so weit nähert, um ein dort laufendes Tier aufnehmen zu können. In den Steppen Turkestans, die sie stellenweise häufig bewohnt, muß sie sich wohl oder übel mit jeder Erhöhung behelfen, die sich dort überhaupt findet, und man sieht sie daher sehr häufig auf einer niederen Scholle oder überhaupt auf einer Bodenerhöhung sitzen, die kaum mehr als zehn Zentimeter über der umgebenden Ebene sich erhebt.
Über die geistigen Begabungen der Rake sind die Meinungen der Beobachter geteilt. Der hohen Entwicklung der Sinne lassen wohl alle Gerechtigkeit widerfahren; Verstand und Wesen aber werden sehr verschieden beurteilt. So viel läßt sich schwerlich in Abrede stellen, daß man die Rake zu den klugen Vögeln zählen darf. Sie erkennt und unterscheidet wirkliche Gefahr sehr wohl von einer eingebildeten, ist aber eher vertrauensselig als unbedingt scheu zu nennen. Wo sie sich des Schutzes seitens des Menschen versichert hat, läßt sie denselben nahe an sich herankommen; wo sie Nachstellungen erleiden mußte, flieht sie schon von weitem und benimmt sich stets höchst vorsichtig. Ihr Wesen scheint nicht gerade liebenswürdiger Art zu sein. Sehr oft sieht man Raken mit andern Vögeln oder mit ihresgleichen in Streit liegen. Von der Mühle versichert, daß sie mit der Dohle, Naumann, daß sie mit andern um sie wohnenden Vögeln gute Freundschaft halte: das erstere ist richtig, das letztere hat wohl nur bedingungsweise Geltung; denn nicht bloß die Raubvögel, sondern auch Würger, Häher und Krähen werden von ihr heftig angefallen. Was die Zweikämpfe mit andern ihrer Art anlangt, so sind dieselben nicht so ernstlich gemeint, als es den Anschein hat. Am heftigsten kämpfen die Blauraken, wie bemerkt, um den Nistplatz; außerdem verursacht auch wohl Futterneid Unfrieden, und endlich kann die Eifersucht ins Spiel kommen. Sind aber genügend Brutplätze vorhanden, so beweist der als zänkisch verschriene Vogel, daß er ebenso wie der Bienenfresser mit seinesgleichen in Eintracht leben und mit andern Höhlenbrütern, den verwandten Bienenfressern und Seglern zum Beispiel, eine und dieselbe Nistwand friedlich bewohnen kann. Daher meine ich, daß die Rake nicht so schlimm ist wie ihr Ruf. Die Stimme entspricht dem Namen: sie ist ein hohes, schnarrendes, beständig wiederholtes »Raker, raker, raker«, der Laut des Zornes aber ein kreischendes »Räh« und der Ton der Zärtlichkeit ein klägliches, hohes »Kräh«.
Allerlei Kerbtiere und kleine Lurche, namentlich Käfer, Heuschrecken, Gewürm, kleine Frösche und Eidechsen, bilden die Nahrung der Rake, Eine Maus nimmt sie wohl auch mit auf, und kleine Vögel wird sie ebenfalls nicht verschmähen. Naumann sagt, daß er sie nie ein fliegendes Kerbtier habe fangen sehen; ich hingegen muß sagen, daß dies doch geschieht, und auch Jerdon versichert, daß die indische Art auf gewisse Strecken fliegende Kerbtiere verfolgt, beispielsweise eifrig mit dem Fange der geflügelten Termiten sich beschäftigt, wenn diese nach einem gefallenen Regen ihre Nester verlassen und umherschwärmen. Laut Naumann soll sie auch niemals Pflanzenstoffe zu sich nehmen, während von der Mühle erwähnt, daß in Griechenland ihre Federn an der Schnabelwurzel von dem Zuckerstoff der Feigen verkleistert erscheinen, und Lindermayer bestätigend hinzufügt, daß sie noch nach ihrem Wegzuge aus Griechenland auf den Inseln verweile, »wo die Feigen, ihre Lieblingskost, sie noch einige Zeit fesseln, ehe sie ihre Reise nach den afrikanischen Gebieten antritt.« Für gewöhnlich freilich bilden Kerbtiere ihre Hauptnahrung. Von ihrem hohen Sitze schaut sie in die Runde, fliegt schnell nach dem erspähten Kerbtiere hin, ergreift es mit dem Schnabel, verzehrt es und kehrt auf den Stamm zurück. »Kleine Taufrösche«, sagt Naumann, »mag sie gern fressen. Man bemerkte an jung aufgezogenen Blauraken, daß sie selbige mit dem Schnabel bei den Hinterfüßen packten, sie gegen den Boden schlugen, bis sie sich nicht mehr rührten, und so drei bis vier Stück hintereinander verschlangen.« Wasser scheint für sie kein Bedürfnis zu sein; es ist behauptet worden, daß sie niemals trinke und sich auch nicht bade, und diese Angabe gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man den Vogel mitten in der wasserlosen Steppe oder Wüste sich umhertreiben sieht, wie ich es beobachtet habe.
Ich will unentschieden lassen, ob die ursprünglichen Brutplätze der Raken Baumhöhlungen und die selbst ausgegrabenen Erdlöcher oder Ritzen in Gebäuden nur Notbehelfe sind, oder ob das Umgekehrte der Fall ist; so viel aber unterliegt keinem Zweifel, daß unser Vogel im Süden Europas Erdlöcher viel häufiger benutzt als Baumhöhlungen. Je nach dem Standorte ist das Nest verschieden, die Mulde aber immer mit zartem Gewürzel, Halmen, Tierhaaren und Federn ausgekleidet. Das Gelege besteht aus vier bis sechs glänzendweißen Eiern. Beide Geschlechter brüten abwechselnd und so eifrig, daß man sie über den Eiern mit der Hand ergreifen kann. »Die Jungen sitzen«, wie Naumann sagt, »da die Alten den Kot derselben nicht wegschaffen, im Schmutz und Unrat bis über die Ohren, so daß das Nest einen sehr ekelhaften Geruch verbreitet.« Sie werden mit Kerbtieren und Maden großgefüttert, fliegen bald aus, begleiten die Eltern dann aber noch längere Zeit und treten endlich mit ihnen gemeinschaftlich die Winterreise an. Gegen Feinde, die die Jungen bedrohen, benehmen sich die Alten höchst mutig, setzen wenigstens ihre eigene Sicherheit rücksichtslos aufs Spiel.
Jung dem Nest entnommene und ausgefütterte Blauraken haben mir viel Vergnügen bereitet. Nachdem sie eine Zeitlang geatzt worden waren, gewöhnten sie sich bald an ein geeignetes Ersatzfutter und schlangen von diesem gierig verhältnismäßig erhebliche Mengen hinab. Entsprechend dieser Gefräßigkeit schienen sie eigentlich niemals gesättigt zu sein, stürzten sich mindestens, sobald man ihnen Kerbtiere zeigte, mit gleicher Gier auf diese wie vorher auf das erwähnte Futter. Dadurch, daß ich ihnen täglich die Mehlwürmer selbst reichte, wurden sie bald so zahm, wie irgendein Rabe es werden kann. Schon bei meinem Erscheinen begrüßten sie mich, flogen unter zierlichen Schwenkungen von ihren Sitzen hinab auf meine Hand, ließen sich widerstandslos ergreifen, fraßen trotzdem tüchtig und kehrten, sobald ich sie freigegeben hatte, nach einigen Schwenkungen wieder auf die Hand zurück, die sie eben umschlossen hatte. Andern Vögeln, deren Raum sie teilten, wurden sie nicht beschwerlich, lebten vielmehr, sooft sie unter sich in unbedeutende Streitigkeiten gerieten, mit allen Mitbewohnern ihres Käfigs in Eintracht und Frieden. Nachdem ich jahrelang diese früher auch von mir verkannten Vögel gepflegt habe, darf ich sie allen Liebhabern auf das wärmste empfehlen. Wer ihnen einen weiten, passend hergerichteten Raum anweisen und Kerbtiernahrung, wären es auch nur Mehlwürmer, in genügender Menge beschaffen kann, wird mir beistimmen und sie ebenso lieb gewinnen wie ich.
*
Die Nachttiere unter den Leichtschnäblern sind so ausgezeichnete Geschöpfe, daß sie weder verkannt noch mit andern Klassenverwandten verwechselt werden können. Überall, wo sie leben, haben sie die Beachtung der Menschen auf sich gezogen, überall in diesem Sinne Geltung sich zu verschaffen gewußt und zu den sonderbarsten Meinungen Veranlassung gegeben. Hiervon zeugt unter anderm die Menge und Bedeutsamkeit der Namen, die sie führen.
Die Nachtschwalben oder Nachtschatten ( Caprimulgidae) bilden eine über hundert Arten zählende, also sehr zahlreiche, nach außen hin scharf, jedoch nicht von allen Forschern in derselben Weise abgegrenzte Familie. Ihr gemeinsamer Name »Nachtschwalben« ist nicht übel gewählt; jedoch kann man nur, insofern es sich um die allgemeineren Kennzeichen handelt, von einer Ähnlichkeit zwischen ihnen und den Schwalben sprechen; genauere Begleichung der verschiedenen Gruppen ergibt wesentliche Unterschiede. Der äußere und innere Bau der Nachtschwalben ist ein durchaus eigentümlicher. Sie ähneln streng genommen den Schwalben in viel geringerem Grade als die Eulen den Falken. Die Größe schwankt erheblich. Einige Arten sind fast so groß wie ein Rabe, andere kaum größer als eine Lerche. Der Leib ist gestreckt, der Hals kurz, der Kopf sehr groß, breit und flach, das Auge umfangreich und ziemlich stark gewölbt, der Schnabel verhältnismäßig klein, hinten außerordentlich breit, aber sehr kurz, stark nach vorn verschmälert und ungemein flach; die Kiefer hingegen sind sehr verlängert, und der Rachen ist deshalb weiter als bei irgendeinem andern Vogel. Der hornige Teil des Schnabels nimmt nur die Spitze des Freßwerkzeuges ein, ist schmal, am Oberkiefer oder seitlich herabgebogen, seine stumpfe Firste wenig nach rückwärts gezogen. Neben ihr liegen die gewöhnlich röhrenförmigen Nasenlöcher nahe nebeneinander. Die Beine sind regelmäßig schwach, ihre Läufe sehr kurz, auf der Hinterseite mit einer Schwiele bedeckt, vorn in der Regel mit kurzen Schildern bekleidet, oben oft befiedert, zuweilen auch ganz nackt. Die Zehen sind, mit Ausnahme der sehr entwickelten Mittelzehe, kurz und schwach, Innenzehe und Mittelzehe gewöhnlich am Grunde durch eine Spannhaut verbunden; die Hinterzehe richtet sich nach der inneren Seite, kann aber auch nach vorwärts gekehrt werden. Bei allen Arten einer Unterfamilie trägt die lange Mittelzehe auch einen langen, auf der inneren Seite aufgeworfenen und gezähnelten Nagel. Die Schwingen sind lang, schmal und spitzig; doch ist nicht die erste, sondern gewöhnlich die zweite und oft erst die dritte oder vierte Schwungfeder die längste von allen. Der Schwanz besteht aus zehn Federn, die sehr verschieden gestaltet sein können. Das Gefieder ist eulenartig, großfederig und weich, seine Zeichnung regelmäßig eine außerordentlich seine und zierliche, die Färbung jedoch eine düstere und wenig auffallende. Am kürzesten wird man beide bezeichnen können, wenn man sie baumrindenartig nennt. Beachtenswert sind die Borsten, die den Rachen umgeben, ebenso merkwürdig die kurzen, feinen und dichten Wimpern, die das Auge umstehen. Bei einigen Arten haben die Männchen besondere Schmuckzeichen: verlängerte und meist auch sehr eigentümlich gestaltete Federn, die nicht bloß in der Schwanzgegend entspringen, wie sonst die Regel, sondern auch dem Flügelgefieder entsprossen oder selbst als umgebildete Schwingen angesehen werden müssen. Alle Gegenden und Länder der Erde, mit Ausnahme derer, die wirklich innerhalb des kalten Gürtels liegen, beherbergen Nachtschwalben. In Europa kommen nur zwei Arten vor, im Norden Amerikas mehr als doppelt so viele; schon in Nordafrika und namentlich in Mittelamerika nimmt die Artenzahl beträchtlich zu. Dasselbe gilt für die entsprechend gelegenen Länder Asiens; auch Neuholland ist nicht arm an ihnen. Der Verbreitungskreis der einzelnen Arten ist ziemlich ausgedehnt, der Aufenthalt aber beschränkt sich auf besonders günstige Örtlichkeiten. Die große Mehrzahl aller Nachtschwalben lebt im Walde oder sucht diesen wenigstens auf, um auszuruhen, einige Arten dagegen ganz entschieden die Steppe, und andere wieder sogar die Wüste oder wüstenähnliche Steinhalden und dergleichen Plätze. Im Gebirge steigen diejenigen Arten, die hier leben, bis zu bedeutender Höhe empor; so unsere Nachtschwalbe, laut Tschudi, in den Alpen bis zu achtzehnhundert, ein afrikanischer Nachtschatten, laut Heuglin, in Habesch bis zu viertausend, der Nachtfalk, laut Allen, in den Gebirgen Kolorados zu mehr als dreitausend Meter über dem Meere.
Wie zu erwarten, spricht sich in der Grundfärbung des Gefieders der eine oder der andere dieser Wohnkreise aus. Alle waldbewohnenden Nachtschatten tragen ein echt rindenfarbiges Gefieder, die wüsten- oder steppenbewohnenden hingegen ein sandfarbiges; das allgemeine Gepräge der Färbung wird aber so streng festgehalten, daß Swainson behaupten durfte, wer einen Ziegenmelker gesehen, habe sie alle gesehen.
Standvögel sind wahrscheinlich nur diejenigen Arten, die in den Waldungen der Gleicherländer leben. Alle übrigen dürften mindestens streichen, und sämtliche nordische Arten wandern regelmäßig. Sie erscheinen ziemlich früh im Jahre in ihrer Heimat und verweilen bis zu Anfang des Herbstes. Ihre Wanderungen dehnen sie über weite Gebiete aus; unsere Nachtschwalbe zieht bis in das Innere Afrikas. Nur während dieser Reisen sind die Nachtschatten einigermaßen gesellig; in der Heimat selbst lebt jedes einzelne Paar streng für sich und vertreibt ein anderes aus seinem Gebiete. Der Umfang des letzteren pflegt jedoch gering zu sein, und da, wo die Vögel häufig sind, kann es vorkommen, daß ein großer Garten von mehreren Paaren bewohnt wird. Bei uns zulande meiden die Nachtschwalben die Nähe des Menschen, erscheinen wenigstens nur ausnahmsweise nachts über den Dörfern; im Süden ist dies nicht der Fall; hier siedeln sie sich in oder unmittelbar an Dörfern an, und zumal große Gärten werden zu ihrem gewöhnlichen Wohnsitz.
Kerbtiere verschiedener Art bilden die ausschließliche Nahrung der großen Mehrzahl, diese und allerlei kleine Wirbeltiere die Beute einiger Nachtschwalben. Sämtliche Arten sind im höchsten Grade gefräßig und machen sich daher um unsere Waldungen sehr verdient. Mit der Gewandtheit eines Falken oder einer Schwalbe streichen sie bald niedriger, bald höher über freie Plätze, Gebüsche und Baumkronen, umschweben die letzteren oft in höchst anmutigen Schwenkungen und nehmen während des Fluges vorübersummende Kerbtiere weg, lesen auch wohl solche auf, die schlafend auf Blättern, Halmen und selbst am Boden sitzen. Ihr weites Maul gestattet ihnen, sehr große Käfer zu verschlingen, und es sind daher gerade diejenigen Arten, die von andern Vögeln verschont werden, ihren Angriffen besonders ausgesetzt. Unser Nachtschatten z. B. schlingt ein Dutzend und mehr Mai- und Junikäfer oder große Mist-, Pillen- und Dungkäfer nacheinander hinab, ist auch imstande, die größten Nachtschmetterlinge oder Grillen und Heuschrecken in sein weites Maul aufzunehmen und wenigstens größtenteils hinabzuwürgen. Schwalme bewältigen selbst kleine Wirbeltiere, und die Schwalke verschlucken pflaumengroße Früchte. Zur besseren Verdauung nehmen wenigstens die kerbtierfressenden Arten kleine Steinchen auf, die sie auf kiesigen Plätzen zusammenlesen. Ihre Jagd beginnt in der Regel mit Einbruch der Nacht, wird einige Stunden lang betrieben, sodann unterbrochen und gegen die Morgendämmerung hin von neuem wieder aufgenommen. Noch ehe die Sonne am Himmel erscheint, suchen sie die Ruhe. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Amerikanische Arten jagen nicht selten am hellen Tage und nicht nur in schattigen Waldungen, sondern auch im Freien und im hellsten Sonnenscheine. Die übrigen pflegen während des Tages der Länge nach auf einem umgefallenen Stamme und andern liegenden Holzstücken oder auf dem Boden und auch auf Felsgesimsen in düsteren Höhlungen zu sitzen oder richtiger vielleicht zu liegen; denn sie drücken sich so platt auf ihre Unterlage, daß sie viel breiter als hoch erscheinen.
Alle Nachtschwalben zeigen sich nur im Fluge als bewegungsfähige Wesen; auf den Zweigen kleben sie, und auf der Erde liegen sie mehr, als sie sitzen. Ihr Gang ist ein trauriges Trippeln, scheint sehr zu ermüden und wird niemals weiter als auf einige Meter hin fortgesetzt; der Flug hingegen, gewissermaßen ein Mittelding zwischen dem Fluge der Schwalbe und dem eines Falken, zeichnet sich durch Leichtigkeit und Zierlichkeit, Gewandtheit und Anmut aus. Ungern erheben sich die Nachtschwalben zu bedeutenden Höhen; es geschieht dies jedoch nicht aus Unvermögen, sondern weil die Tiefe ihnen viel mehr bietet als eine größere Höhe. Bei ausgedehnteren Wanderungen sieht man sie oft hoch über dem Boden dahinziehen, und namentlich diejenigen, die bei Tage fliegen, durchjagen sehr häufig auch die oberen Luftschichten.
Unter den Sinnen steht wohl das Gesicht obenan, wie das große Auge schließen läßt; nächstdem scheinen Gehör und Gefühl am meisten entwickelt zu sein. Die geistigen Fähigkeiten sind gering, wenn auch wahrscheinlich nicht in dem Grade, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt. Die schlaftrunkene Nachtschwalbe, die wir bei Tage beobachten können, macht allerdings einen höchst ungünstigen Eindruck, und auch die zufällig gefangene weiß sich nicht anders zu helfen als durch das Aufsperren ihres ungeheueren Rachens und heiseres Fauchen; die ermunterte, in voller Tätigkeit begriffene zeigt sich von ganz anderer Seite. Sie bekundet zwar gewöhnlich recht alberne Neugier und sehr oft verderbliche Vertrauensseligkeit, lernt jedoch ihren Feind bald genug kennen und greift selbst zur List, um sich oder ihre Brut dessen Nachstellungen zu entziehen.
Ein eigentliches Nest bauen die Nachtschwalben nicht. Sie legen ihre Eier ohne jegliche Unterlage auf den flachen Boden, denken nicht einmal daran, für diese Eier eine seichte Höhlung auszuscharren. Die Anzahl des Geleges ist stets gering; die meisten Nachtschwalben legen nur zwei Eier, viele sogar bloß ein einziges. Wahrscheinlich brüten nur die Weibchen; beide Eltern aber bekunden rege Teilnahme für ihre Brut und verteidigen sie, so gut sie können. Einige sichern die Eier auch in eigentümlicher Weise, indem sie dieselben, wie Audubon uns mitteilt, in dem ungeheueren Rachen bergen und sie einer andern, ihnen sicher dünkenden Stelle des Waldes zuschleppen, wo sie die Bebrütung fortsetzen. Die Jungen kommen in einem ziemlich dichten Dunenkleide aus dem Ei, sehen anfänglich, ihrer dicken Köpfe und großen Augen wegen, ungemein häßlich aus, wachsen aber rasch heran und erhalten bald das Kleid ihrer Eltern. Sie werden, soviel uns bekannt, von allen Arten mit hingebender Liebe gepflegt und nach besten Kräften verteidigt.
Für die Gefangenschaft eignen sich wenige Nachtschwalben; doch ist es keineswegs unmöglich, sie bei geeigneter Pflege längere Zeit im Zimmer oder im Käfige zu erhalten, vorausgesetzt, daß man sie jung dem Nest entnimmt und anfänglich stopft. Besonders anziehende Gefangene sind sie nicht, wohl aber solche, die die Beachtung des Liebhabers auf sich lenken. Diejenigen Arten, die nicht ausschließlich Kerbtiere fressen, sondern auch kleine Wirbeltiere verzehren, halten sich verhältnismäßig leicht und dauern im Käfige jahrelang aus.
Die Anzahl der Feinde, die den Nachtschwalben gefährlich werden können, ist verhältnismäßig gering. Der Mensch, der sie kennenlernt, verfolgt sie nicht. Eine solche Schonung wird ihnen jedoch keineswegs deshalb zuteil, weil man ihren Nutzen erkannt hat, sondern viel häufiger, weil man in ihnen unheimliche Vögel sieht, deren Tötung schlimme Folgen nach sich ziehen kann. So denken die Indianer, die Farbigen und Neger Mittelamerikas, nicht viel anders die Spanier und viele afrikanische Volksstämme. Unsere Bauern betrachten die harmlosen Geschöpfe mit entschieden mißgünstigem Auge, weil sie der Ansicht sind, daß jene ihren weiten Rachen zu nichts anderem als zum Melken der Ziegen benutzen könnten. Ungebildete erlegen sie nur zu häufig aus bübischer Mordlust. Nächst dem Menschen verfolgen bei uns zulande die schleichenden Raubtiere und Raubvögel und wohl auch größere Schlangen die Nachtschwalben; doch scheint der Schaden, den diese Tiere ihnen zufügen, nicht eben von Belang zu sein.
Die Schwalme oder Eulenschwalben ( Podarginae), denen wir den Rang einer Unterfamilie zusprechen, weichen von den übrigen Nachtschatten nicht unwesentlich ab und sind deshalb neuerdings gänzlich von ihnen getrennt, ja sogar andern Ordnungen zugewiesen worden. Der Leib der Schwalme ist gestreckt, der Hals kurz, der Kopf breit und flach, der Flügel aber verhältnismäßig kurz und stumpf, der Schwanz lang, der Fuß hoch und kräftig. Der Schnabel hat nur insofern Ähnlichkeit mit dem der Nachtschwalben, als er sich sehr tief spaltet: in jeder andern Hinsicht unterscheidet er sich. Er ist groß, platt, an der Wurzel sehr breit, breiter als die Stirne, an der Spitze hakig gebogen und durchaus hornig; beide Kiefer sind ungefähr gleich lang, glatt, das heißt zahnlos; die Ränder der Kinnladen sind unbefiedert; die Mundöffnung spaltet sich bis hinter die Augen; die Nasenlöcher liegen nicht auf der Mitte, sondern nahe der Wurzel, teilweise unter den Stirnfedern verborgen. Das Gefieder ist weich und düsterfarbig wie bei den meisten Ziegenmelkern; die Federn am Schnabelgrunde, bei einigen Arten auch die der Ohrgegend, sind zu borstenartigen Gebilden umgewandelt. Alle bis jetzt bekannten Arten der Schwalme leben in den Waldungen Südasiens und Neuhollands, einige auf den betreffenden Festländern, andere auf den großen Eilanden jener Erdgegend.
Der Eulen- oder Riesenschwalm ( Podargus humeralis ), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Podargus), ist ein Vogel von Krähengröße. Die Federn der ganzen Oberseite sind auf dunkel graubraunem Grunde mit sehr feinen graulichweißen und schwarzen Punkten wie überspritzt, die Schultergegend auf graulichweißem Grunde mit Zickzackquerflecken, Oberkopf, Mantel und Flügeldecken mit schmalen, deutlich hervortretenden, schwarzen Schaftstrichen, die kleinen tiefbraunen Flügeldecken am Buge mit seinen, hellen Spritzpunkten gezeichnet, welch letztere unterseits von einer Reihe graulichweißer, braun punktierter Spitzenflecke begrenzt werden. Der Schnabel ist lichtbraun, purpurfarbig überlaufen, der Fuß ölbraun, das Auge gelblichbraun.
Gould und Verreaux haben uns ziemlich ausführliche Mitteilungen über das Leben der Riesenschwalme gegeben. Aus ihnen geht hervor, daß die verschiedenen Arten auch hinsichtlich ihrer Lebensweise sich fast vollständig ähneln, und daß man daher alles, was von einer Art beobachtet wurde, auf die übrigen beziehen darf. »Wir haben«, sagt Gould, »in Australien eine zahlreiche Gruppe von Nachtvögeln dieser Form, die, wie es scheint, bestimmt sind, die Baumheuschrecken im Schach zu halten. Sie sind feige und träge Gesellen, die sich ihre Nahrung nicht durch Künste des Fluges, sondern durch einfaches Durchstöbern der Zweige verschaffen. Wenn sie nicht mit dem Fange beschäftigt sind, sitzen sie auf offenen Plätzen, auf Baumwurzeln, Geländern, Dächern, auch wohl auf Leichensteinen der Kirchhöfe und werden deshalb von abergläubischen Leuten als Todesverkündiger betrachtet, wozu auch ihre unangenehme, rauhe Stimme das Ihrige beiträgt. Hinsichtlich ihres Brutgeschäftes unterscheiden sie sich auffallend von ihren Verwandten; denn sie erbauen sich ein flaches Nest aus kleinem Reisig auf den wagerechten Zweigen der Bäume.«
Der Riesenschwalm gehört zu den häufigsten Vögeln von Neusüdwales, und es hält deshalb durchaus nicht schwer, ihn zu beobachten. »Er ist das schlafsüchtigste aller Geschöpfe und läßt sich schwerer erwecken als irgendein anderes. Solange die Sonne am Himmel steht, hockt er schlafend auf einem Zweige, den Leib fest auf seinen Sitz gedrückt, den Hals zusammengezogen, den Kopf zwischen den Schulterfedern versteckt und so bewegungslos, daß er mehr einem Astknorren als einem Vogel gleicht. Ich muß ausdrücklich hervorheben, daß er sich immer der Quere und nicht der Länge nach setzt. Er ist aber so still, und seine düstere Farbe stimmt so genau überein mit der Rindenfärbung und -zeichnung, daß schon eine gewisse Übung dazu gehört, den großen Vogel bei hellem Tage zu entdecken, obgleich sich dieser gewöhnlich gar nicht versteckt, sondern auf Ästen niederläßt, die zweiglos sind.«
Der Schlaf des Riesenschwalms ist so tief, daß man einen der Gatten vom Baume herabschießen kann, ohne daß der andere dicht daneben sitzende sich rührt, daß man mit Steinen nach dem Schläfer werfen oder mit Stöcken nach ihm schlagen mag, ohne ihn zum Fortfliegen zu bewegen, daß man imstande ist, ihn mit der Hand zu ergreifen. Gelingt es wirklich, ihn aufzuscheuchen, so entwickelt er kaum so viel Tatkraft, daß er sich vor dem Herabfallen auf den Boden schützt. Er flattert scheinbar bewußtlos den nächsten Zweigen zu, klammert sich dort fest und fällt sofort wieder in Schlaf. Dies ist die Regel; doch kommt es ausnahmsweise vor, daß ein Schwalm auch bei Tage eine kleine Strecke durchfliegt.
Ganz anders zeigt sich der Vogel, wenn die Nacht hereinbricht. Mit Beginn der Dämmerung erwacht er aus seinem Schlafe, und nachdem er sich gereckt und gedehnt, die Federn geordnet und geglättet hat, beginnt er umherzustreifen. Nunmehr ist er das gerade Gegenteil von dem, was er tagüber war: lebendig, munter, tätig, rasch und gewandt in allen seinen Bewegungen, emsig bemüht, Beute zu gewinnen. Rasch rennt er auf den Zweigen dahin und nimmt hier die Heuschrecken und Zikaden auf, die sich zum Schlummer niedergesetzt; nach Spechtesart hämmert er mit dem Schnabel an der Rinde, um die dort verborgenen zum Vorschein zu bringen; ja, er schlüpft wohl selbst in das Innere der Baumhöhlungen, um auch hier nach Nahrung zu suchen. Man kann nicht eben behaupten, daß er ein besonders guter Flieger sei; sein Flug ist vielmehr kurz und abgebrochen, wie es die verhältnismäßig kurzen Schwingen erwarten lassen; ungeschickt aber ist er durchaus nicht, denn er fliegt spielend zu seinem Vergnügen von Baum zu Baum. Mit einbrechender Nacht endigt dies Vergnügen. Dann bewegt er sich höchstens noch im Gezweige der Bäume, hier alles durchschnüffelnd. Gould meint, daß die Riesenschwalme nur Kerbtiere fressen, Verreaux hingegen versichert, daß sie auch anderer Beute nachstreben. Während der Brutzeit rauben sie junge Vögel, töten sie, wenn sie ihnen zu groß sind, nach Art der Baumeisvögel, indem sie dieselben mit dem Schnabel packen und wiederholt gegen den Ast schlagen, und schlucken sodann den Leichnam ganz hinunter. Ihre Jagd währt nur, solange es dämmert; bei dunkler Nacht sitzen sie ruhig auf einem und demselben Aste. Einige Stunden vor Tagesanbruch jagen sie zum zweiten Male, ganz wie die Ziegenmelker auch tun.
Die Stimme des Männchens ist laut und unangenehm, für den, der sie zum ersten Male hört, überraschend. Sie soll, nach Verreaux, dem Ruksen der Tauben ähneln. Am lautesten und eifrigsten schreien die Schwalme selbstverständlich während der Paarungszeit. Dann gibt ihr Ruf das Zeichen zum Streite. Sobald ein anderes Männchen herbeikommt, entspinnt sich heftiger Kampf, bis einer unbestrittener Sieger bleibt. Die Fortpflanzungszeit fällt in den Juli und August. Die Paarung selbst geschieht in der Dämmerung; nach ihr bleiben beide Geschlechter dicht nebeneinander sitzen und verharren unbeweglich, bis ihre Jagd von neuem beginnt. Das kleine, flache Nest wird aus feinen Zweigen zusammengebaut, und zwar von beiden Gatten eines Paares. Es ist ein erbärmlicher Bau, der innen nur mit einigen Grashalmen und Federn belegt wird. Gewöhnlich steht es sehr niedrig, etwa zwei Meter über dem Boden in der Gabel eines Baumastes, so daß es bequem mit der Hand erreicht werden kann. Die zwei bis vier länglichen, reinweißen Eier sieht man, wie die mancher Tauben, von unten durchschimmern. Beide Geschlechter teilen sich in das Brutgeschäft; das Männchen brütet gewöhnlich nachts, das Weibchen bei Tage. Ersteres sorgt allein für die ausgebrütete Familie. Ist das Nest den Sonnenstrahlen zu sehr ausgesetzt, und sind die Jungen so groß, daß die Mutter sie nicht mehr bedecken kann, so werden sie von den Alten aufgenommen und in eine Baumhöhle gebracht. Diese Sorgfalt ist aus dem Grunde bemerkenswert, weil die Alten sich auf ihren Schlafplätzen den Einwirkungen des Wetters rücksichtslos preisgeben. Anfang November verlassen die Jungen das Nest, bleiben aber wahrscheinlich noch längere Zeit in Gesellschaft ihrer Eltern.
Jung aus dem Neste genommene Schwalme werden, wie Verreaux angibt, bald zahm, lernen ihren Gebieter kennen, setzen sich auf seinen Kopf, kriechen in sein Bett, jagen auch wohl andere Tiere aus demselben und ändern ihr Wesen nach einiger Zeit insoweit, daß sie selbst bei Tage fressen. In der Neuzeit sind mehrere dieser gefangenen nach Europa gebracht worden. Der erste lebende Schwalm kam im Jahre 1862 nach London, ein zweiter im Jahre 1863 nach Amsterdam. Einen dritten erhielt ich selbst kurze Zeit darauf, und da ich außerdem in den letzten Jahren mehrere gepflegt und andere beobachtet habe, vermag ich aus eigener Erfahrung über das Gefangenleben des Vogels zu sprechen. Der erste, den ich besaß, war so zahm, daß er mir nicht nur das Futter aus der Hand nahm, sondern auch ohne Widerstreben sich ergreifen, auf die Hand setzen und im Zimmer umhertragen ließ, ohne daß er Miene machte, seinen Platz zu verlassen. Aber auch alle übrigen zeichneten sich durch stille Ruhe und behäbige Trägheit aus. Bei Tage sitzt der gefangene Schwalm, wie er in der Freiheit gewohnt, regungslos auf einer und derselben Stelle in der von Gould beschriebenen Haltung; so tief, wie genannter Forscher behauptet, schläft er aber nicht, läßt sich vielmehr schon durch Anrufen ermuntern, und wenn sein Pfleger sich an ihn wendet, ist er sogleich bei der Hand. Von meinem ersten Pfleglinge vernahm ich anfänglich nur ein leises Brummen, einem langgezogenen »Humm« etwa vergleichbar, vermutete, daß dieser sonderbare Laut sein Lockruf sei, und versuchte durch Nachahmung desselben seine Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Der Erfolg übertraf meine Erwartungen; denn der Schwalm rührte sich nicht nur nach dem Anrufe, sondern antwortet auch sofort, und zwar regelmäßig, sooft ich meinen Versuch wiederholte. Hielt man ihm dann eine Maus oder einen kleinen Vogel vor, so bewegte er sich wiegend hin und her, brummte lebhafter, richtete die weitgeöffneten Augen starr auf den leckeren Bissen und flog schließlich auch von seiner Stange herab, um diesen in Empfang zu nehmen. Fette Maden, die ich ihm zuweilen reichte, wurden von ihm nicht bloß aufgelesen, sondern auch aus dem Sande hervorgezogen. Er verschlingt seine Beute ganz und ist fähig, eine große Maus oder einen feisten Sperling, von dem die Flügel entfernt sind, hinabzuwürgen. Letzteres geschieht sehr langsam: von einer verschlungenen Maus z. B. ragt die Schwanzspitze oft eine halbe Stunde lang aus seinem Schnabel hervor, bevor sie verschwindet. Seine Verdauung ist vortrefflich; man findet deshalb auch nur selten kleine Gewölle im Käfige. Daß er bei Tage nicht bloß gut, sondern auch scharf in die Ferne sieht, konnte ich wiederholt beobachten. Der eine, den ich pflegte, vermochte von seinem Käfige aus einen Teich zu überblicken, auf dem Wasservögel umherschwammen. Sie erregten sehr oft seine Aufmerksamkeit; namentlich die auf das Wasser einfallenden Flugenten schienen ihn anzuziehen. Er sah scharf nach ihnen hin und bewegte seinen Kopf nach Art des Käuzchens hin und her oder auf und nieder, wie er überhaupt tat, wenn er seine Erregung kundgeben wollte. Nach Sonnenuntergang wird der Schwalm lebhafter, bewegungslustig zeigt er sich jedoch auch dann nicht. Nachdem er gefressen hat, bleibt er mehr oder weniger ruhig auf seinem Platze sitzen; aber er brummt dann öfter als sonst und auch in anderer Weise. Seine Stimme wird hörbarer, und die einzelnen Laute ertönen mehr im Zusammenhang. Dann gleicht das Gebrumme allerdings dem Ruksen einer Taube, am täuschendsten dem eines Trommlers.
Sehr auffallend gebärdete sich mein gefangener Schwalm, als ich ihn in einen kleinen Käfig mit Vögeln setzte. Er mochte sich erinnern, daß er während seines Freilebens mancherlei Anfechtungen von dergleichen Gesindel erlitten hatte und oft als Eule angesehen worden war. Als er sich in so zahlreicher Gesellschaft sah, streckte er sich lang aus, indem er den Hals weit vorschob und den Schnabel so richtete, daß er die eine, der Schwanz die andere Spitze des gerade gehaltenen Leibes bildete. Dabei stieß er ein, von seinem Gebrumme durchaus verschiedenes Geschrei aus, das durch die Silben »Krä, krä, krärä, kräkä, kräkä, kräkäkäk« ungefähr ausgedrückt werden kann. Ab und zu sperrte er auch das Maul weit auf, gleichsam in der Absicht, die Vögel zu schrecken, wie überhaupt sein ganzes Gebaren mehr auf Abwehr als auf Lust zum Angriff deutete. Einen Sperling, der ihm zu nahe kam, packte er mit dem Schnabel und schüttelte ihn tüchtig hin und her; doch gelang es dem Spatz, wieder frei zu kommen. Mit mehreren andern Sperlingen war er tagelang zusammengesperrt, hatte sich aber nicht an ihnen vergriffen. Demungeachtet zweifle ich nicht im geringsten, daß er Vögel frißt; junge, unbehilfliche nimmt er höchstwahrscheinlich ohne Umstände aus den Nestern.
*
In Südamerika leben riesige Nachtschwalben, die sich wegen ihres sehr kräftigen und hakigen Schnabels sowie der derben Füße, deren Mittelzehen keinen gezahnten Nagel tragen, den Schwalmen enger anschließen als den Nachtschatten und deshalb der ersten Unterfamilie zugezählt oder als Vertreter einer gleichwertigen Gruppe angesehen werden. Die von ihnen gebildete Sippe der Schwalke oder Riesennachtschwalben ( Nyctibius) kennzeichnet sich durch folgende Merkmale: Der Leib ist kräftig, der Kopf ungewöhnlich groß, der Flügel, in dem die dritte Schwinge alle andern überragt, lang und spitzig, der Schwanz verhältnismäßig lang und schwach zugerundet, das Gefieder reich, weich und locker. Dies alles ist wie bei den Nachtschwalben; der Schnabel aber weicht bedeutend ab. Auch er ist von oben gesehen dreieckig, an der Wurzel ungemein breit, bis zu den Nasenlöchern hin gleichmäßig abfallend, von hier aus in einen dünneren, rundlichen Nagel zusammengedrückt, der sich sanft bogenförmig über den Unterschnabel herabwölbt und dessen Spitze mit herabbiegt, obwohl letztere zu seiner Aufnahme ausgehöhlt und deshalb bedeutend kürzer ist; der scharfe Mundrand trägt einen linienlangen Zahn, der da hervortritt, wo der Haken beginnt; der Schnabelspalt öffnet sich bis unter das Ohr, und die Rachenöffnung ist deshalb erstaunlich groß. Vom hornigen Teile des Schnabels sieht man übrigens wenig, weil der größte Teil, der Oberschnabel bis zu den Nasenlöchern, der Unterschnabel bis gegen die Spitze hin befiedert ist. Viele Federn am Schnabelgrunde sind zu feinen Borsten umgestaltet. Die Beine sind kurz, ihre Zehen schlank, die Nägel mäßig groß, etwas bogig; der mittlere zeigt einen scharf vortretenden Rand.
Der Riesenschwalk ( Nyctibius grandis), die größte Art der Sippe, ist von den Guaranern »Ibijau«, zu deutsch »Erdfresser«, genannt worden, und jener Name in unsere Lehrbücher übergegangen. Seine Länge beträgt nach den Messungen des Prinzen von Wied 55 Zentimeter, die Breite 1,25 Meter, die Fittichlänge 40, die Schwanzlänge 27 Zentimeter. Das Gefieder der Oberseite zeigt auf fahlweißlichem Grunde sehr feine, dunkle Zickzackquerbinden, rostbraune Endsäume und dunkle Schaftstriche; Kinn und Kehle sind rostrotbraun, die oberen Flügeldecken längs des Unterarmes rotbraun mit dichtstehenden schwarzen, die Unterflügeldecken schwarz mit fahlweißen Querbinden geziert. Der Schnabel ist gelblichhorngrau, das Auge dunkelschwarzbraun, der Fuß gelblichgrau.
Es scheint, daß der Ibijau in allen Wäldern Südamerikas gefunden wird: man hat ihn ebensowohl in Cayenne wie in Paraguay erlegt. Wahrscheinlich ist er nicht so selten, als man gewöhnlich annimmt; es hält aber schwer, ihn bei Tage zu entdecken oder des Nachts zu beobachten. Prinz von Wied und Burmeister geben übereinstimmend an, daß er tagüber immer in dicht belaubten Kronen der höchsten Bäume sitzt, nach anderer Nachtschatten Art der Länge nach auf einen starken Ast gedrückt. Sein Baumrindengefieder ist sein bester Schutz gegen das suchende Auge des Jägers oder eines anderen Feindes, und seine Regungslosigkeit erschwert noch außerdem das Auffinden. Azara beschreibt unter dem Namen »Urutau« einen verwandten Schwalk und sagt, daß er seinen Sitz gewöhnlich am Ende eines abgestorbenen Astes wählte, so daß er mit dem Kopfe über demselben hervorsehe und den Ast dadurch gleichsam verlängere, demungeachtet aber außerordentlich schwer zu entdecken sei. Ist solches einmal geschehen, so verursacht es keine Mühe, den schlafenden Vogel zu erbeuten, vorausgesetzt, daß er sich nicht einen sehr hohen Ruhesitz erwählt hat. Von einer anderen Art erzählt der Prinz, daß seine Leute sie mit einem Stocke totgeschlagen haben, und bestätigt dadurch Azaras Angabe, nach der die Jäger Paraguays um die Mittagszeit dem Urutau eine Schlinge über den Kopf werfen und ihn dann vom Baume herabziehen. Auch Burmeister erfuhr Ähnliches. Er sah einen Ibijau frei unter der Krone eines der höchsten Bäume sitzen und feuerte wiederholt nach ihm, ohne den Vogel auch nur zum Fortfliegen bewegen zu können. Daß die größte Nachtschwalbe auch die dümmste ist, geht aus einer einfachen Untersuchung ihres Schädels hervor; denn die Hirnmasse des fast rabengroßen Ibijau kommt nach den Untersuchungen des Prinzen nur einer Haselnuß an Umfang gleich.
Ganz anders zeigt sich der Vogel in der Dämmerung. Er ist dann verhältnismäßig ebenso behend und gewandt wie alle übrigen. Eine ausführliche Beschreibung seines Betragens ist mir allerdings nicht bekannt; doch nehme ich keinen Anstand, dasjenige, was der Prinz von einer nahe verwandten Art anführt, auch auf den Ibijau zu beziehen. »Die unbeschreiblich angenehmen Mondnächte heißer Länder sind oft im höchsten Grade hell und klar und gestatten dem Jäger, auf weithin mit ziemlicher Schärfe zu sehen. In solchen Nächten gewahrt man die Ibijaus, in großer Höhe gleich den Adlern dahinschwebend und weite Strecken durchfliegend, mit dem Fange großer Abend- und Nachtfalter sich beschäftigend. Es gibt in Brasilien eine Menge sehr großer Schmetterlinge, die eben nur ein so ungeheurer Rachen zu bewältigen weiß; diese Schmetterlinge aber haben in den Riesenschwalben ihre furchtbarsten Feinde und werden von ihnen in Menge verzehrt. Die Spuren der von den Mahlzeiten zurückbleibenden Schmetterlingsflügel, die nicht mit verschluckt werden, findet man oft massenhaft auf dem Boden der Waldungen.« Bei diesen Jagden setzen sich, wie Azara mitteilt, die Riesenschwalke selten auf die Erde, und wenn es geschieht, breiten sie ihre Flügel aus und stützen sich auf sie und den Schwanz, ohne sich ihrer Füße zu bedienen.
Azara sagt, daß der Urutau in hohlen Bäumen, Burmeister, daß er in ausgehöhlten, offenen Baumästen niste und in eine kleine Vertiefung zwei braune, dunkler gefleckte Eier auf das bloße Holz lege. Letzterer erhielt auch eines der Eier. Es war länglich rund, am dicken Ende kaum stumpfer als am spitzen, glanzlos und auf reinweißem Grunde mit graubraunen, lederbraunen und schwarzbraunen Spritzpunkten besetzt, die gegen das eine Ende hin am dichtesten sich zusammendrängten.
Über das Betragen gefangener Schwalke geben Azara und Gosse Auskunft. Zu Ende Dezember erhielt erstgenannter einen altgefangenen Vogel dieser Art und fütterte denselben mit klein gehacktem Fleische, bei welcher Nahrung er bis zum März aushielt. Als um diese Zeit die Winterkälte eintrat, wurde er traurig und verweigerte eine ganze Woche lang jegliche Nahrung, so daß sich Azara entschloß, ihn zu töten. Dieser gefangene saß den ganzen Tag über unbeweglich auf einer Stuhllehne, die Augen geschlossen; mit Einbruch der Dämmerung aber und in den Frühstunden flog er nach allen Richtungen im Zimmer umher. Er schrie nur, wenn man ihn in die Hand nahm, dann aber stark und unangenehm, etwa wie »Kwa, kwa«. Näherte sich ihm jemand, um ihn zu ergreifen, so öffnete er die Augen und gleichzeitig den Rachen, so weit er konnte. Einen Potu, den man in einem waldigen Moraste gefunden hatte, pflegte Gosse mehrere Tage. Der Vogel blieb sitzen, wohin man ihn setzte, auf dem Finger ebensowohl wie auf einem Stocke, nahm hierbei aber niemals die bekannte Längsstellung der Ziegenmelker ein, setzte sich vielmehr in die Quer und richtete sich so hoch auf, daß Kopf und Schwanz in eine fast senkrechte Linie kamen. So saß er mit etwas gesträubtem Gefieder, eingezogenem Kopfe und geschlossenen Augen. Wurde er angestoßen, so streckte er den Hals aus, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, und öffnete die großen, glänzendgelben Augen, wodurch er mit einem Male einen höchst eigentümlichen Ausdruck gewann. Tagüber gebärdete er sich in der Regel, als ob er vollkommend blind wäre; wenigstens übte, auch wenn er mit offenen Lidern dasaß, das Hin- und Herbewegen eines Gegenstandes vor seinen Augen nicht den geringsten Eindruck aus. Die Behauptung Cuviers, daß die Verhältnisse der Schwalke sie vollständig untauglich machen, sich vom ebenen Boden zu erheben, sah ich widerlegt; denn mein Vogel erhob sich ungeachtet der Kürze seiner Fußwurzeln ohne alle Schwierigkeit von dem Fußboden des Raumes. Wenn er hier saß, waren seine Flügel gewöhnlich etwas gebreitet; wenn er auf einem Zweige hockte, erreichten sie ungefähr die Spitze des Schwanzes. Falls ich von dem wenigen, was ich über das Gebaren des freilebenden Potu beobachtet und meinem gefangenen abgelauscht habe, zu urteilen wagen darf, muß ich annehmen, daß er ungeachtet seiner kräftigen Schwingen wenig fliegt, vielmehr von einer Warte aus seine Jagd betreibt und nach geschehenem Fange nächtlicher Kerbtiere wiederum zu seinem Sitze zurückkehrt. Da mein Potu nichts fressen wollte, entschloß ich mich ihn zu töten, um ihn meiner Sammlung einzuverleiben. Um ihn umzubringen, drückte ich ihm die Luftröhre zusammen, fand aber, daß ich mit aller Kraft meiner Finger sie nicht so weit zusammenpressen konnte, um ihn am Atemholen zu verhindern. Ich war deshalb genötigt, ihm einige Schläge auf den Kopf zu versetzen. Während er, sehr gegen mein Gefühl, diese Streiche empfing, stieß er ein kurzes, heiseres Krächzen aus. Mit dieser einzigen Ausnahme war er bis dahin während der ganzen Zeit vollkommen stumm gewesen. Jede Belästigung hatte ihn gleichgültig gelassen und nur, wenn ich ihn wiederholt dadurch erregt hatte, daß ich ihm irgendeinen Gegenstand vorhielt, öffnete er zuweilen seinen ungeheuren Rachen, anscheinend um mich zurückzuschrecken, zeigte jedoch niemals die Absicht, irgend etwas zu ergreifen.«
*
In tiefen Felshöhlen oder Felsschluchten der Gebirge Mittelamerikas lebt ein wunderbarer Vogel, der in Gestalt und Wesen allerdings die hauptsächlichen Merkmale der Nachtschwalben und zumal der Riesen dieser Familie zeigt, sich jedoch demungeachtet ein durchaus selbständiges Gepräge bewahrt und deshalb als Urbild einer besonderen, nach ihm benannten Unterfamilie, der Fettschwalke ( Steatornithinae), angesehen wird.

Guacharo (Steatornis coripensis)
Der Fettschwalk oder Guacharo der Venezuelaner ( Steatornis caripensis) erreicht eine Länge von fünfundfünfzig Zentimeter und doppelte Breite. Sein Leib ist sehr schlank, der Kopf breit, der Schnabel länger als breit und frei, längs der Firste in starkem Bogen hinabgekrümmt und zu einer vorragenden, überhängenden Spitze ausgezogen, der Fuß sehr kräftig, der Lauf kurz und nackt, der Flügel sehr lang mit weit vorragender Spitze. Der Schwanz ist bedeutend kürzer als der Flügel, stark abgerundet und aus steifen, am Ende breiten Federn gebildet, das übrige Gefieder endlich hart und steif, in der Zügelgegend zu langen, den Schnabel überragenden Borsten umgestaltet, so daß das Gesicht wie bei den Eulen mit einem Schleier umgeben wird. Kleine Borstenfedern besetzen auch das Lid und schützen das große, halbkugelige Auge. Eine Fettschicht breitet sich unter der Haut aus und umgibt die Eingeweide in solcher Stärke, daß man sagen kann, sie seien in Fett eingebettet. Die Färbung des Gefieders ist ein schönes dunkelgezeichnetes und stellenweise gelbweißgeflecktes Kastanienbraun. Das Auge ist dunkel-, der Schnabel rötlichbraun, der Fuß gelbbräunlich. Beide Geschlechter unterscheiden sich nicht durch die Färbung.
Alexander von Humboldt entdeckte den Guacharo im Jahre 1799 in der großen Felsenhöhle von Caripe; spätere Reisende fanden ihn aber auch in anderen dunklen Felsklüften oder Höhlungen, wie solche in den Anden sehr häufig vorkommen. Die Kunde, die wir über das Leben und Treiben des merkwürdigen Vogels erhalten haben, ist ziemlich ausführlich; doch bleibt immerhin noch manches aufzuklären. Gewiß ist, daß man keinen Vogel weiter kennt, der lebt wie der Guacharo.
»In einem Lande«, sagt Humboldt, »wo man so großen Hang zum Wunderbaren hat, ist eine Höhle, aus der ein Strom entspringt, und in der Tausende von Nachtvögeln leben, mit deren Fett man in den Missionen kocht, natürlich ein unerschöpflicher Gegenstand der Unterhaltung und des Streites. Kaum hat daher der Fremde in Cumana den Fuß ans Land gesetzt, so hört er zum Überdrusse vom Augensteine von Araya, vom Landmanne in Arenas, der sein Kind gesäugt, und von der Höhle der Guacharos, die mehrere Meilen lang sein soll. Lebhafte Teilnahme an Naturmerkwürdigkeiten erhält sich überall, wo in der Gesellschaft kein Leben ist, wo in trübseliger Eintönigkeit die alltäglichen Vorkommnisse sich ablösen, bei denen die Neugierde keine Nahrung findet.
Die Höhle, die die Einwohner eine Fettgrube nennen, liegt nicht im Tal von Caripe selbst, sondern drei kleine Meilen vom Kloster gegen Westsüdwest. Sie mündet in einem Seitentale aus, das der Sierra de Guacharo zuläuft. Am achtzehnten September brachen wir nach der Sierra auf, begleitet von den indianischen Alcalden und den meisten Ordensmännern des Klosters. Ein schmaler Pfad führte zuerst anderthalb Stunden lang südwärts über lachende, schön begraste Ebenen; dann wandten wir uns westwärts an einem kleinen Flusse hinauf, der aus der Höhle hervorkommt. Man geht dreiviertel Stunden lang aufwärts, bald im Wasser, das nicht tief ist, bald zwischen dem Flusse und einer Felswand aus sehr schlüpfrigem, morastigem Boden. Zahlreiche Erdfälle, umherliegende Baumstämme, über die die Maultiere nur schwer hinüberkommen, machen dieses Stück des Weges sehr ermüdend.
Wenn man am Fuße des hohen Guacharoberges nur noch vierhundert Schritte von der Höhle entfernt ist, sieht man den Eingang noch nicht. Der Bach läuft durch eine Schlucht, die das Wasser eingegraben, und man geht unter einem Felsenüberhange, so daß man den Himmel gar nicht sieht. Der Weg schlängelt sich mit dem Flusse, und bei der letzten Biegung steht man auf einmal vor der ungeheuren Mündung der Höhle. Der Anblick hat etwas Großartiges selbst für Augen, die mit der malerischen Szenerie der Hochalpen vertraut sind, denn der gewaltige tropische Pflanzenwuchs verleiht der Mündung eines solchen Erdlochs ein ganz eigenes Gepräge. Die Guacharohöhle öffnet sich an einer senkrechten Felsenwand. Der Eingang ist nach Süden gekehrt; es ist eine Wölbung fünfundzwanzig Meter breit und zweiundzwanzig Meter hoch. Aus dem Felsen über der Grotte stehen riesenhafte Bäume; der Mamei und der Genipabaum mit breiten, glänzenden Blättern strecken ihre Äste gerade gen Himmel, während die des Courbaril und der Erythrina sich ausbreiten und ein dichtes grünes Gewölbe bilden. Pothos mit saftigen Stengeln, Oxalis und Orchideen von seltsamem Bau wachsen in den dürrsten Felsspalten, während vom Winde geschaukelte Rankengewächse sich vor dem Eingange der Höhle zu Gewinden verschlingen. Welch ein Gegensatz zwischen dieser Höhle und jenen im Norden, die von Eichen und düsteren Lärchen beschattet sind!
Aber diese Pflanzenpracht schmückt nicht allein die Außenseite des Gewölbes; sie dringt sogar in den Vorhof der Höhle ein. Mit Erstaunen sahen wir, daß sechs Meter hohe, prächtige Helikonien mit Pisangblättern, Pragapalmen und baumartige Arumaten die Ufer des Baches bis unter die Erde säumten. Die Pflanzenwelt zieht sich in die Höhle von Caripe hinein wie in die tiefen Felsspalten in den Anden, in denen nur ein Dämmerlicht herrscht, und sie hört erst dreißig bis vierzig Schritte vom Eingang auf. Wir maßen den Berg mittels eines Strickes und waren gegen anderthalbhundert Meter weit gegangen, ehe wir nötig hatten, die Fackeln anzuzünden. Das Tageslicht dringt so weit ein, weil die Höhle nur einen Gang bildet, der sich in derselben Richtung von Südost nach Nordwest hineinzieht. Da, wo das Licht zu verschwinden anfängt, hört man das heisere Geschrei der Nachtvögel, die, wie die Eingeborenen glauben, nur in diesen unterirdischen Räumen zu Hause sind.
Schwer macht man sich einen Begriff von dem furchtbaren Lärm, den Tausende dieser Vögel im dunkeln Innern der Höhle verursachen. Er läßt sich nur mit dem Geschrei unserer Krähen vergleichen, die in den nordischen Tannenwäldern gesellig leben und auf Bäumen nisten, deren Wipfel einander berühren. Das gellende, durchdringende Geschrei der Guacharos hallt wider vom Felsgewölbe, und aus der Tiefe der Höhle kommt es als Echo zurück. Die Indianer zeigten uns die Nester der Vögel, indem sie Fackeln an eine lange Stange banden. Sie staken zwanzig bis dreiundzwanzig Meter hoch über unsern Köpfen, in trichterförmigen Löchern, von denen die Decke wimmelt. Je tiefer man in die Höhle hineinkommt, je mehr Vögel das Licht der Kopalfackeln aufscheucht, desto stärker wird der Lärm. Wurde es ein paar Minuten ruhiger um uns her, so erschallte von weither das Klagegeschrei der Vögel, die in andern Zweigen der Höhle nisteten. Die Banden lösten sich im Schreien ordentlich ab.
Der Guacharo verläßt die Höhle bei Einbruch der Nacht, besonders beim Mondschein. Er frißt sehr harte Samen, und die Indianer behaupten, daß er weder Käfer noch Nachtschmetterlinge angehe; auch darf man nur die Schnäbel des Guacharo und des Ziegenmelkers vergleichen, um zu sehen, daß beider Lebensweise ganz verschieden sein muß.
Jedes Jahr um Johannistag gehen die Indianer mit Stangen in die Cueva del Guacharo und zerstören die meisten Nester. Man schlägt jedesmal mehrere tausend Vögel tot, wobei die alten, als wollten sie ihre Brut verteidigen, mit furchtbarem Geschrei den Indianern um die Köpfe fliegen. Die jungen, die zu Boden fallen, werden auf der Stelle ausgeweidet. Ihr Bauchfell ist stark mit Fett durchwachsen, und eine Fettschicht läuft vom Unterleibe zum After und bildet zwischen den Beinen des Vogels eine Art Knopf. Daß körnerfressende Vögel, die dem Tageslichte nicht ausgesetzt sind und ihre Muskeln wenig brauchen, so fett werden, erinnert an die uralten Erfahrungen beim Mästen der Gänse und des Viehes: man weiß, wie sehr dasselbe durch Dunkelheit und Ruhe befördert wird. Die europäischen Nachtvögel sind mager, weil sie nicht, wie der Guacharo, von Früchten, sondern vom dürftigen Ertrage ihrer Jagd leben. Zur Zeit der ›Fetternte‹, wie man in Caripe sagt, bauen sich die Indianer aus Palmblättern Hütten am Eingange oder im Vorhofe der Höhle. Wir sahen noch Überbleibsel derselben. Hier läßt man das Fett der jungen, frisch getöteten Vögel am Feuer aus und gießt es in Tongefäße. Dieses Fett ist unter dem Namen Guacharoschmalz oder -öl bekannt. Es ist halbflüssig, hell und geruchlos, und so rein, daß man es länger als ein Jahr aufbewahren kann, ohne daß es ranzig wird. In der Klosterküche zu Caripe wurde kein anderes Fett gebraucht als das aus der Höhle, und wir haben nicht bemerkt, daß die Speisen irgendeinen unangenehmen Geruch oder Geschmack davon bekämen.
Die Menge des gewonnenen Öles steht mit dem Gemetzel, das die Indianer alle Jahre in der Höhle anrichten, in keinem Verhältnis. Man bekommt, scheint es, nicht mehr als einhundertfünfzig bis einhundertsechzig Flaschen ganz reines Fett; das übrige, weniger helle wird in großen irdenen Gefäßen aufbewahrt. Dieser Gewerbszweig der Eingeborenen erinnert an das Sammeln des Taubenfettes in Carolina, von dem früher mehrere tausend Fässer gewonnen wurden. Der Gebrauch des Guacharofettes ist in Caripe uralt, und die Missionare haben nur die Gewinnungsart geregelt. Die Mitglieder einer indianischen Familie behaupten, von den ersten Ansiedlern im Tale abzustammen, und als solche rechtmäßige Eigentümer der Höhle zu sein: sie beanspruchen das Alleinrecht des Fettes; aber infolge der Klosterzucht sind ihre Rechte gegenwärtig nur noch Ehrenrechte. Nach dem System der Missionare haben die Indianer Guacharoöl für das ewige Kirchenlicht zu liefern; das übrige, so behauptet man, wird ihnen abgekauft.
Das Geschlecht der Guacharos wäre längst ausgerottet, wenn nicht mehrere Umstände zur Erhaltung desselben zusammenwirkten. Aus Aberglauben wagen sich die Indianer selten weit in die Höhle hinein. Auch scheint derselbe Vogel in benachbarten, aber dem Menschen unzugänglichen Höhlen zu nisten. Vielleicht bevölkert sich die große Höhle immer wieder mit Siedlern, die aus jenen kleinen Erdlöchern ausziehen; denn die Missionare versicherten uns, bis jetzt habe die Menge der Vögel nicht merkbar abgenommen.
Man hat junge Guacharos in den Hafen von Cumana gebracht; sie lebten da mehrere Tage, ohne zu fressen, da die Körner, die man ihnen gab, ihnen nicht zusagten. Wenn man in der Höhle den jungen Vögeln Kropf und Magen aufschneidet, findet man mancherlei harte, trockene Samen darin, die unter dem seltsamen Namen ›Guacharosamen‹ ein vielberufenes Mittel gegen Wechselfieber sind. Die Alten bringen diese Samen den Jungen zu. Man sammelt sie sorgfältig und läßt sie den Kranken in Cariaco und andern tiefgelegenen Fieberstrichen zukommen.
Die Höhle von Caripe behält auf vierhundertzweiundsechzig Meter dieselbe Richtung, dieselbe Breite und die anfängliche Höhe. Wir hatten viele Mühe, die Indianer zu bewegen, daß sie über das vordere Stück hinausgingen, das allein sie jährlich zum Fettsammeln besuchen. Es bedurfte des ganzen Ansehens der Geistlichen, um sie bis zu der Stelle zu bringen, wo der Boden rasch unter einem Winkel von sechzig Grad steigt und der Bach einen unterirdischen Fall bildet. Je mehr die Decke sich senkte, um so gellender wurde das Geschrei der Guacharos, und endlich konnte kein Zureden die Indianer vermögen, noch weiter in die Höhle hineinzugehen. Wir mußten uns der Feigheit unserer Führer gefangengeben und umkehren. Auch sah man überall so ziemlich das nämliche.
Diese von Nachtvögeln bewohnte Höhle ist für die Indianer ein schauerlich geheimnisvoller Ort; sie glauben, tief hinten wohnen die Seelen ihrer Vorfahren. Der Mensch, sagen sie, soll Scheu tragen vor Orten, die weder von der Sonne, Zis, noch vom Monde, Nuna, beschienen werden. Zu den Guacharos gehen, heißt soviel, als zu den Vätern versammelt werden, sterben. Daher nehmen auch die Zauberer, Piaches, und die Giftmischer, Imorons, ihre nächtlichen Gaukeleien am Eingange der Höhle vor, um den Obersten der bösen Geister, Ivorokiamo, zu beschwören. So gleichen sich unter allen Himmelsstrichen die ältesten Mythen der Völker, vor allem solche, die sich auf zwei die Welt regierende Kräfte, auf den Aufenthalt der Seelen nach dem Tode, auf den Lohn der Gerechten und die Strafe der Bösen beziehen. Die Höhle von Caripe ist der Tartarus der Griechen, und die Guacharos, die unter kläglichem Geschrei über dem Wasser flattern, mahnen an die stygischen Vögel.«
Groß besuchte die Schlucht von Icononzo in Neugranada, die einen Sandsteinfelsen durchbricht, gegen eine halbe englische Meile lang, zehn bis zwölf Meter breit ist und in der Tiefe von achtzig bis hundert Meter von einem wilden Bergstrome durchtost wird. In der grauenhaften Tiefe, aus der das Toben des Stromes dumpf heraufhallt, unmittelbar über den mit rasender Eile dahinstürzenden Wellen, hausen ebenfalls Guacharos. Groß ließ sich an Seilen hinab, fußte auf einem schmalen Vorsprunge und wurde sofort von einer Unzahl der nächtlichen Vögel förmlich angefallen, weil es galt, die Nester zu verteidigen. Die gespensterhaften Tiere umschwirrten den Forscher so nahe, daß sie ihn im Vorüberfliegen mit den Flügelspitzen berührten, und das Geschrei der Hunderte und Tausende dieser Tiere war geradezu betäubend. Groß erlegte in weniger als einer Stunde gegen vierzig Guacharos, die am Ausgange der Schlucht aufgestellten Indianer fanden aber nicht einen einzigen derselben in den Wellen des Flusses auf; deshalb ließ Groß im nächsten Jahre in der Tiefe des Spaltes ein Netz aufspannen, dazu bestimmt, die von ihm getöteten und herabstürzenden Vögel aufzufangen. Auf diese Weise gelang es ihm, mehrere Guacharos zu erhalten. Die Beobachtungen, die gelegentlich dieser Jagd angestellt wurden, lassen sich in der Kürze zusammenstellen, wie folgt:
Der Fettschwalk schwebt leichten Fluges rasch dahin und breitet dabei Flügel und Schwanz fächerförmig aus, ohne viel mit den Flügeln zu schlagen. Jede andere Bewegung erscheint äußerst unbehilflich. Der Gang ist ein trauriges Fortkriechen, wobei der Vogel seine Flügel mit zu Hilfe nehmen muß. Im Sitzen erhebt er den Vorderteil des Leibes, senkt aber den Kopf so tief nach unten daß es aussieht, als hinge derselbe einfach herab; gewöhnlich stützt er sich dazu noch auf die Handgelenke seiner beiden Flügel. Beim Fortkriechen richtet er den Schwanz ein wenig auf, schiebt den Kopf vorwärts und sucht sich durch allerlei Schwenkungen und sonderbare schlangenhafte Bewegungen des Kopfes und Halses im Gleichgewicht zu erhalten. Fliegend und noch mehr bei Erregung läßt er seine heiser krächzende, aber doch laute Stimme hören, die so eigentümlich und widerlich ist, daß sie auch in einer freundlicheren Umgebung unangenehm oder grauenhaft wirken müßte. Die Nahrung besteht gewiß aus Früchten, deren Körner jedoch nicht ausgespien, sondern mit dem Kote ausgeschieden werden. Um die Nester herum häufen die freßwütigen Jungen nach und nach Schichten von Kot und Samen an, die bis fünfundzwanzig Zentimeter hoch werden können und allerdings wie die Wände eines Napfes erscheinen. Aus Lehm oder ähnlichen Stoffen erbaut sich der Guacharo sein Nest nicht. Er legt seine weißen birnförmigen Eier ohne jegliche Unterlage in Felsenritzen, Männchen und Weibchen brüten abwechselnd. Die Jungen sind Mißgestalten der traurigsten Art; sie vermögen sich auch nicht eher zu bewegen, als bis ihr Gefieder sich vollkommen entwickelt hat. Ihre Gefräßigkeit ist ungeheuer groß. Wenn sie erregt werden, fallen sie einander wütend an, packen mit ihrem Schnabel alles, was in den Bereich desselben gerät, sogar ihre eigenen Füße oder Flügel, und lassen das einmal Ergriffene nur höchst ungern wieder los. Groß versuchte einige von denen, die er aus den Nestern nahm, aufzuziehen, war jedoch nicht imstande, die geeignete Nahrung herbeizuschaffen, und verlor deshalb seine Gefangenen nach wenigen Tagen wieder.
»Die Nester«, so berichtet neuerdings Göring, »hatten mehr oder weniger die Form eines trockenen Kuhfladens von dunkelbrauner Farbe. Die Masse bestand aus der lockeren Erde von dem Grunde der Höhle und taubeneigroßem Samen, die die Guacharos wieder von sich gegeben hatten. Die Form des Nestes richtet sich natürlich nach den Ritzen, den Vertiefungen, Höhlungen, in die diese Vögel bauen. Ich habe nur zwei Eier angetroffen. Von dem unbeholfenen Körper eines jungen Guacharo kann man sich kaum eine Vorstellung machen. Der ganze Vogel ist nur ein unbeschreiblicher Fettklumpen. Ich zergliederte mehrere von ihnen und fand, daß ihre Magen bereits mit fast taubeneigroßem Samen gefüllt und dieser in eine feuchte, blaß rosenfarbige Masse gehüllt war. Alle Fettklumpen, wie ich die Jungen nennen will, um sie am besten zu bezeichnen, hatten weißgelbliche Färbung und zeigten nur die ersten Spuren von Federn. Einige von den Nestjungen haben wir gegessen. Sie waren so außerordentlich fett, wie ihr äußeres Ansehen vermuten ließ, und es wurden deshalb auch nur einzelne Teile ihrer zerstückelten Leiber in der Suppe mit abgekocht, um diese zu schmalzen. In den Augen der Chacmas aber galten die Jungen als ein außerordentlich schmackhaftes Gericht.«
Unsere Nachtschwalbe, der Nachtschatten, Tagschläfer, Ziegenmelker, und wie er sonst noch genannt wird ( Caprimulgus europaeus), vertritt die letzte gleichnamige Unterfamilie ( Caprimulginae). Die Merkmale der hier zuerst zu nennenden Sippe der Nachtschatten ( Caprimulgus) entsprechen im allgemeinen der weiter oben gegebenen Gesamtbeschreibung. Die Länge der Nachtschwalben beträgt sechsundzwanzig, die Breite fünfundfünfzig, die Fittichlänge neunzehn, die Schwanzlänge zwölf Zentimeter. Das Gefieder ist oberseits auf bräunlichgrauem Grunde mit äußerst feinen, helleren oder dunkleren Pünktchen dicht bespritzt und außerdem durch sehr schwarze Schaftstriche gezeichnet, die auf Oberkopf und Mantel sich verbreitern, an ihrem Außenrande rostbraune Bandflecke zeigen und längs des Scheitels einen, auf den Schultern zwei dunkle Längsstreifen bilden. Eine Querbinde über dem Flügel entsteht durch die breiten rostgelben Spitzen der mittleren Flügeldeckfedern. Die oberen Schwanzdecken zeigen auf grauem Grunde dunkle Zickzacklinien, die unteren rostfarbenen Flügeldecken dunkle Querbinden, Kinn, Kehle und Halsseiten, die rostfahle Färbung haben, schwärzliche Querlinien, die auf der übrigen Unterseite deutlicher und breiter werden und auf den unteren Schwanzdecken weiter auseinandertreten. Kropf und Brust sind auf schwarzbraunem Grunde fein graulich bespritzt, an den Seiten mit weißlichen Endflecken geziert. Ein großer weißgrauer, dunkel gewellter Querfleck nimmt die Unterkehle ein. Von den braunschwarzen Schwingen heben sich außen sechs rostgelbe, dunkel gemarmelte Querflecke, innen rostgelbe Querbinden ab, und die ersten drei Schwingen haben auf der Innenfahne außerdem noch einen großen weißen Mittelfleck. Die mittelsten beiden Schwanzfedern sind bräunlichgrau, dicht schwarz gemarmelt und mit neun schwarzen unregelmäßigen Querbinden, die übrigen Steuerfedern auf schwarzbraunem Grunde mit acht bis neun bräunlichgrauen, dunkel gemarmelten Fleckenquerbändern, die beiden äußersten Steuerfedern endlich mit breiten weißen Endflecken verziert. Die Iris ist tiefbraun, das Augenlid rot, der von schwarzen Rachenborsten umgebene Schnabel hornschwarz, der Fuß rötlichbraun. Das im allgemeinen düsterer gefärbte Weibchen unterscheidet sich vom Männchen dadurch, daß die ersten drei Schwingen auf der Innenfahne sowie die beiden äußersten Schwanzfedern am Ende anstatt weißer kleinere rostgelbliche Flecke tragen, und die jungen Vögel sind daran kenntlich, daß diese bezeichnenden Flecke ihnen gänzlich fehlen.
Die Nachtschwalbe verbreitet sich vom mittleren Norwegen an über ganz Europa und Westasien und besucht im Winter alle Länder Afrikas, da sie erst im Süden des Erdteiles Herberge zu nehmen scheint.
Im Südwesten Europas, insbesondere in Spanien, tritt zu der deutschen Art eine zweite, der Rothalsnachtschatten ( Caprimulgus ruficollis). Er ist merklich größer als der deutsche Verwandte; seine Länge beträgt einunddreißig, die Breite einundsechzig, die Fittichlänge zwanzig, die Schwanzlänge sechzehn Zentimeter. Sein Verbreitungsgebiet scheint ziemlich beschränkt zu sein. Als Brutvogel bewohnt er die Pyrenäenhalbinsel und Nordwestafrika, verfliegt sich aber gelegentlich seiner Wanderungen auch wohl bis nach Malta, Südfrankreich, und ist sogar schon in England beobachtet worden.
Wenn auch vielleicht nicht die häufigste, so doch die bekannteste Nachtschwalbe Nordamerikas ist der Klagenachtschatten, »Whip-poor-will« der Amerikaner ( Caprimulgus clamator). Er kommt unserm Ziegenmelker an Größe ungefähr gleich. Der in Amerika allbekannte Vogel verbreitet sich über die östlichen Vereinigten Staaten und besucht im Winter Mexiko und Südamerika.
Die Sippe der Schleppennachtschwalben ( Scotornis) unterscheidet sich von den beschriebenen Verwandten durch den Schnabel, der zwar im allgemeinen dieselbe Bildung zeigt wie bei den Nachtschatten, jedoch eine feinere, stärker herabgekrümmte Spitze und gegen die sehr verbreiterte Rachenspalte stark herabgezogene Schneidenränder besitzt, sowie ferner durch den sehr langen abgestuften Schwanz, dessen beide Mittelfedern ansehnlich vorragen. Der Lauf ist oben gefiedert, im übrigen mit vier Platten bedeckt, in dem langen Flügel überragen die zweite und die dritte Schwinge die übrigen.
Vertreter dieser Sippe ist die Schleppennachtschwalbe ( Scotornis longicaudus), ein zwar merklich kleinerer, aber viel längerer Vogel als unsere Nachtschwalbe. Die Länge beträgt vierzig, die Breite zweiundfünfzig, die Fittichlänge vierzehn, die Schwanzlänge fünfundzwanzig Zentimeter. Das Gefieder der Oberseite zeigt auf graubraunem Grunde die gewöhnlich aus äußerst feinen dunkleren oder helleren Spritzpünktchen bestehende Zeichnung. Soviel wir gegenwärtig mit Bestimmtheit anzugeben vermögen, bewohnt die Schleppennachtschwalbe ausschließlich Afrika. Einzelne verfliegen sich auch wohl bis Südeuropa.

Nachtschwalbe (Caprimulgus europaeus)
Bei andern Nachtschwalben ist der Schwanz beim Männchen sehr tief, beim Weibchen weniger ausfallend gegabelt, der Flügel lang und stark, seine vorderste Schwinge am Rande gekerbt wie bei den Eulen, der Schnabel sehr gestreckt, an der Spitze verhältnismäßig stark, der Fuß fein und zierlich gebaut, oben befiedert, unten getafelt. Man hat die hierher gehörigen Arten, die nur in Südamerika vorkommen, Wassernachtschatten ( Hydropsalis) genannt.
Die Leiernachtschwalbe ( Hydropsalis forcipatus) erreicht, da die äußerste Schwanzfeder fast dreimal solang ist als der Leib, achtundsechzig bis dreiundsiebzig Zentimeter an Länge; die Flügellänge beträgt vierundzwanzig, die Schwanzlänge fünfzig bis fünfundfünfzig Zentimeter. Die Grundfärbung des Gefieders ist ein dunkles Braun. Nach Burmeisters Angaben leben die Leierschwalben einsam im tiefen Walde, wie es scheint, nirgends häufig.
Endlich haben wir noch derjenigen Nachtschwalben zu gedenken, bei denen gewisse Flügelfedern eigentümlich entwickelt sind.
Flaggennachtschatten ( Cosmetornis) nennt man die Arten mit sehr schwachem, von kurzen Bartborsten umgebenem Schnabel, kurzem Schwanz und absonderlich gebildetem Flügel, in dem die ersten fünf Schwingen an Länge abnehmen, die sechste wiederum um etwas, die siebente bis zur Länge der ersten, die achte fast um die Fittichlänge und die neunte über alles Maß sich verlängern.
Die Flaggennachtschwalbe ( Cosmetornis vexillarius) ist etwas größer als unser Ziegenmelker, oberseits auf schwarzbraunem Grunde fein rostbraun punktiert, auf dem Oberkopfe durch schwarze, auf den Schultern und hinteren Armschwingen, mittelsten und größten Oberflügeldeckfedern durch hier merklich vergrößerte und neben rostgelben breiten Endflecken besonders hervortretende Schaftflecke, an den dunklen Kopfseiten durch rostfahle Querbinden und Flecken, auf den übrigen weißen Unterteilen endlich durch schmale, dunkle Querlinien gezeichnet. Die Schwingen sind schwarz, an der Wurzel schmal weiß, die achte und neunte graubraun, außen dunkler, am Schafte weiß, die Armschwingen schwarz mit weißem Endrande und rostgelber, durch zwei gelbe Querbinden gezierter Wurzel, die Schwanzfedern rostgelb, schwarz gemarmelt und siebenmal schwarz in die Quere gebändert. Die Iris ist tiefbraun, Schnabel schwärzlich, Füße hellbräunlich. Die Art bewohnt die Äquatorländer des inneren Afrika.
Ebendaher stammt auch der merkwürdigste aller Ziegenmelker, die Fahnennachtschwalbe oder »Vierflügelvogel« der Araber ( Macrodipteryx longipennis), Vertreter einer besonderen Sippe, die hinsichtlich der Bildung des Schnabels und der Füße von den übrigen Arten der Familie wenig, durch Flügel und Schwanz hingegen wesentlich von allen übrigen abweicht. Der Schwanz ist durch seine Kürze, der Flügel des Männchens durch eine auffallende Schmuckfeder ausgezeichnet. Dem Weibchen fehlt diese Feder gänzlich. Das Gefieder ist ziemlich düster; oberseits schwarzbraun bis rostbraun, durch rostfarbene Flecke getüpfelt, auf Kinn und Oberkehle rostgelb, auf den übrigen Unterteilen rostfarben, dunkel quer gebändert. Um den Hals läuft ein breites, dunkel rostbraunes, schwarz gewelltes Band. Die schwarzen Schwingen zeigen fünf Querbinden. Die Länge beträgt nur einundzwanzig, die Fittichlänge dagegen siebzehn, die Schwanzlänge zehn Zentimeter. Das Verbreitungsgebiet dehnt sich über ganz Mittel- und Westafrika aus.
Eine Lebensschilderung der vorstehend kurz beschriebenen Nachtschwalben kann im Grunde nichts anderes sein als die Ausführung des weiter oben über die Familie Mitgeteilten. Wie schon bemerkt, gehört die große Mehrzahl aller Nachtschwalben dem Walde, nicht aber dem dicht geschlossenen oder düsteren Urwalde an; sie erwählen sich im Gegenteil solche Waldungen, wo große Blößen mit dichter bestandenen Stellen abwechseln. Afrikas Steppenwaldungen, wo nur hier und da ein Baum oder ein Strauch steht, der übrige Boden aber mit hohem Gras bewachsen ist, müssen den Nachtschwalben als Paradies erscheinen; daraufhin deutet wenigstens das ungemein häufige Vorkommen der Vögel. Auch die südeuropäischen Waldungen, die sehr oft an jene Steppenwälder erinnern, sagen ihnen weit mehr zu als unsere geschlossenen Bestände. Meiden sie ja doch ängstlich fast unsere Laubwälder, obwohl diese unzweifelhaft weit reicher sind an Kerbtieren als die Nadelwaldungen, in denen sie ihr Sommerleben verbringen. Sie erscheinen auf dem Zuge in Waldungen aller Art oder in Gärten, suchen aber im Norden zum Brüten nur Nadelwälder auf. Die südeuropäische Art, der Rothalsnachtschatten, findet an den Gebirgswänden, wo Steinhalden mit spärlich bewachsenen Stellen abwechseln, vortreffliche Aufenthaltsorte, siedelt sich aber ebenso häufig in Baumpflanzungen und vorzugsweise in Olivenwäldern an. Die sandfarbigen Arten Ägyptens halten sich in dem Gestrüpp verborgen, das die Ufer des Nils bedeckt, da, wo die Wüste bis zum Strom herantritt, oder suchen sich in den mit Riedgras bewachsenen Flächen passende Versteckplätze. Auch die amerikanischen Arten scheinen ähnlichen Örtlichkeiten den Vorzug zu geben; doch erwähnen die Reisenden, daß einzelne Arten selbst in dem eigentlichen Urwalde vorkommen, bei Tage in den dicht belaubten Kronen der Bäume sich verbergen, bei Nacht aber Waldpfade und Waldblößen aufsuchen oder dicht über den Kronen der Bäume ihre Jagd betreiben.
Man darf annehmen, daß die große Mehrzahl aller Nachtschwalben auf dem Boden ruht und sich nur ausnahmsweise auf Baumzweigen niederläßt. Nachts bäumen alle Arten viel häufiger als während des Tages, obgleich immerhin einzelne in dieser Zeit auf Baumästen zubringen. Der Grund dieser entschiedenen Bevorzugung des flachen Bodens ist unschwer zu erkennen; der Nachtschatten stellt besondere Ansprüche an den Zweig, auf dem er sich niederlassen will; denn er verlangt einen ihm in jeder Hinsicht bequemen Ruhesitz. Kein einziger dieser Vögel setzt sich querüber auf einen Zweig, sondern stets der Länge nach, so daß Ast und Leib in dieselbe Richtung kommen und letzterer aus ersterem ruht. Nur wenn ein Ziegenmelker aus seinem tiefsten Schlaf aufgeschreckt wird, und sich einem Baum zuwendet, setzt er sich nach anderer Vögel Weise auf Zweige nieder; ein solches Sitzen ist ihm aber so zuwider, daß er baldmöglichst einen neuen, bequemeren Platz aufsucht. »Bei meiner von großen Kiefernwäldern umschlossenen, einsam gelegenen Wohnung«, schreibt mir Vielitz, »sind Nachtschwalben recht häufig, und ich habe oft Gelegenheit gehabt, dieselben zu beobachten. An schönen Sommerabenden umgaukeln einzelne dieser Vögel das Gehöft in unmittelbarer Nähe, halten sich rüttelnd vor dem im Freien Sitzenden, um ihn neugierig anzustaunen, und verschwinden geräuschlos, um im nächsten Augenblick wieder aufzutauchen. Verhält man sich ganz unbeweglich, so setzt sich der Vogel hier und da auf eine freie kiesige Stelle, bleibt, den Leib flach auf den Boden gedrückt, unbeweglich wie ein Stück Baumrinde einen Augenblick beobachtend sitzen und beginnt, wenn er alles in Ordnung findet, nunmehr sich fortzubewegen, um von dem nackten Boden hier und da etwas aufzunehmen. Er durchtrippelt dabei gewöhnlich nur ganz kurze Strecken fünfzehn, höchstens zwanzig Zentimeter ohne Unterbrechung, hält an, nimmt etwas vom Boden auf, verweilt wieder einen Augenblick in ruhiger Beobachtung und geht weiter. Auf diese Weise durchwandert er kreuz und quer oft eine Viertelstunde lang die ihm, wie es scheint, sehr zusagenden Kiesstellen. Ich habe ihn oft auf dem Platz vor meiner Haustreppe, die vier und sechs Meter mißt, beobachtet, indem ich auf der untersten Stufe Platz genommen hatte. Diesen Fleck durchwandert er wiederholt, von einer Seite bis zur andern laufend, und nähert sich mir dabei oft so, daß ich ihn mit der Hand hätte berühren können. Wagt er, kühn eine etwas weitere Strecke im Zusammenhange zu durchlaufen, so nimmt er stets die Flügel zu Hilfe, indem er sie zierlich nach oben erhebt und sich so im Gleichgewicht erhält. Bisweilen ist er bewegungslustiger und sucht eine solche Stelle für seine Verhältnisse überraschend schnell ab. Dann benutzt er aber bei jedem Laufe die Flügel, indem er sie rasch nach oben erhebt und wieder anlegt, behält jedoch dabei die Füße immer auf dem Boden.« Der Flug ist ungemein verschieden, je nach der Tageszeit und je nach der Erregung, die der Vogel gerade kundgibt. Bei Tage erscheint er flatternd, unsicher und in gewissem Grade unbeholfen, auch regellos; man meint, daß ein vom Wind plötzlich erhobener, leichter Gegenstand durch den Luftzug weitergeführt würde und schließlich zum Boden wieder herabstürze. Ganz anders fliegt der Ziegenmelker bei Nacht. Mit dem Verglühen des Abendrotes im Westen tritt er seine Jagdzüge an. Solange es nur der Jagd gilt, ist der Flug abwechselnd ein leichtes, schwalbenartiges Schwimmen und Schweben, bei dem die Flügel ungefähr ebenso hoch gehalten werden, als von einem fliegenden Weih geschieht, oder ein durch rasche Flügelschläge beschleunigtes Dahinschießen; Schwenkungen aller Art werden dabei jedoch auch ausgeführt, und zwar fast mit derselben Gewandtheit, die die Rauchschwalbe zeigt. Bei besonderen Gelegenheiten erhält sich der Ziegenmelker auch rüttelnd längere Zeit über ein und derselben Stelle; irgend etwas hat seine Aufmerksamkeit erregt und bewegt ihn, dies genau zu untersuchen. So geht es weiter, bis die vollkommen hereingebrochene Dunkelheit die Jagd beendet. Da der Vogel verhältnismäßig ungeheuere Bissen hinabwürgt, Mai- und große Mistkäfer, umfangreiche Nachtschmetterlinge z. B. dutzendweise verschluckt, ist der Magen in der allerkürzesten Zeit gefüllt und eine fernere Jagd zunächst unnütz; denn auch der Magen eines Ziegenmelkers verlangt sein Recht. Der Vogel sitzt eine Zeitlang ruhig auf einem Ast; sobald aber die lebend verschluckten und nicht so leicht umzubringenden Käfer in seinem Magen getötet sind und wieder Platz für neue Nahrung geschafft ist, tritt er einen nochmaligen Jagdzug an, und so geht's abwechselnd die ganze Nacht hindurch, falls diese nicht gar zu dunkel und stürmisch ist. Am lebhaftesten fliegen die Nachtschatten in den Früh- und Abendstunden; während der eigentlichen Mitternacht sah oder hörte ich sie nicht einmal in den milden Nächten der Äquatorländer.
Gelegentlich dieser Jagdflüge entfernt sich der Nachtschatten oft weit von seinem eigentlichen Wohnsitz. Er kommt in Thüringen aus den benachbarten Wäldern bis in das Innere der Dörfer oder fliegt hoch über diesen dahin einem andern Walde zu, erscheint in Spanien von den umgebenden Gärten über großen Städten, wie z. B. über Madrid, schwebt in Mittelafrika von der Steppe herein in die Wohnorte des Menschen und treibt sich hier oft während der halben Nacht umher. In den Ortschaften wie im Walde besucht er während seiner nächtlichen Ausflüge mit einer gewissen Regelmäßigkeit bestimmte Plätze, ebensowohl um von ihnen aus einem vorübersummenden Kerbtiere nachzujagen, als seinen absonderlichen Liebesgesang hören zu lassen. Einer, den ich in meiner Heimat beobachten konnte, erschien während eines ganzen Monats allabendlich und fast zu derselben Zeit regelmäßig zuerst an einigen vom Walde, seinem Brutorte, mindestens einen Kilometer entfernten Linden, umflog deren Kronen in Schraubenlinien und schönen Schwenkungen, offenbar um dort sitzende Kerbtiere aufzutreiben, begab sich hierauf einen wie alle Abende nach einer zweiten Baumgruppe, flog von dieser aus einer dritten zu und kehrte dann nach dem Walde zurück. Wenn man den Ziegenmelker beobachten will, braucht man nur einen seiner Singplätze aufzusuchen; im Laufe des Abends erscheint er hier sicherlich mehrere Male. Nicht selten geschieht es, daß seine Neugier durch besondere Umstände erregt wird; ein dahinlaufender Hund kann ihn viertelstundenlang beschäftigen. Er stürzt sich dann wiederholt nach Falkenart auf den Vierfüßler hernieder und begleitet ihn bis weit über die Grenzen seines Gebietes hinaus. Ebenso werden Menschen, die zufällig über seinen Wohnsitz gehen, oft lange von ihm verfolgt, in engen Kreisen umschwärmt und bis zur Waldgrenze oder darüber hinaus begleitet. Um kleinere Vögel bekümmert er sich selbstverständlich nicht, weil diese bereits zur Ruhe gegangen sind, wenn er sich zeigt. Dagegen verursacht er dem Kleingeflügel anfänglich, jedoch niemals lange, Bedenken und Besorgnisse.
Die Liebe äußert auch auf die stumpfsinnig erscheinenden Nachtschwalben ihre Zaubermacht. Daß zwei Männchen um die Gunst eines Weibchens in heftigen Streit geraten können und dabei sich so tüchtig zausen, als sie es vermögen, braucht nicht hervorgehoben zu werden? Wohl aber muß ich hier bemerken, daß alle Ziegenmelker während der Paarzeit besondere Flugkünste treiben. Schon unser deutscher Nachtschatten erfreut durch seine Flugspiele während der Zeit seiner Liebe. Jede Bewegung wird, so scheint es, mit gewissem Feuer ausgeführt und erscheint rascher, gehobener, stolzer. Aber nicht genug damit, der Ziegenmelker klatscht auch noch mit den Flügeln wie eine liebesbegeisterte Taube, stürzt sich plötzlich aus einer gewissen Höhe hernieder, daß man ein eigenes Rauschen vernimmt, oder umschwebt und umgleitet in den prachtvollsten Schwenkungen das ruhig sitzende Weibchen. Jede Art leistet in diesen Liebesspielen etwas Besonderes; am auffallendsten aber erscheinen, wie man sich denken kann, die durch den sonderbaren Federschmuck ausgezeichneten Arten Mittelafrikas oder Südamerikas. Ich erinnere mich heute noch mit wahrem Vergnügen der Abende des innerafrikanischen Frühlings, die uns in der Steppe, im Dorfe oder in der Stadt die Schleppennachtschwalben in ihrer vollen Liebesbegeisterung vor das Auge brachten. Unbesorgt wegen des lauten Treibens der Menschen, erschienen die prächtigen Vögel inmitten der Ortschaften und umflogen einzelne Bäume mit einer Anmut, Zierlichkeit und Gewandtheit, die uns immer zum Entzücken hinriß. Die Helligkeit der Nächte in den Wendekreisländern ließ uns jede Bewegung der Vögel deutlich wahrnehmen; wir konnten jeden Flügelschlag sehen, jedes Ausbreiten oder Zusammenlegen des wie eine Schleppe nachgetragenen Schwanzes unterscheiden, und der Vogel gebärdete sich, als wolle er uns alle Künste seines köstlichen Fluges offenbaren. Auch an dem Lagerfeuer in der Steppe war die Schleppennachtschwalbe eine regelmäßige Erscheinung und Gegenstand der anziehendsten Unterhaltung; es schien, als ob sie das ungewohnte Licht besonders aufrege und sie diesem Gefühle durch wundersame Bewegungen Ausdruck geben müsse.
Den Vierflügler habe ich zu meinem Bedauern niemals selbst gesehen, wohl aber aus dem Munde aller Araber, die ihn kannten, dieselben Ausdrücke der Verwunderung vernommen, die ich aus allen Erzählungen meiner eingeborenen Jäger schon früher herausgehört hatte. Wie auffallend die Erscheinung des fliegenden Vierflüglers ist, mag aus folgenden Worten Russegers hervorgehen. »Hätte ich eine Haremserziehung genossen, in diesem Augenblick hätte ich an Teufelsspuk und Hexentum geglaubt; denn was wir in der Luft sahen, war wunderbar. Es war ein Vogel, der sich jedoch mehr durch die Luft zu wälzen, als zu fliegen schien. Bald sah ich vier Vögel, bald drei, bald zwei, bald sah ich wieder einen Vogel, der aber wirklich aussah, als hätte er vier Flügel; bald drehte sich das Gaukelspiel wie eine Haspel um seine Achse, und es verwirrte sich das ganze Bild. Die beiden langen Federn, wegen der Zartheit ihrer Schäfte das Spiel eines jeden Windzuges, erschweren einerseits den Flug dieses Vogels sehr, und bewirken anderseits durch ihr Flattern und Herumtreiben in der Luft während des Fluges um so mehr alle die eben erwähnten Täuschungen, als der Vierflügler nach Art seiner Familie nur im trügerischen Lichte der Dämmerung fliegt und an und für sich einen sehr ungeregelten, unsicheren Flug besitzt.«
Die Stimme der Nachtschatten ist sehr verschieden. Einige Arten lassen hauptsächlich ein Schnurren vernehmen, andere geben mehr oder weniger wohllautende Töne zum besten. Wenn unser Ziegenmelker am Tage plötzlich aufgescheucht wird, hört man von ihm ein schwaches, heiseres »Dackdack«; bei Gefahr faucht er leise und schwach, nach Art der Eulen. Während der Paarungszeit vernimmt man den eigentümlichen Liebesgesang. Derselbe besteht nur aus zwei Lauten, die man vielleicht richtiger Geräusch nennen dürfte, werden aber mit einer bewunderungswürdigen Ausdauer vorgetragen. Man kann nur annehmen, daß der Ziegenmelker sie in derselben Weise hervorbringt, wie unsere Hauskatze das bekannte Schnurren. Auf dem Wipfel oder auf einem passenden Aste eines Baumes sitzend, beginnt der Vogel mit einem weit hörbaren »Errrrr«, aus das ein etwas tieferes »Oerrr« oder »Orrr« erfolgt. Letzteres wird offenbar beim Einziehen, ersteres beim Ausstoßen des Atems hervorgebracht; denn jenes währt durchschnittlich nur eine, letzteres dagegen vier Sekunden. Einer, den ich mit der Uhr in der Hand beobachtete, spann vier Minuten fünfundvierzig Sekunden lang ununterbrochen, setzte fünfundvierzig Sekunden aus, benutzte diese Zeit, um auf einen andern Baum zu fliegen, und ließ von ihm aus einen zweiten, drei Minuten fünfzehn Sekunden währenden Gesang vernehmen. Das Weibchen schnurrt ebenfalls, jedoch nur äußerst selten und stets sehr leise; denn das Spinnen ist Ausdruck der Zärtlichkeit. Fliegend vernimmt man von beiden Geschlechtern einen Lockton, der wie »Häit häit« klingt. Alle afrikanischen Nachtschwalben, die ich hörte, spinnen genau in derselben Weise wie die unserige; schon die südeuropäische Art aber wirbt in wohlklingenderer Weise um das Herz ihrer Geliebten. Sie wechselt mit zwei ähnlichen Lauten ab, die wir nur durch die Silben »Kluckkluckkluck« wiedergeben können. Schomburgk schildert malerisch die Stimmen des Urwaldes, die laut werden, wenn der helle Gesang, das ausgelassene Gelächter der farbigen Begleiter des Reisenden verstummt sind. »Auf den heiteren Jubel folgte die tiefe Klage des Schmerzes der verschiedenen Arten der Ziegenmelker, die auf den dürren, über die Wasserfläche emporragenden Zweigen der in den Fluß gesunkenen Bäume saßen und ihre stöhnenden Klagetöne durch die mondhelle Nacht ertönen ließen. Diese dumpfen Laute sind in der Tat so düster und unheimlich, daß ich die Scheu und Furcht vor diesen Tieren sehr natürlich finde. Kein Indianer, kein Neger, kein Kreole der Küste wagt es, sein Geschoß auf diesen Vogel zu richten, in dem die ersteren die Diener des bösen Geistes Jabahu und seine Zauberer, die andern Boten des bösen Geistes Jumbo und die dritten den sicheren Verkündiger eines Todesfalles innerhalb des Hauses erblicken.
Alle im Norden der Erde lebenden Arten der Unterfamilie und wahrscheinlich auch diejenigen, die ein Gebiet bewohnen, in dem schroffer Wechsel der Jahreszeiten stattfindet, verlassen in den für ihr Leben ungünstigen Monaten ihr Brutgebiet, um mehr oder minder regelmäßig nach andern Gegenden zu reisen; sie ziehen also, oder sie wandern. Entsprechend der Art und des bedeutenden Verbrauches an Nahrung erscheint unser Nachtschatten in der Heimat erst ziemlich spät, kaum vor der Mitte, meist erst zu Ende des April, in höheren Gebirgslagen oder im Norden auch wohl erst im Anfang des Mai, und verläßt uns von Ende August an allmählich wieder. Ganz im Gegensatz zu den Seglern wandert er langsam und gemächlich, obwohl er, dank seiner Flugbegabung, weite Strecken mit Leichtigkeit durchzieht und selbst Meere anscheinend unnötigerweise überfliegt. Im Frühjahre begegnet man den wandernden Ziegenmelkern meist einzeln, höchstens paarweise, im Herbste dagegen in mehr oder minder zahlreichen Gesellschaften, die weiter nach dem Süden hin stetig an Anzahl zunehmen. Solche Gesellschaften beobachtet man im südlichen Europa wie im Norden Afrikas oder im Steinigten Arabien schon zu Ende August, von dieser Zeit an aber bis in den September und Oktober hinein. Die zuerst abreisenden sind wahrscheinlich diejenigen, die nicht durch das Brutgeschäft aufgehalten werden, die zuletzt ziehenden sind die, die die Erziehung ihrer Jungen erst spät beenden konnten oder durch geeigneten Orts in besonderer Menge ihnen winkende Beute aufgehalten wurden. Unterwegs scheint den reisenden Vögeln jede einigermaßen Deckung gewährende Örtlichkeit zur Tagesruhe recht und genehm zu sein. Sie ziehen zwar auch hier waldige oder doch bebuschte Strecken vor, nehmen jedoch keinen Anstand, nötigenfalls ebenso aus nackten felsigen Hügeln oder mitten in der Wüste und Steppe sich niederzulassen. Drängt die Zeit, oder vermag eine gewisse Gegend sie nicht zu ernähren, so fliegen sie auch, ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit, am hellen Tage; Heuglin beobachtete einen Nachtschatten, der sich um diese Zeit auf einem Dampfschiffe niederließ, um hier einen Platz zu zeitweiligem Ausruhen zu suchen, wie dies bei den über das Meer fliegenden Nachtschwalben nicht allzu selten zu geschehen pflegt. Im nordöstlichen Afrika folgen auch sie der von den meisten Vögeln benutzten Zugstraße, dem Niltale nämlich, nach Heuglins Beobachtungen aber ebenso den Küsten des Roten Meeres, und eine Folge solcher Abweichung von der Regel mag es wohl sein, daß sie sich während des Zuges oft tief bis in die baumlose Wüste verirren. Im September und Oktober begegnete Heuglin den Einwanderern bereits an der Danakil- und Somaliküste, im Bogoslande, in Habesch und in Kordofân, ich meinerseits ebenso in den Waldungen zu beiden Seiten der Hauptströme des Nils. Sie halten sich hier genau auf denselben Örtlichkeiten auf wie die einheimischen Arten, pflegen jedoch mit diesen keine Gemeinschaft, sondern ziehen, wie die Schwalben auch, unbekümmert über die seßhaften Arten hinweg. Wie weit sich die Reise unseres Nachtschattens erstreckt, vermögen wir mit Bestimmtheit nicht zu sagen, sondern nur so viel anzugeben, daß der Vogel im südlichsten Teile Afrikas wohl nur sehr selten gefunden wird. Auf dem Rückzug erscheint er einzeln bereits Ende März, in größerer Menge aber Anfang April in Ägypten, wenige Tage später in Griechenland, woselbst er ebensogut wie in Kleinasien und im Atlas Brutvogel ist, und, da er jetzt eiliger fliegt, wenige Tage später in Deutschland. Nicht allein unsere heimische Art, sondern auch andere Nachtschwalben streichen gelegentlich ihres Zuges über die Grenzen ihres Verbreitungsgebietes hinaus. So wurde die Schleppenschwalbe in der Provence, der Wüstennachtschatten auf Helgoland angetroffen.
Es scheint, daß alle Ziegenmelker nur einmal im Jahre brüten. Diese Zeit ist selbstverständlich verschieden nach der Heimatsgegend, die diese oder jene Art bewohnt, fällt aber regelmäßig in den Frühling der betreffenden Länder. Das Männchen wirbt sehr eifrig um die Liebe seiner Gattin und bietet alle Künste des Fluges auf, um ihr zu gefallen. Auch das Schnurren oder laute Rufen ist nichts anderes als Liebeswerbung, der Gesang des verliebten Männchens. Nachdem sich die Paare gefunden und jedes einzelne das Wohngebiet erkoren, legt das Weibchen an einer möglichst geschützten Stelle, am liebsten unter Büschen, deren Zweige bis tief auf den Boden herabreichen, sonst aber auch auf einem bemoosten Baumstrunke, in einem Grasbusch und an ähnlichen Örtlichkeiten seine zwei Eier auf den Boden ab, regelmäßig da, wo man sie nicht sucht. Unser Ziegenmelker scheint mit besonderer Vorliebe Stellen zu wählen, auf denen feine Späne eines abgehauenen Baumes oder Rindenstückchen, abgefallene Nadeln und dergleichen liegen. Ein Nest wird niemals gebaut, ja die Niststelle nicht einmal von den auf ihr liegenden Stoffen gereinigt. Wahrscheinlich brüten beide Geschlechter abwechselnd und zeigen innige Liebe zur Brut. Bei herannahender Gefahr gebraucht der brütende Ziegenmelker die gewöhnliche List schwacher Vögel, flattert, als ob er gelähmt wäre, über dem Boden dahin, bietet sich dem Feinde zur Zielscheibe, lockt ihn weiter und weiter vom Nest ab und erhebt sich dann plötzlich, um raschen Fluges davonzueilen. Bleibt man ruhig und möglichst unbeweglich in der Nähe der gefundenen Eier sitzen, so bemerkt man, daß der weibliche Nachtschatten nach geraumer Zeit zurückkommt, in einiger Entfernung von den Eiern sich niedersetzt und vorsorglich und mißtrauisch in die Runde schaut. Endlich entdeckt oder erkennt er den lauschenden Beobachter, sieht sich ihn nochmals genau an, überlegt und setzt sich endlich in Bewegung. Trippelnd watschelnden Ganges nähert er sich mehr und mehr, kommt endlich dicht heran, bläht sich auf und faucht, in der Absicht, den Störenfried zu schrecken und zu verscheuchen. Dieses Gebaren ist außerordentlich belustigend. Wie groß muß die Mutterliebe sein, die einen so kleinen Wicht ermutigt, in dieser Weise dem furchtbaren und fast immer grausamen Menschen entgegenzutreten! Nähert man sich nachts der Brutstätte, so ist das Weibchen äußerst ängstlich und schreit, um das Männchen herbeizurufen. Aber es trifft auch noch andere Vorsichtsmaßregeln, um die einmal aufgespürte Beute der Gewalt des Feindes zu entrücken. Audubon hat, wie schon bemerkt, von einer Art beobachtet, daß die Eltern ihre Eier und selbst ihre kleinen Jungen, wenn das Nest entdeckt wurde, einer andern Stelle des Waldes zutragen; es ist aber gar nicht unmöglich, daß alle übrigen Ziegenmelker in ähnlicher Weise verfahren.
Die ausgeschlüpften Jungen werden von den Eltern während des ganzen Tages bedeckt. Mein Vater beobachtete, daß eines der Eltern auch dann noch, als die Jungen fast flügge waren, auf ihnen saß. Wie erklärlich, findet die Atzung der Brut nur des Nachts statt. Anfangs erhalten die Kleinen zarte Kerbtiere, namentlich Hafte und Nachtschmetterlinge; später werden ihnen gröbere Stoffe zugetragen, und schließlich müssen sie unter Führung und Leitung der Alten ihre eigene Jagd beginnen.
Wiederholt habe ich Ziegenmelker gepflegt und ebenso durch andere mehr oder minder ausführliche Berichte über ihr Gefangenleben erhalten. Wirklich anziehende Käfigvögel sind sie nicht, höchst absonderliche und deshalb beachtenswerte aber wohl. Für denjenigen, der auch mit unbeholfenen Vögeln umzugehen weiß, verursacht ihre Pflege keinerlei Schwierigkeiten. Die Jungen muß man allerdings stopfen und auch den herangewachsenen Ziegenmelkern in der Regel das Futter vorhalten; bei einzelnen aber gelingt es doch, sie so weit zu gewöhnen, daß sie in dem von ihnen bewohnten Raume fliegende Beute selbst jagen, überhaupt allein fressen. Friderich erzählt von einem gefangenen Vogel dieser Art eine wahrhaft rührende Geschichte. Der jung aus dem Nest entnommene und aufgefütterte Nachtschatten wurde ungemein zahm. Da aber seine Ernährung dem Pfleger Schwierigkeiten bereitete, wollte dieser ihm die Freiheit schenken und ließ die Tür des Käfigs offen, um ihn zum Ausfliegen zu bewegen. Als der Vogel keinen Gebrauch davon machte, warf Friderich ihn eines Abends im Freien in die Höhe. Er flog davon, stellte sich aber eine Viertelstunde später wieder ein. Der Versuch wurde wiederholt, und der Nachtschatten gewöhnte sich, nach Belieben aus- und einzufliegen, war aber am frühen Morgen stets auf dem altgewohnten Platze. Um ihn vor der Zugzeit noch rechtzeitig an die Freiheit zu gewöhnen und das Wiederkommen zu vereiteln, trug Friderich ihn nach einem sehr abgelegenen Orte. Als man aber im nächsten Jahre die ihm zum Aufenthalte angewiesene Kammer ausräumte, fand man den Ziegenmelker in einem Verstecke vor, tot, verhungert, zur Mumie eingetrocknet. Während man ihn im Genusse der goldenen Freiheit wähnte, war der beklagenswerte Vogel zurückgekehrt und hatte hier unbemerkt seinen Tod gefunden.
Nur im Süden Europas, wo man fast alle lebenden, mindestens alle eßbaren Geschöpfe dem Magen opfert, erlegt man auch den Ziegenmelker, um ihn für die Küche zu verwenden. Bei uns zulande stellt außer dem Naturforscher glücklicherweise nur der Bubenjäger ihm nach. Und dies ist sehr erfreulich. Denn nicht nur unser Nachtschatten, sondern alle Ziegenmelker überhaupt bringen dem menschlichen Haushalte nur Nutzen, niemals Schaden, verdienen daher die allgemeinste und umfassendste Schonung.
*
Von den vorher beschriebenen Sippen und Arten der Familie unterscheiden sich die Dämmerungsschwalben ( Chordeiles) nicht unwesentlich, insbesondere durch ihre Lebensweise, die sie als Verbindungsglieder der Nachtschwalben- und Seglerfamilie erscheinen läßt. Daß diese Verschiedenheit der Lebensweise sich auf Eigentümlichkeiten des Baues begründet, versteht sich von selbst. Die Unterschiede der Dämmerungs- und der Nachtschwalben sind so bedeutend, daß einzelne Forscher erstere mit einigen Verwandten zu einer besonderen Unterfamilie erhoben haben. Die in Rede stehenden Vögel kennzeichnen sich durch sehr kleinen, fast gänzlich im Kopfgefieder versteckten Schnabel und starke Mundborsten, sehr schwache und kurzzehige Füße, deren Lauf auf der ganzen Hinterseite gefiedert zu sein pflegt, sehr lange und spitze Flügel, unter deren Schwingen die erste kaum hinter der zweiten zurücksteht, mittellangen, etwas ausgeschnittenen, aus derben Federn gebildeten Schwanz und verhältnismäßig festes Kleingefieder.
Der bekannteste Vertreter dieser Sippe ist der Nachtfalk der Nordamerikaner ( Chordeiles virginianus), ein unserm Nachtschatten an Größe ungefähr gleichkommender Vogel. Das Gefieder ist oberseits braunschwarz, aus Oberkopf und Schultern durch rostfarbene Federränder, auf den Schläfen und den Deckfedern durch fahlgelbe Querbinden gezeichnet; die Unterteile sind rostfarben, durch schwarze Querbinden, die Kehle durch ein weißes Schild geziert. Die erste und zweite der schwarzen Schwingen zeigen auf der Innen-, die dritte bis fünfte auf beiden Fahnen eine weiße Mittelquerbinde. Die Iris ist braun, der Schnabel schwarz, der Rachenrand gelb, der Fuß horngelblich.
Schon Audubon wußte, daß der Nachtfalk weit nach Norden hinaufgeht; denn er selbst hat ihn in Neubraunschweig und Neuschottland gesehen. Durch die seitdem gewonnenen Erfahrungen anderer amerikanischer Forscher ist festgestellt, daß unser Nachtschatten alle Vereinigten Staaten von Florida und Texas bis zum höheren Norden bewohnt und von der Atlantischen Küste bis zu der des Stillen Meeres sich verbreitet, ebenso in Westindien brütet und gelegentlich seines Zuges auch Südamerika besucht. In den mittleren Staaten erscheint er gegen Anfang Mai, in den nördlichen selten vor Anfang Juni, verläßt dementsprechend sein Brutgebiet auch schon ziemlich früh im Jahre, meist bereits zu Anfang des September, spätestens zu Ende dieses Monats. Aus Kuba trifft er, laut Gundlach, vom Süden kommend, im April ein, belebt von dieser Zeit an alle Steppen in namhafter Menge, verschwindet aber im August oder Anfang September unmerklich wieder, wogegen er auf Jamaika schon überwintern soll. Zu seinem Aufenthalt wählt er sich die verschiedensten Örtlichkeiten, schwach bewaldete Gegenden, Steppen, freie Blößen oder Städte und Ortschaften überhaupt, die Niederung wie das Gebirge, in denen er, wie schon oben bemerkt, bis zu einer Höhe von etwa dreitausendfünfhundert Meter über dem Meere aufsteigt.
Die Verschiedenheit der Lebensweise des Nachtfalken und der eigentlichen Nachtschatten ist so bedeutend, daß Ridgway sich wundert, wie man den einen mit dem andern überhaupt vereinigen kann. Der Nachtfalk verdient eigentlich seinen Namen nicht; denn er ist nichts weniger als ein nächtlicher, sondern höchstens ein Dämmerungsvogel, der in seinem Tun und Lassen weit mehr an die Segler als an die Nachtschwalben erinnert. In den Morgen- und Abendstunden betreibt er seine Jagd, und sie gilt ganz anderer Beute als solcher, wie sie die Nachtschatten erstreben. Sobald die Dämmerung in das Dunkel der Nacht übergeht, endet diese Jagd, und der Vogel zieht sich zur Ruhe zurück. Ähnliche Angaben, obschon ohne die hieran geknüpften Folgerungen, sind bereits von Audubon gemacht worden. »Der Nachtfalk«, sagt dieser, »hat einen sicheren, leichten und ausdauernden Flug. Bei trübem Wetter sieht man ihn während des ganzen Tages in Tätigkeit. Die Bewegungen seiner Schwingen sind absonderlich anmutig, und die Spiellust, die er während seines Fluges bekundet, fesselt jedermann. Der Vogel gleitet mit aller erdenklichen Eile durch die Luft, steigt rasch empor oder erhält sich rüttelnd in einer gewissen Höhe, als ob er sich unversehens auf eine Beute stürzen wolle, und nimmt erst dann seine frühere Bewegung wieder auf. In dieser Weise beschreibt er gewisse Kreise unter lautem Geschrei bei jedem plötzlichen Anlaufe, den er nimmt, oder streicht niederwärts oder fliegt bald hoch, bald niedrig dahin, jetzt dicht über der Oberfläche der Gewässer, dann wieder über den höchsten Baumwipfeln oder Bergesgipfeln dahinstreichend. Während der Zeit seiner Liebe wird der Flug noch in besonderem Grade anziehend. Das Männchen bemüht sich durch die wundervollsten Schwenkungen, die mit der größten Zierlichkeit und Schnelligkeit ausgeführt werden, der erwählten Gattin seine Liebe zu erklären oder einen Nebenbuhler durch Entfaltung seiner Fähigkeiten auszustechen. Oft erhebt es sich über hundert Meter vom Boden, und sein Geschrei wird dann lauter und wiederholt sich häufiger, je höher es emporsteigt; dann wieder stürzt es plötzlich mit halb geöffneten Schwingen und Schwanze in schiefer Richtung nach unten, und zwar mit einer Schnelligkeit, daß man glauben möchte, es müsse sich auf dem Boden zerschmettern: aber zur rechten Zeit noch, zuweilen nur wenige Meter über dem Boden, breitet es Schwingen und Schwanz und fliegt wieder in seiner gewöhnlichen Weise dahin.« Bei diesem Niederstürzen vernimmt man ein sonderbares Geräusch, das nach Gundlachs Meinung ganz in ähnlicher Weise hervorgebracht wird, wie das bekannte Meckern der Heerschnepfe, durch einfache Schwingungen der Flügel- oder Schwanzfedern nämlich. »Zuweilen«, fährt Audubon fort, »wenn mehrere Männchen vor demselben Weibchen sich jagen, wird das Schauspiel höchst unterhaltend. Das Spiel ist bald vorüber; denn sobald das Weibchen seine Wahl getroffen hat, verjagt der glücklich Erwählte seine Nebenbuhler. Bei windigem Wetter und bei vorschreitender Dämmerung fliegt der Nachtfalk tiefer, schneller und unregelmäßiger als sonst, verfolgt dann auch die von fern erspähten Kerbtiere längere Zeit auf ihrem Wege. Wenn die Dunkelheit wirklich eintritt, läßt er sich entweder auf ein Haus oder auf einen Baum nieder und verbleibt hier während der Nacht, dann und wann sein Geschrei ausstoßend.« Die Nahrung besteht vorzugsweise aus sehr kleinen Kerbtieren, namentlich aus verschiedenen Mückenarten, die in unglaublicher Masse vertilgt werden. »Schoß man einen dieser Vögel«, sagt der Prinz, »so fand man in seinem weiten Rachen eine teigartige Masse, wie ein dickes Kissen, die nur aus Mücken bestand.« In dieser Beziehung wie in der Art und Weise seines Jagens verhält sich somit der Nachtfalke ganz wie die Segler.
Die Brutzeit fällt in die letzten Tage des Monats Mai; die zwei grauen, mit grünlichbraunen und violettgrauen Flecken und Punkten gezeichneten Eier werden ohne jegliche Unterlage auf den Boden gelegt. Im freien Lande wählt das Weibchen hierzu irgendeinen ihm passend erscheinenden Platz, auf Feldern, grünen Wiesen, in Waldungen und dergleichen, in den Städten einfach die flachen Dächer, die selten besucht werden. Das Weibchen brütet und betätigt bei Gefahr nicht allein wirklichen Mut, sondern auch die bekannte List der Verstellung, in der Absicht, die Feinde durch vorgespiegelte Lahmheit von der geliebten Brut abzuhalten. Die Jungen kommen in einem Dunenkleide von dunkelbrauner Färbung zur Welt und werden von beiden Eltern gefüttert. Wenn sie erst größer geworden sind, sitzt die ganze Familie nebeneinander, aber so still und bewegungslos, daß es sehr schwer hält, sie von dem gleichfarbigen Boden, ihrem besten Freunde und Beschützer, zu unterscheiden.
*
Die Segler ( Cypselidae) sind kleine, aber kräftig gebaute Vögel mit langgestrecktem Leibe, kurzem Halse und breitem, ziemlich flach gewölbtem Kopfe, der einen kleinen, äußerst kurzen, schwachen, dreieckigen, das heißt hinten verbreiterten, an der Spitze aber zusammengedrückten, etwas bogenförmigen Schnabel trägt, dessen Kinnladen sich so tief spalten, daß der Rachen sehr weit geöffnet werden kann. Die Flügel sind schmal und wegen der gekrümmten Schwingen säbelförmig gebogen; der Handteil trägt zehn Schwingen, von denen die erste die längste oder bei einigen Arten höchstens etwas gegen die zweite verkürzt ist; am Armteile hingegen stehen nur sieben bis acht Schwingen, die breit zugerundet und am Ende leicht ausgebuchtet, aber nicht spitzig sind wie die Handschwingen. Die Füße sind kurz und verhältnismäßig kräftig, namentlich was den Laufteil betrifft, die kurzen Zehen mit seitlich zusammengedrückten, stark gebogenen und sehr spitzigen Krallen bewehrt. Das Gefieder ist im allgemeinen kleinfedrig und derb, ausnahmsweise durch metallisch glänzende Färbung ausgezeichnet, gewöhnlich einfarbig und düster.
Die Segler verbreiten sich über alle Erdteile und bewohnen hier alle Gürtel der Breite, mit Ausnahme des kalten, sowie alle Höhen vom Meeresstrande an bis gegen die Schneegrenze hinauf. Sie finden sich ebensowohl in Waldungen wie in waldlosen Gegenden, vorzugsweise aber in Gebirgen und Städten, weil Felswände und Mauern ihnen die passendsten Nistplätze gewähren.
Mehr als andere Vögel bewohnen sie im eigentlichen Sinne des Wortes das Luftmeer. Ihre Kraft scheint niemals zu ermatten und ihre Nachtruhe auf wenige Stunden beschränkt zu sein. Vortreffliche Flugwerkzeuge setzen sie in den Stand, ohne Beschwerde tagtäglich Strecken zu durcheilen, die zusammengerechnet Hunderte von Kilometern betragen müssen. Abweichend von den Schwalben fliegen sie gewöhnlich in hohen Luftschichten dahin, und einzelne Arten Wirbeln und schrauben sich zu solchen Höhen empor, daß sie unserm Auge vollständig entschwinden. Ihr Flug kennzeichnet sie von weitem. Die Flügel gleichen, wenn sie ausgebreitet sind, einem Halbmonde und werden so rasch und heftig bewegt, daß man mehr an das Schwirren der Kerbtiere und bezüglich des Kolibri erinnert wird als an den Flügelschlag anderer Vögel. Zuweilen regeln sie ihrem Flug minutenlang nur durch verschiedenes Einstellen der Flugwerkzeuge, durch leichte Drehung der Flügel und des Schwanzes, das wir kaum oder nicht wahrnehmen, jagen aber trotzdem pfeilschnell durch die Lüfte. Wendungen und Drehungen aller Art wissen auch sie meisterhaft auszuführen; an Zierlichkeit und Anmut der Bewegung aber stehen sie hinter den Edelschwalben weit zurück. Auf dem Boden erscheinen sie als hilflose Geschöpfe: unfähig, zu gehen, unfähig fast, zu kriechen. Dagegen klettern sie, wenn auch nicht geschickt, so doch mit ziemlicher Fertigkeit an Mauer- oder Felswänden empor und in Höhlungen auf und nieder.
Ihre ewige Rastlosigkeit bedingt bedeutenden Verbrauch der Kraft und demgemäß ungewöhnlich reichen Ersatz. Die Segler sind bei weitem gefräßiger als die Schwalben und vertilgen von den Kerbtieren, die ihre ausschließliche Nahrung ausmachen, Hunderttausende an einem Tage; denn auch die stärksten Arten der Familie, die einen etwa drosselgroßen Leib haben, nähren sich hauptsächlich von den kleinen Kerfen, die in hoher Luft sich umhertreiben und uns wahrscheinlich größtenteils noch gänzlich unbekannt sind. Wie viele dieser winzigen Tiere ein Segler zu seiner täglichen Nahrung bedarf, vermögen wir nicht anzugeben, wohl aber können wir behaupten, daß die Nahrungsmasse eine sehr bedeutende sein muß, weil aus dem Betragen des Vogels zur Genüge hervorgeht, daß er jagt und frißt, solange er fliegt.
Unter den Sinnen steht, wie das große, wimperlose Auge vermuten läßt, das Gesicht obenan; der nächstdem am besten entwickelte Sinn dürfte das Gehör sein; über die übrigen vermögen wir nichts zu sagen. Die Segler sind zwar gesellige, aber keineswegs friedfertige, im Gegenteil zanksüchtige und rauflustige Geschöpfe, die nicht bloß mit ihresgleichen, sondern auch mit andern Vögeln im Streite liegen. Ihr ganzes Wesen zeichnet sich durch stürmische Heftigkeit aus, die sogar die eigene Sicherheit rücksichtslos auf das Spiel setzen kann.
Alle Segler, die den gemäßigten Gürtel der Erde bewohnen, sind Zugvögel, diejenigen, die den Wendekreisländern angehören, mindestens Strichvögel. Der Zug geschieht, wenigstens bei einigen Arten, mit der größten Regelmäßigkeit. Sie erscheinen in ihrem Vaterlande fast mit dem einmal feststehenden Tage und verlassen es zu einer ebenso bestimmten Zeit wieder; die Frist, die sie in der Heimat verweilen, ist aber nach den verschiedenen Arten sehr verschieden. Daß die innerafrikanischen Arten streichen, das heißt zeitweilig ihre Brutplätze verlassen und wieder zu ihnen zurückkehren, geht aus meinen eigenen Beobachtungen hervor; von den südasiatischen und südamerikanischen Arten ist dasselbe behauptet worden.
Bei den Zugvögeln der Familie beginnt der Bau des Nestes unmittelbar nach ihrer Ankunft in der Heimat; denn der Aufenthalt hier währt so kurze Zeit, daß sie mit ihrem Fortpflanzungsgeschäft vollauf zu tun haben. Unter lärmendem Geschrei verfolgen sich die erhitzten Männchen stundenlang, eilfertigen Fluges; wütend kämpfen sie in hoher Luft untereinander, ingrimmig auch an den Nistplätzen, und rücksichtslos vertreiben sie andere Höhlenbrüter, falls ihnen deren Wohnung passend erscheinen sollte. Die Nester selbst zeichnen sich vor denen aller übrigen Vögel aus. Wenige Arten bauen zierliche, die mehr oder minder denen der Schwalben ähneln; viele tragen sich bloß in einer Höhlung einen Haufen von Genist zusammen, der so unordentlich als möglich übereinander geschichtet wird. Unter allen Umständen aber kennzeichnet sich das Nest der Segler dadurch, daß die Stoffe mit dem kleberigen, bald verhärtenden Speichel überzogen und gebunden werden. Bei einigen Gruppen besteht das Nest der Hauptsache nach aus nichts anderm als ebensolchem Speichel. Das Gelege enthält ein einziges oder wenige Eier von walzenförmiger Gestalt und lichter Färbung. Das Weibchen brütet allein; die Jungen werden von beiden Eltern aufgefüttert. Jedes Paar macht eine, höchstens zwei Bruten im Jahre.
Auch die Segler haben ihre Feinde; doch ist die Zahl derselben gering. Der überaus schnelle und gewandte Flug schützt sie vor vielen Nachstellungen; nur die allerschnellsten Falken sind imstande, einen Segler im Fluge zu fangen. Die Jungen werden, solange sie noch hilflos im Neste sitzen, durch die kleinen, kletternden Räuber gefährdet, gewisse Arten ihrer Nester ebenfalls der Jungen wegen auch von den Menschen heimgesucht.
Für die Gefangenschaft eignen sich die Segler nicht. Gleichwohl ist es möglich, wenn man sie jung aus dem Neste nimmt, auch diese Vögel großzuziehen. Alt eingefangene gewöhnen sich nicht an den Käfig, liegen hier entweder hilflos am Boden oder klettern rastlos an den Wänden umher, verschmähen Futter zu nehmen und gehen infolge ihres Ungestüms oder schließlich an Entkräftung zugrunde. Jung dem Neste entnommene muß man anfänglich stopfen, um sie nach und nach dahin zu bringen, daß sie selbst fressen. Rechte Freude gewinnt man übrigens auch dann nicht an ihnen. Es ist unmöglich, ihnen einen Raum zu bieten, der groß genug wäre, ihnen den nötigen Spielraum zur Entfaltung ihrer hervorragendsten Fähigkeiten zu gewähren, und hierin liegt der Grund, daß sie sich nur unbehilflich gebaren. Ihre Absonderlichkeit fesselt den Beobachter, ihr Wesen hat wenig Ansprechendes.
Die Segler im engsten Sinne ( Cypeslus) zeigen das Gepräge der Familie und unterscheiden sich von ihren Verwandten dadurch, daß die erste Schwinge der zweiten gleich oder diese kaum über jene verlängert, der Schwanz seicht ausgeschnitten oder schwach gegabelt, der Fuß stämmig und auf der Vorderseite mit Federn bekleidet, hinten dagegen nackt ist.
In Europa leben zwei Arten dieser Sippe, die beide auch in Deutschland vorkommen, die eine allerorten, die andere in südlicheren Gebirgsgegenden. Letztere zählt zu den größten Arten der Familie und verdient aus diesem Grunde an erster Stelle erwähnt zu werden.
Der Alpen- oder Felsensegler ( Cypselus melba) erreicht eine Länge von 22, eine Breite von 55 bis 56 Zentimeter; die Fittichlänge beträgt 20, die Schwanzlänge 8,5 Zentimeter. Alle Oberteile, die Kopfseiten und unteren Schwanzdecken haben dunkel rauchbraune Färbung, die Federn äußerst feine, stahlbräunliche Endsäume. Ein ausgedehntes Kinn- und Kehlfeld sowie die Brust, Bauch- und Aftergegend sind weiß, so daß auf der Oberbrust nur ein braunes Band sichtbar wird, das, beiderseits den Raum zwischen Schnabelwurzel und Schulter einnehmend, auf der Mitte der Brust sich merklich verschmälert. Die Schwingen sind dunkler braunschwarz als die Federn der Oberseite und durch deutlich erzgrünen Schimmer ausgezeichnet; ihre Unterseite wie die der Steuerfedern glänzt graubraun. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der nackte Fuß ebenso gefärbt.
Als den Brennpunkt des Verbreitungskreises dieses stattlichen Seglers haben wir das Mittelmeerbecken anzusehen. Von hier aus erstreckt sich das Wohngebiet einerseits bis zu den Küsten Portugals, den Pyrenäen und Alpen, anderseits bis zum Atlas und den Hochgebirgszügen Kleinasiens, buchtet sich aber nach Osten hin, dem Kaspischen Meere und Aralsee folgend, bis zum nördlichen Himalaja aus. Demgemäß bewohnt der Vogel alle geeigneten Gebirge Spaniens, insbesondere die der Mittelmeerküste, die Alpen an vielen Stellen, sämtliche höheren Gebirge Italiens und aller Inseln des Mittelländischen Meeres, die geeigneten Bergzüge der Balkanhalbinsel, die Transsylvanischen Alpen, steile Felsenwände der Krim, des südlichen Ural und der Gebirge Turkestans bis Kaschmir, einzelne Stellen Persiens, wohl den größten Teil Kleinasiens, Syriens und Palästinas und endlich den Atlas als Brutvogel, siedelt sich als solcher aber gelegentlich auch weit jenseit der Grenzen dieses ausgedehnten Gebietes an: so, nach Heuglins Beobachtungen, in den Hochgebirgen von Habesch, namentlich in den unzugänglichsten senkrechten Basaltwänden von Tenta in Woro Heimano, ebenso, laut Jerdon, hier und da in Ostindien an Felsenwänden, die seinen Anforderungen entsprechen. Auf keiner der genannten Örtlichkeiten aber ist der Alpensegler Standvogel, im Norden seines Gebietes vielmehr regelmäßiger Zug-, in den übrigen vielleicht Wander-, mindestens Strichvogel.
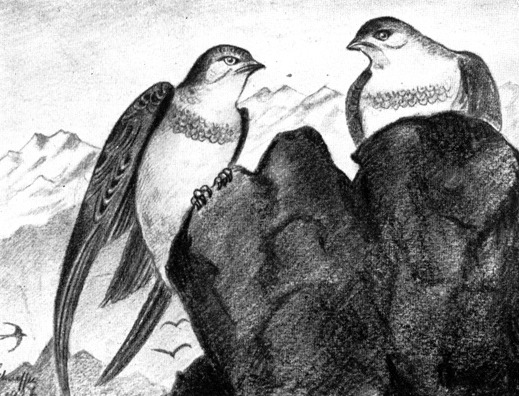
Alpensegler (Cypselus melba)
Er erscheint weit früher als sein Verwandter, der Mauersegler, an der Südküste des Mittelländischen Meeres. Der Zeitpunkt seines Kommens schwankt hier nach den jeweiligen Witterungsverhältnissen zwischen Ende März und Mitte April. Nach den von Girtanner mitgeteilten Beobachtungen des sehr zuverlässigen und verständnisvollen Reinhard, Oberwächters auf dem Münsterturme zu Bern, zeigen sich im Frühjahre zwei bis drei Stück, die mit gellendem Geschrei ihre alte Heimat umkreisen, um sofort mit der Überzeugung, daß dieselbe noch vorhanden und von Stund' an zu beziehen sei, wieder zu verschwinden, bald nachher schon in größerer Gesellschaft zurückkehren, bis nach Verlauf von etwa acht Tagen der ganze im Frühjahre auf einhundertundfünfzig Stück zu veranschlagende Schwarm eingerückt ist. Wenn aber, was nicht gerade selten, nach ihrer Rückkehr noch herber und einige Tage lang dauernder Frost oder gar Schneefall eintritt, gehen ihrer viele zugrunde. So berichtet Reinhard, daß er im Jahre 1860, gegen Ende April, nach einem heftigen Schneegestöber dreiundzwanzig tote Alpensegler von den Galerien und Balkengerüsten des Berner Münsterturmes habe aufnehmen können, erklärlicherweise aber nicht imstande sei, weder die Anzahl jener, die in unzugänglichen Winkeln verhungert und erfroren, noch derer, die entfernt vom Münster aus der Luft herabgefallen und umgekommen seien, anzugeben. Vor mehreren Jahren fand auch Girtanner auf dem Rosenberge bei St. Gallen im Anfange des Sommers einen sehr ermatteten und äußerst abgemagerten Alpensegler auf der Erde liegen, der wahrscheinlich diesen Ausfall auf Nahrung von den mit neuem Schnee bedeckten Appenzeller Alpen aus unternommen hatte. Ebenso wie im Frühjahre richtet sich im Herbst der Abzug nach dem Süden nach den Witterungs- und Nahrungsverhältnissen, schwankt daher zwischen Mitte September und Anfang Oktober. Reinhard zeigt den Abzug mit folgenden Worten an: »Die Alpensegler haben am siebenten dieses Monats morgens um sieben Uhr die Reise nach Afrika angetreten. Einige Tage, bevor sie abzogen, sind sie alle Morgen ungefähr um dieselbe Stunde von dem Turme weggeflogen, in der Höhe, wo sie sich gesammelt, in einem Kreise umhergezogen und so hoch emporgestiegen, daß sie nur mit dem Fernrohre zu sehen waren, abends bei Sonnenuntergang aber wiedergekommen, um zu schlafen und auszuruhen. In dieser Zeit waren sie bei Nacht immer ruhig und still, was früher nicht der Fall war, wahrscheinlich infolge ihrer großen Ermüdung nach dem langen Fluge. Andere Jahre hat man noch nach dem Abzüge einige gesehen, die mehrere Tage um den Turm herumgeflogen sind. Dieses Jahr ist es ganz anders gewesen. Seit dem siebenten Oktober sind sie alle verschwunden, und kein einziger hat sich mehr sehen lassen.«
Gelegentlich seines Zuges überschreitet der Alpensegler nicht allzuselten die nördlichen Grenzen seines Verbreitungsgebiets und ist demgemäß wiederholt im Norden Deutschlands und ebenso in Dänemark und auf den Britischen Inseln beobachtet worden. So wurde er am achten Juni 1791 von Bechstein auf dem Thüringer Walde gesehen. »Drei Vögel«, so berichtet er, »flogen so nahe und so lange um mich herum, daß ich deutlich genug ihre Größe und Farbe unterscheiden und sie daher nicht mit der Mauerschwalbe verwechseln konnte. Schade, daß ich keine Flinte hatte. Ihre Stimme war ein helles, reines, flötendes ›Scri Scri‹. Ich habe sie in der Folge nicht wieder gesehen.« Auch auf Helgoland hat man den Alpensegler erlegt, und wahrscheinlich durchfliegt er unbeachtet viel häufiger unser Vaterland, als die Vogelkundigen annehmen mögen. Noch ungleich weiter als nach Norden hin führt ihn seine Winterwanderung. Wie sein Verwandter durchreist er buchstäblich ganz Afrika, trifft regelmäßig im Süden und Südwesten, am Vorgebirge der Guten Hoffnung wie im Namakalande ein und treibt sich über dem Tafelberge ebenso munter umher wie über den höchsten Zacken des Säntisgebirges.
Alles, was über das Tun und Treiben, das Wesen und Gebaren des Alpenseglers gesagt werden kann, ist in zwei köstlichen Schilderungen enthalten, die wir Bolle und Girtanner verdanken. Sie sind es daher auch, die ich dem Nachfolgenden zugrunde lege. »Bald nach seiner Ankunft auf den alten Brutplätzen«, sagt der letztgenannte, durch seine trefflichen Beobachtungen hervorragende Forscher, »beginnt der Bau neuer und die Ausbesserung alter Nester. Die Neststoffe sammeln die Alpensegler, da sie wegen der Schwierigkeit, sich vom Erdboden wieder zu erheben, denselben wohl nie freiwillig betreten, in der Luft. Sie bestehen aus Heu, Stroh, Laub usw., Gegenständen, die der Wind in die Lüfte entführt, und die sie nun fliegend erhaschen. Andere gewinnen sie, indem sie, reißend schnell über einer Wasserfläche oder dem Erdboden dahinschießend, dieselben von ihm wegnehmen, oder sie klammern sich an Gemäuer an und lesen sie dort auf. Den Mörtel, der alle diese Stoffe zu einem Neste verbinden soll, müssen sie nicht wie ihre Verwandten, die Schwalben, vom Boden ausheben; sie tragen ihn vielmehr beständig bei sich: die Absonderung ihrer großen Speicheldrüsen nämlich, eine zähe, halb flüssige Masse, ähnlich einer gesättigten Gummilösung. Vor allem fällt die zum Verhältnis des Vogels außerordentliche Kleinheit auf. Das Nest stellt im allgemeinen eine runde, wenig ausgehöhlte Schale dar, von zehn bis zwölf Zentimeter Durchmesser am oberen Rande, vier bis sechs Zentimeter Höhe und, übereinstimmend an allen sechs Nestern, drei Zentimeter Muldentiefe. Ist, wie es scheint, ein so kleines Nest unserm Vogel passend, so durfte es auch keine tiefe Mulde haben, da er sonst mit seinen kurzen Füßen und so verlängerten Flügeln in Zwiespalt kommen mußte. Bei dieser geringen Tiefe der Mulde ist es nun aber trotz der langen Flügel möglich, mit den Füßen den Boden des Nestes zu erreichen. Sitzen beide Eltern oder eine Brut selbst sehr junger Vögel im Neste, so verschwindet es vollständig unter ihnen. Für den kleinen Körper allein bedarf der Alpensegler keines großen Nestes, und gegen das Herausfallen schützt sich alt und jung vermittels der tief in den Netzfilz eingegrabenen scharfen Nägel. Die sorgfältige Zerlegung eines solchen Nestes in seine einzelnen Bestandteile ergibt, daß der Aufbau in folgender Weise geschieht. Auf die gewählte Niststelle, sei dieselbe nun ein Balken, eine Mauernische oder Felsenspalte, werden Stroh und dürre Grashalme, Laubteilchen usw., teils in Kreisform, teils kreuz und quer, hingelegt, nachdem die Unterlage mit Speichel gehörig bestrichen und durch den Kitt so fest mit demselben verbunden worden ist, daß beim Wegnehmen eines ganzen Nestes nicht selten Späne eines morschen Balkens mitgenommen werden müssen. Dichter und aus starken Halmen geflochten wird nur der untere Nestrand, der sich dem gegebenen Raumverhältnis anpaßt und die Vögel oft die ursprünglich runde Form zu verlassen zwingt, und auch dieser Teil mit der Unterlage verkittet. Auf dem Unterbau wird das Nest weiter errichtet. Stößt es seitlich an, so wird es auch dort angeleimt und besteht bei den vor mir liegenden Nestern fast ausschließlich aus einem äußerst dichten Filze von Gras, Knospenhüllen und Alpenseglerfedern. Papierschnitzel, Wurzelfasern und dergleichen werden äußerst selten angewendet. Sehr fest wird der obere Rand aus seinen, stark ineinander verfilzten Grashalmen und Federn, womöglich kreisrund, im Notfalle aber halbrund oder eckig geflochten. Auch die innere Oberfläche erhält keine weitere Auskleidung. Wo sich die Niststoffe nicht ordentlich ineinander fügen wollen, wird immer gekittet und eine starke Alpenseglerfeder geknickt und gebogen. Der Speichel wird hauptsächlich angewendet bei Befestigung des Nestes auf die Unterlage, dem oberen Rande und dem Unterbaue und zu gänzlichem Überziehen des inneren Muldenrandes. Der obere Nestrand wird dadurch gleichzeitig gekittet und gehärtet, so wie übrigens das ganze Nest durch diesen an der Luft sehr bald hart und glänzend werdenden Leim an Derbheit sehr gewinnt.
Gewöhnlich Anfang Juni, oft schon bevor das Nest halb vollendet wurde, beginnt das Eierlegen, und zwar folgt eines dem andern in je zwei Tagen, bis das Gelege mit drei bis vier Eiern vollzählig wurde. Das Ei ist, laut Girtanner, immer milchweiß, glanzlos wie ein Gipsmodell und auch so anzufühlen, das Korn mittelfein. Gegen das breite Ende des Eies und auf demselben zeigen sich gröbere, kalkige Auslagerungen, und ebenso sind ziemlich zahlreiche Poren überall sichtbar. Die Form wechselt von der langgestreckten, allmählich spitz zulaufenden des Eies bis zum fast vollständigen Eirund. Der Längendurchmesser von zehn Eiern, die Girtanner aus einer Reihe von vierzig Stück auswählte und maß, schwankt zwischen neunundzwanzig und dreiunddreißig, der Breitendurchmesser zwischen neunzehn und zweiundzwanzig Millimeter. Jedoch ist meist nur der eine Durchmesser auf Kosten des andern größer und der Inhalt wie das Gewicht des Eies daher fast immer gleich. Wie der Verwandte, so brütet auch der Alpensegler nur einmal im Jahre.
Wohl kein einziger Beobachter, der den Alpensegler im Freien sieht, vermag sich des tiefen Eindruckes zu erwehren, den der Vogel auf jedes unbefangene Gemüt ausüben muß. Erhöht wird der Eindruck noch wesentlich durch die Großartigkeit der Umgebung, die erhabene Landschaft des Wohngebietes dieses stolzen und gewaltigen Fliegers. Anziehend und fesselnd wie immer schildert Bolle sein Zusammentreffen mit dem Alpensegler. Er befand sich auf Ischia, und es war am achten Juni nachmittags. »›Tritetirrrrrrr‹ erklang es in der Sommerluft über mir. Spielend jagte sich ein Pärchen durch den hohen Äther. Wie konnte ich den Vogel verkennen! Vaterland, Größe und die blendendweiße Unterseite verrieten ihn mir augenblicklich. Bald gewahrte ich, ohne meinen Dünensitz zu verändern, ihrer mehrere. In außerordentlicher Menge bewohnen sie den hohen Felsberg, der inselartig, obwohl mit dem Festlande durch einen Damm verbunden, das Kastell der Stadt Ischia auf seinem Scheitel trägt. Sie mögen aber wohl alle Vorgebirge der Insel in Beschlag genommen haben. Die Punta del Imperatore, die die Westklippe der Insel bildet, ist ein wundervoller Ort mit seinen schaumspritzenden Brandungen, hoch über dem purpurblauen Meere voller Lavatrümmer, weit hinausschauend bis gegen das Vorgebirge der Circe und die Ponzainseln. Von der Höhe dieser Punta del Imperatore aus sieht man, ein prachtvoller Anblick, die Alpenseglerflüge scheinbar ganz niedrig über der See kreisend. Sich abhebend von dem Dunkelblau der Fluten, erscheinen sie dem Auge silberweiß; ich weiß nicht, ob durch irgendeine optische Täuschung erzeugt, durch eigentümliche Brechung der Lichtstrahlen auf ihrem doch nicht metallischen Gefieder, oder weil sie schiefen Fluges den hellfarbigen Unterkörper etwas nach oben wenden. Aber auch auf Capri habe ich sie wiedergefunden, die Segler der Lüfte, und als alte Freunde begrüßt. In manch einsamer Stunde sind sie dort meine alleinige Gesellschaft gewesen, überall, wo man an den schwindelnden Rand der Felsenriesen tritt und unten im Boote an ihrem vom Meere umspülten Fuße entlang fährt, sieht man sich von den lauten Schwärmen dieser Vögel umringt. Eine Siedelung derselben reiht sich an die andere wie ein ununterbrochener, das Eiland umschlingender Gürtel. Oft habe ich auf der Ostklippe, die durch die Trümmer ihres Kaiserpalastes das Andenken an die düstere und einsiedlerische Imperatorengestalt des Tiberius in die Gegenwart hinüberträgt, stundenlang gesessen. Wenn so das Auge zurückkehrte aus den lichten Fernen der gegenüber sich ausbreitenden Landschaftsbilder, vom Vesuv und von Somma, vom Vorgebirge der Minerva oder jenseit der Sirenen, von dem verschwindenden Horizonte des Salernobusens, und ich, über die Böschung gelehnt, voll wollüstigen Schauderns den Grund der ungeheuren Tiefe mit den Augen suchte, ohne ihn anders als in dem Schimmern der Meeresfläche zu finden, über die wohl wie ein Punkt auf himmelblau gemarmeltem Grunde ganz langsam eine Möwe hinglitt: da waren es unwandelbar die Felsensegler, die das Luftmeer unter mir belebten. Unter der fast vierhundert Meter hohen Klippe Salto di Tiberio schienen sie mir des Gesetzes der Schwere zu spotten.«
Weit hinaus aufs Meer wagen sich außer der Zugzeit die Felsensegler nicht. Bolle versichert, mehrmals zu Schiff an der großen Felsenhalbinsel des Monte Argentaro im südlichen Toskana vorübergekommen zu sein, ohne sie, die dort sehr häufig sind, das Fahrzeug umkreisen zu sehen. »Und dennoch verdient der Vogel den Namen › Rondone marino‹, zu deutsch ›Meersegler‹, den er in Toskana trägt, weil er felsige Meeresufer jedem andern Aufenthalte vorzieht und in Italien niemals zum Städtebewohner wird wie in der Schweiz oder in Portugal. Häufig sieht man ihn in Italien in ganz niedrig gelegene Grotten schlüpfen und durch Schaum und Gischt der Wellen seinen Flug nehmen.«
In demselben Grade, wie der Alpensegler das Luftmeer beherrscht, zeigt er sich unbehilflich, wenn er durch Zufall auf flachen Boden fiel. Girtanner hat über das vielbesprochene Unvermögen dieses Seglers, vom Erdboden aus zum Fluge sich zu erheben, Versuche angestellt, aus denen folgendes hervorgeht. In einem großen Zimmer möglichst nahe an die Decke desselben gebracht, ließen sie sich fallen, breiteten dann schnell die Flügel aus und kamen in einem gegen den Boden gewölbten Bogen diesem nahe, erhoben sich nun allmählich wieder und waren imstande, einige Kreise zu beschreiben, hängten sich jedoch bald irgendwo an, da ihnen zu größeren Flugübungen der Raum zu mangeln schien. Der gleiche Versuch, in einem kleinen Zimmer ausgeführt, hatte zur Folge, daß sie die entgegengesetzte Zimmerwand berührten, ehe sie sich wieder erhoben hatten, anstießen und immer zu Boden fielen. Von diesem aus waren sie nie imstande, sich frei zu erheben. Denselben mit den ausgebreiteten Flügeln peitschend, die Füße an den Körper angezogen, stoben sie dahin, bis sie die Wand erreichten. Hier, selbst an einer rauhen Mauer, hinaufzuklettern, vermochten sie nicht. »Es besteht wohl kein Zweifel«, meint Girtanner, »daß sie, wenn sie in der Freiheit auf die Erde gelangten, dieselben Bewegungen ausführen. War der Vogel so glücklich, auf ein Hausdach oder die Oberfläche eines Felsens zu fallen, so hilft er sich auf die genannte Weise bis an den Rand, über den er sich, um freien Flug zu gewinnen, einfach hinabstürzt. Auf weiter Fläche aber, deren Ende er flatternd nicht zu erreichen vermag, oder in einem von senkrechten Wänden umgebenen Räume ist er unfehlbar dem Tode preisgegeben.«
Ich meinesteils will Girtanners Zweifel nicht bestreiten, kann aber seiner Meinung, daß ein aus den Boden geratener Segler dem Tode preisgegeben sei, nicht beitreten. Er behilft sich unzweifelhaft in derselben Weise wie der Mauersegler in gleichem Falle. Aber freilich darf man ihn nicht im engen Räume eines Zimmers auf den Boden legen, um letzteres zu erfahren, muß sich vielmehr im Freien einen Ort erwählen, der dem geängstigten Tiere weite Umschau und dadurch wohl das nötige Selbstvertrauen gewährt.
Fesselnd, wie der erste Eindruck, ist auch die Beobachtung des täglichen Lebens und Treibens der Alpensegler. »Die Umgebung eines alten Turmes, ja eines ganzen Gebirgszuges, der einer größeren Gesellschaft dieser zwar geselligen und doch immer streitsüchtigen, außerordentlich wilden und stürmischen Vögel zur Heimat dient«, so schildert Girtanner, »wird durch ihr Leben und Treiben ungemein belebt. War schon während der ganzen Nacht des Lärmens und Zankens in den Nisthöhlen kein Ende, so daß schwer zu begreifen ist, wie sie die so nötig erscheinende Ruhe finden, so entfaltet sich doch mit Anbruch des Tages erst recht ihr wildes Treiben. Noch sieht der junge Tag kaum in die dunkle Felsenspalte hinein, so schicken sich deren Bewohner auch schon an, sie zu verlassen. Mühsam kriechend, die Brust fest auf den Boden gedrückt und mit den Flügeln eifrig nachhelfend, streben sie, die Öffnung der Höhle zu erreichen. Dort angekommen, hat alle Not für die Dauer des Tages ein Ende. Mit gellendem Geschrei, das von Zeit zu Zeit in einen schrillenden Triller übergeht, in die lautlose Dämmerung hinausrufend, auf die düstere Stadt, die dunkle Waldschlucht hinabjauchzend, schwebt jetzt die wunderliche Schar rätselhafter Gestalten durch die frische Morgenluft dahin, im Fallen erst die nie ermüdenden Schwingen zum Fluge ausbreitend. Bis in Höhen kreisend, in denen das unbewaffnete Auge sie nicht zu erreichen vermag, scheint sie plötzlich der Gegend ihres nächtlichen Aufenthaltes entrückt zu sein. Doch schon ist sie wieder sichtbar. In unendlicher Höhe flimmern die tadellos weißen Bäuche, die glänzenden Flügel, wie Schneeflocken im Sonnenglanze. Jetzt umtobt sie wieder, bald jagend, bald spielend, immer aber lärmend, das heimatliche Felsrevier. So bringt sie, inzwischen der klaren Morgenluft Nahrung abjagend, bei freundlicher Witterung den ganzen langen Morgen zu. Wird später die Hitze drückend, so zieht sie sich ihren Höhlen zu, und still werden die Segel eingezogen. Denn sie läßt die größte Hitze lieber, in den kühlen, schattigen Felsnischen liegend, vorübergehen. Offenbar schläft dann die ganze Bande; wenigstens ist in dieser Zeit fast kein Laut zu hören, und erst der Abend bringt wieder neues Leben. In großen, ruhigen Kreisen bewegt sich der Schwarm durcheinander, im vollen Genusse unbedingter Freiheit. Von Beginn der Abenddämmerung bis zu ihrem Erlöschen hat wilde, zügellose Fröhlichkeit die Oberhand, und noch spät, wenn die Straßen der Stadt und die belebten Alpentriften schon lange öde geworden sind, müssen sie noch diesen wilden Gesellen der Lüfte zum Tummelplatz dienen. Bei unfreundlichem, regnerischem Wetter würde unser Lärmmacher freilich lieber zu Hause bleiben; der Nahrung wegen aber muß er doch einen Flug unternehmen. Unter solchen Umständen zieht er mehr einzeln, eifrig Kerbtiere fangend, über die Alpenweiden hin oder verfolgt stillschweigend den Lauf eines Flüßchens, das ihm Libellen und dergleichen liefern soll, und der stolze Gebirgsbewohner ist dann froh und zufrieden, schweigsam durch die Talsohle streichend, seinen Hunger stillen zu können. Tritt in dem höheren Alpengürtel starke Wetterkühlung ein, oder tobt eines jener majestätischen Hochgewitter durch das Gebirge, so läßt er sich wohl auch im Tale sehen. Nach langer Trockenheit ist ihm ein warmer Regen sehr willkommen; trinkend, badend und gleichzeitig seiner lästigen Schmarotzer sich entledigend, schwärmt er dann im Kreise über seiner Wohnstätte, und selbst der dem Brutgeschäfte obliegende soll sich diesen Genuß nicht versagen können.
Dieses ungebundene Leben dauert fort, bis das Nest mit Eiern besetzt ist, deren Bebrütung der freien Zeit schon Abbruch tut. Ist aber das Gelege ausgeschlüpft, so ist einzig die volle Tätigkeit auf Herbeischaffung der nötigen Nahrung gerichtet. Mit wahrer Wut, den Rachen weit aufgesperrt, schießt der Vogel jetzt nach allen Richtungen dahin, und wo ein Kerbtier seinen Weg kreuzt, hängt es im nächsten Augenblick auch schon an dem kleberigen Gaumen. Weiter stürmt er in wilder Jagd, bis so viele Kerfe gesammelt worden, daß sie im Rachen einen großen Klumpen bilden. Mit ihm eilt er dem Nest zu und stößt ihn dem hungrigsten Jungen tief in den Schlund. Da die Jungen natürlich erst ausfliegen, wenn sie ohne vorherige Flugversuche gleich in die weiten Lüfte sich hinauswerfen dürfen, so dauert dieses Fütterungsgeschäft sieben bis acht Wochen. Drei Wochen nach Legung des letzten Eies schlüpfen die abwechselnd von beiden Eltern bebrüteten Jungen aus. Sie sind in diesem Alter ganz mit grauem Flaum bedeckt wie junge Raubvögel. Die Federn, durch breite, weiße Säume verziert, fangen zuerst an Kopf, Flügel und Schwanz an, sich zu zeigen. Die Füße sind vollständig nackt und rosenrot. Auch wenn das Gelege ursprünglich vier Eier besaß, so findet man nachher doch oft nur drei Junge vor, sei es, daß durch die immer stürmischen Bewegungen der Alten ein Ei zertrümmert oder ein Junges durch seine Geschwister aus dem engen Bett hinausgedrängt und hinabgestürzt wurde. Auch ihre weitere Entwicklung geht wohl wegen der nur mühsam in genügender Menge herbeizuschaffenden Nahrung langsam vor sich. Das kleine Nest aber verlassen sie schon lange vor dem ersten Flug. Sie hängen sich an den Wänden der weiteren Nesthöhle an und werden auch, in derselben Stellung oft stundenlang verbleibend, von den Alten gefüttert. Endlich fliegen sie gegen Ende, frühestens Mitte August aus und lernen nun bald die Flugkünste der Alten. Denn schon naht der Abzug nach dem Süden.
Sogar der Alpensegler«, schließt Girtanner, »läßt sich in Gefangenschaft und selbst im Käfig halten. Doch könnte ich ihn niemand mit gutem Gewissen als Zimmergenossen empfehlen. Ungestört möge er in unbegrenzter Freiheit sein tolles Wesen treiben.«
Der auf vorstehenden Seiten wiederholt erwähnte Verwandte des Alpenseglers, unser Mauer- oder Turmsegler ( Cypselus apus), erreicht eine Länge von achtzehn, eine Breite von vierzig Zentimeter; die Fittichlänge beträgt siebzehn, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Das Gefieder ist einfarbig rauchbraunschwarz mit schwarzgrünem Erzschimmer, der am stärksten auf Mantel und Schultern hervortritt. Kinn und Kehle werden durch einen rundlichen weißen Fleck geziert. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß lichtbräunlich. Beide Geschlechter unterscheiden sich nicht, die Jungen durch helleres Gefieder und äußerst schmale, fahlweißliche Endsäume der Federn.
Der Mauersegler ist es, den wir vom ersten Mai an bis zum August unter gellendem Geschrei durch die Straßen unserer Städte jagen oder die Spitzen alter Kirchtürme umfliegen sehen. Der Vogel ist weit verbreitet. Ich fand ihn von der Domkirche Drontheims an bis zu der von Malaga in allen Ländern Europas, die ich kennengelernt habe. Andere Beobachter begegneten ihm in dem größten Teil Nord- und Mittelasiens. Den Winter verbringt er in Afrika und Südindien. Erstgenannten Erdteil durchstreift er vom Norden bis zum Süden. Er trifft mit merkwürdiger Regelmäßigkeit bei uns ein, gewöhnlich am ersten oder zweiten Mai, und verweilt hier bis zum ersten August. In sehr günstigen Frühjahren kann es geschehen, daß einzelne auch schon in der letzten Woche des April sich bei uns zeigen, in günstigen Sommern ebenso, daß man unsern Brutvogel noch während der ersten Hälfte des August bemerkt; das eine wie das andere aber sind Ausnahmen. Im Innern Afrikas kommt er schon wenige Tage nach seinem Wegzuge an; ich sah ihn am 3. August das Minarett der Moschee Khartums umstiegen. Sein Zug hat viel Eigentümliches. In Oberägypten sieht man den merkwürdigen Vogel, der zuweilen erst am Vorgebirge der Guten Hoffnung Ruhe findet, in manchen Jahren bereits im Februar und März in großer Anzahl, und gar nicht unmöglich ist es, daß in gewissen Jahren hier schon einzelne überwintern. Zu meinem nicht geringen Erstaunen sah ich auch während unsers Aufenthaltes in Malaga zwischen dem dreizehnten und achtundzwanzigsten Oktober noch eine Menge Mauersegler die Kirchtürme umfliegen. Es waren, wie ich zu glauben geneigt bin, solche, die von Afrika aus zurückgeschwärmt waren; denn nach den eingezogenen Erkundigungen soll der Mauersegler auch die Südspitze Spaniens genau zu derselben Zeit verlassen wie die mittleren und nördlichen Teile des Landes, in denen wir vom ersten August ab nur noch einige Tage lang wenige Nachzügler beobachteten. Unter Umständen, deren Ursachen uns noch unbekannt sind, können letztere auch weiter nördlich in sehr später Zeit bemerkt werden.

Mauersegler (Cypselus alba)
Wie es scheint, wandern die Mauersegler stets in großen Gesellschaften. Sie kommen gemeinschaftlich an, und man sieht da, wo man tagsvorher nicht einen einzigen bemerkte, mit einem Male Dutzende oder selbst Hunderte, und ebenso verlassen sie eine Stadt gewöhnlich in einer und derselben Nacht. Nach Naumann sollen sie ihre Reise kurz vor Mitternacht antreten.
Ursprünglich wohl ausschließlich Felsenbewohner, hat sich der Mauersegler im Laufe der Zeit zu den Behausungen der Menschen gefunden und ist allgemach zu einem Stadt- und Dorfvogel geworden. Hohe und alte Gebäude, namentlich Türme, wurden zuerst zu Wohnsitzen oder, was dasselbe, zu Brutstätten erkoren; als die hier vorhandenen Löcher nicht mehr ausreichten, sah sich der Vogel genötigt, auch natürlichen oder künstlichen Baumhöhlungen sich zuzuwenden, und wurde so zum Waldbewohner. Er gehört zu der keineswegs unbeträchtlichen Anzahl von Vögeln, die sich bei uns zulande stetig vermehren, leidet daher schon gegenwärtig an vielen Orten und selbst in ganzen Gegenden unsers Vaterlandes an Wohnungsnot. Wo für ihn passende Felsen sich finden, bewohnt er nach wie vor solche und steigt im Gebirge bis zu ungefähr zweitausend Meter unbedingter Höhe empor.
Es wird auch dem Laien nicht schwer, unsern Mauersegler zu erkennen. Seine Bewegungen, sein Gebaren, Wesen und Treiben sind gänzlich verschieden von denen der Schwalben. Er ist, wie seine Verwandten, ein im höchsten Grade lebendiger, unruhiger, bewegungslustiger und flüchtiger Vogel. Sein Reich ist die Luft; in ihr verbringt er sozusagen sein ganzes Leben. Vom ersten Morgenschimmer an bis zum letzten Glühen des Abends jagt er in weiten Bogen auf und nieder, meist in bedeutenden Höhen, nur abends oder bei heftigem Regen in der Tiefe. Wie hoch er sich in der Ebene erheben mag, läßt sich nicht feststellen; wohl aber kann dies geschehen, wenn man ihn im Gebirge beobachtet. Von der Spitze des Montserrat und von dem Rücken des Riesengebirges aus sah ich ihn so weit in die Ebene hinausfliegen, als das bewaffnete Auge ihm folgen konnte. Hier wie dort also durcheilt er Luftschichten von mehr als tausend Meter unbedingter Höhe. Seine Flugzeit richtet sich nach der Tageslänge. Zur Zeit der Hochsonnenwende fliegt er von morgens drei Uhr zehn Minuten an spätestens bis abends acht Uhr fünfzig Minuten, wie es scheint, ohne Unterbrechung umher. Jedenfalls sieht man ihn bei uns zulande auch über Mittag seinen Geschäften nachgehen; in südlichen Ländern dagegen soll er sich um diese Zeit in seinen Höhlen verbergen. So berichtet Bolle von den Kanarischen Inseln, woselbst der Mauersegler von zehn Uhr vormittags an verschwindet und bis nachmittags in seinen Löchern verweilt. Wir kennen keinen deutschen Vogel, der ihn im Fluge überträfe. Dieser kennzeichnet sich durch ebensoviel Kraft und Gewandtheit wie durch geradezu unermüdliche Ausdauer. Der Mauersegler versteht zwar nicht die zierlichen und raschen Schwenkungen der Schwalben nachzuahmen, aber er jagt dafür mit einer unübertrefflichen Schnelligkeit durch die Luft. Seine schmalen, sichelartigen Flügel werden zeitweilig mit so großer Kraft und Hurtigkeit bewegt, daß man nur ein undeutliches Bild von ihnen gewinnt. Dann aber breitet der Vogel dieselben plötzlich weit aus und schwimmt und schwebt nun ohne jegliche sichtbare Flügelbewegung prächtig dahin. Der Flug ist so wundervoll, daß man alle uns unangenehm erscheinenden Eigenschaften des Seglers darüber vergißt und immer und immer wieder mit Entzücken diesem schnellsten Flieger unseres Vaterlandes nachsieht. Jede Stellung ist ihm möglich. Er fliegt auf- oder abwärts mit gleicher Leichtigkeit, dreht und wendet sich leicht, beschreibt kurze Bogen mit derselben Sicherheit wie sehr flache, taucht jetzt seine Schwingen beinahe ins Wasser und verschwindet wenige Sekunden später dem Auge in ungemessener Höhe. Doch ist er nur in der Luft wirklich heimisch, auf dem Boden hingegen fremd. Man kann sich kaum ein unbehilflicheres Wesen denken als einen Segler, der am Fliegen verhindert ist und auf dem Boden sich bewegen soll. Von Gehen ist bei ihm keine Rede mehr; er vermag nicht einmal zu kriechen. Man hat behauptet, daß er unfähig sei, sich vom Boden zu erheben; dies ist aber, wie ich mich durch eigene Beobachtung genügend überzeugt habe, keineswegs der Fall. Legt man einen frisch gefangenen Segler platt auf den Boden nieder, so breitet er sofort seine Schwingen, schnellt sich durch einen kräftigen Schlag derselben in die Höhe und gebraucht sodann seine Flügel mit gewohnter Sicherheit. Übrigens weiß der Mauersegler seine Füße immer noch recht gut zu benutzen. Er häkelt sich geschickt an senkrechten Mauern oder Bretterwänden an und verwendet die scharf bekrallten Zehen außerdem zur Verteidigung.
Der Segler ist ein Schreivogel, nicht aber ein Sänger, seine Stimme ein schneidender, gellender Laut, der durch die Silben »Spi spi« oder »Kri« wiedergegeben werden kann. Bei Erregung irgendeiner Art vernimmt man letzteren oft zum Überdruß, und wenn eine zahlreiche Gesellschaft durch die Straßen hindurchjagt, ist es manchmal kaum zum Aushalten. In ihren Schlaf- oder Nisthöhlen zwitschern Alte und Junge.
Unter ihren Sinnen steht das große Auge unzweifelhaft obenan; auch das Gehör kann vielleicht noch als entwickelt betrachtet werden; die übrigen Sinne scheinen stumpf zu sein. Der Mauersegler ist ein herrschsüchtiger, zänkischer, stürmischer und übermütiger Gesell, der streng genommen mit keinem Geschöpfe, nicht einmal mit seinesgleichen, in Frieden lebt und unter Umständen andern Tieren ohne Grund beschwerlich fällt. Um die Nistplätze zanken sich die Mauersegler unter lautem Geschrei oft tagelang. Aus Eifersucht packen sich zwei Männchen wütend in der Luft, verkrallen sich fest ineinander und wirbeln nun von oben bis zum Boden herab. Ihre Wut ist aber so groß, daß sie hier häufig noch fortkämpfen und sich mit Händen greifen lassen. Meinem Vater wurden Mauersegler gebracht, die tot aus der Luft herabgefallen waren. Bei der Untersuchung zeigte sich, daß ihnen während der nebenbuhlerischen Kämpfe die Brust vollständig zerfleischt worden war. Auch andere Vögel werden von dem Segler zuweilen angegriffen. So sah ihn Naumann ohne weitere Veranlassung einen Sperling, der sich Maikäferlarven vom frischen Acker aufgesucht hatte, verfolgen, nach Art eines kleinen Edelfalken wiederholt auf ihn stoßen und dem erschrockenen Spatz so zusetzen, daß dieser zwischen den Beinen der Feldarbeiter Schutz suchte. Nur seinen Jungen gegenüber legt der Mauersegler zärtliche Gefühle an den Tag.
Der Nistort wird je nach den Umständen gewählt. In Deutschland sind es entweder Kirchtürme und andere hohe Gebäude, in deren Mauerspalten, oder Baumhöhlungen der verschiedensten Art, seltener Erdhöhlungen in steilen Wänden, in denen unser Segler sein Nest anbringt. Regelmäßig vertreibt er Stare oder Sperlinge aus den für sie auf Bäume gehängten Nistkasten und ist dabei so rücksichtslos, daß er sich selbst von den brütenden Staren- oder Sperlingsweibchen nicht abhalten läßt, sondern ihnen oder ihrer Brut sein weniges Geniste im buchstäblichen Sinn des Wortes auf den Rücken wirft und sie so lange quält, bis sie das Nest verlassen. Findet er ernsteren Widerstand, so greift auch er zu seinen natürlichen Waffen und kämpft verzweifelt um eine Stätte für seine Brut. »Ein Star«, schreibt mir Liebe, »der bei Verteidigung seiner Burg gegen einen Mauersegler von diesem arg verletzt und zuletzt, als der Garteneigentümer ihm zu Hilfe kommen wollte, verendet in dem Kasten gefunden worden war, zeigte tiefe Risse in der Haut der Flügelbeuge und des Rückens, namentlich aber auch am Kopf, wo sogar die Haut teilweise abgelöst war. Solche Wunden kann der Segler unmöglich mit seinem weichen, biegsamen Schnabel beibringen; sie lassen sich nur erklären, wenn man annimmt, daß sie mit ihren zwar kleinen, aber scharf bekrallten Füßen kämpfen, falls Schnabel und Flügel nicht mehr ausreichen wollen.« Kein Wunder, daß vor einem so ungestümen und gefährlichen Gegner selbst der kräftige Star seine Brut im Stich und dem Mauersegler überlassen muß. Dieser kümmert sich nicht im geringsten um die Klagen der betrübten Eltern, wirft aus der Luft gefangene Federn, Läppchen und andern Kram auf die Eier oder bereits erbrüteten Jungen, zerdrückt teilweise die ersteren, erstickt die letzteren, überkleistert mit seinem Speichel Eier, Junge und Genist.
Im Hochgebirge, wo er bis über den Waldgürtel und an schönen Sommertagen bis zum höchsten Gürtel aufsteigt, kümmert sich der Mauersegler weder um alte Gebäude noch um Baumhöhlungen, weil ihm hier zahllose Spalten und Ritzen höherer Felsenwände geeignete Nistplätze in beliebiger Menge bieten; er bevorzugt dann höchstens große, trockene Höhlen vor andern, minder zweckdienlichen Brutstätten und bewohnt solche oft zu Hunderten. Gleichgültig oder rücksichtslos andern Vögeln gegenüber, drängt er sich ohne Bedenken in deren Mitte. Wir fanden ihn in Spanien im innigsten Vereine mit Turmfalken, Steinsperlingen und Rötlingen; Alexander von Homeyer traf ihn auf den Balearen unter Felsentauben und Fliegenfängern, Göbel im Süden Rußlands unter Bienenfressern und Blauraken, Eugen von Homeyer in Vorpommern mit Uferschwalben, deren Nesthöhlen er sich angeeignet, in einer und derselben Erdwand nistend an. Wo beide europäische Seglerarten zusammen vorkommen, wie in den Gebirgen der Schweiz und Spaniens, siedeln auch sie sich gemeinschaftlich an einem und demselben Ort an. Wenn ein Pärchen einmal eine Nisthöhle sich erworben hat, kehrt es alljährlich zu derselben zurück und verteidigt sie hartnäckig gegen jeden andern Vogel, der Besitz von ihr nehmen will. Die Wiege der Jungen besteht aus Halmen, Heufaden, dürren Blättern, Zeuglappen, Haaren und Federn, die entweder aus Sperlingsnestern weggenommen oder bei heftigem Wind aus der Luft aufgeschnappt, seltener aber vom Boden oder von den Baumästen abgerissen, ohne Auswahl zusammengelegt, dann aber gänzlich mit dem kleberigen Speichel, der wie bei andern Seglern an der Luft erhärtet, überzogen werden. Zwei, höchstens drei sehr lang gestreckte, fast walzenförmige und an beiden Enden ungefähr gleichmäßig zugerundete, weiße Eier bilden das Gelege. Das Weibchen brütet allein und wird währenddem von dem Männchen gefüttert, jedoch nur, wenn das Wetter günstig ist; denn bei länger anhaltendem Regen kann dieses nicht so viel Atzung herbeischaffen, als zwei Mauersegler bedürfen, und das Weibchen sieht sich dann genötigt, selbst nach Nahrung auszugehen. Die Jungen werden von beiden Eltern geatzt, wachsen aber sehr langsam heran und brauchen mehrere Wochen, bis sie flugbar sind. Man findet die Eier frühestens Ende Mai, die eben ausgekrochenen Jungen Mitte Juni oder Anfang Juli, die ausgeflogenen Jungen erst zu Ende des Monats.
Der Mauersegler ernährt sich von sehr kleinen Kerbtieren, über die man aus dem Grund schwer ins klare kommen kann, als ein erlegter Vogel seine gefangene Beute größtenteils bereits verdaut, mindestens bis zur Unkenntlichkeit zerdrückt hat. Jedenfalls müssen die Arten, die seine hauptsächlichste Nahrung bilden, in sehr hohen Luftschichten und erst nach Eintritt entschieden günstiger Witterung fliegen. Denn nur so läßt sich das späte und nach den Örtlichkeiten verschiedene Kommen und Verweilen des Mauerseglers erklären. Daß er, wie seine Verwandten, die allerverschiedenartigsten fliegenden Kerbtiere, beispielsweise Bremsen, Käfer, kleine Schmetterlinge, Mücken, Schnaken, Libellen und Hafte, nicht verschmäht, wissen wir wohl, da sich die Überreste der genannten Arten in den ausgewürgten Gewöllen auffinden lasten; sie aber sind es gewiß nicht, die den Hauptteil der Mahlzeiten eines Mauerseglers ausmachen, weil im entgegengesetzten Fall der Vogel nicht nötig hätte, bis zum Mai in der Fremde zu verbleiben und die Heimat bereits im August wieder zu verlassen. Im Süden seines Verbreitungsgebietes fliegen seine Jagdtiere erklärlicherweise früher, im Norden später, hier wie dort aber länger als bei uns zulande, und einzig und allein diese Annahme erklärt die verschiedene Zeit seines Kommens und Gehens. Auch er bedarf, wie alle Arten seiner Familie, eine sehr erhebliche Menge von Nahrung, um den außerordentlichen Verbrauch seiner Kräfte zu ersetzen. Einige Beobachter haben behauptet, daß er nicht trinke; diese Angabe ist jedoch falsch, wie ich, gestützt auf eigene Beobachtungen, versichern kann. Bäder nimmt er wahrscheinlich nur, wenn es regnet; in das Wasser taucht er sich nicht ein, wie Schwalben es tun. Seine fast ununterbrochene Tätigkeit erklärt sich einzig und allein durch seinen beständigen Heißhunger; gleichwohl kann er im Notfall erstaunlich lange fasten; gefangene Segler, die ohne Nahrung gelassen wurden, sollen erst nach sechs Wochen dem Hungertode erlegen sein.
Alle Seglerarten haben wenig Feinde. Bei uns zulande jagt höchstens der Baumfalk dem nur fliegend sich zeigenden und im Fluge so überaus raschen Vogel nach. Auf seinen Winterreisen bedrohen ihn andere Falken derselben Familie. Die Jungen mögen zuweilen von den Siebenschläfern und andern kletternden Nagetieren heimgesucht werden, jedoch vielleicht nur dann, wenn das Nest, wie erwähnt, in Starkübeln oder in Baumhöhlen angelegt wurde. Der Mensch verfolgt ihn bei uns zulande erst, seitdem, oder nur da, wo er den Staren lästig und gefährlich wird; jeder Verständige aber würde wohl tun, ihm, wie Liebe anrät, Wohnungen, flache Kästchen von etwa fünfzig Zentimeter lichter Länge, fünfzehn Zentimeter Breite und halb so viel Höhe mit rundlichem, fünf Zentimeter weitem Eingangsloch an der Stirnseite und innen von nestartiger Ausfütterung, wenigstens einigem Geniste, zu schaffen, um dadurch ihm und mittelbar den jetzt bedrohten Staren Schutz zu gewähren. Im Süden Europas gilt das Fleisch der Jungen als vortrefflich und ist deshalb sehr gesucht.
*
Salanganen ( Collocalia) nennt man die seit mehreren Jahrhunderten bekannten und noch heutigestags wenig gekannten Segler, die die berühmten eßbaren Nester bauen. Die Kennzeichen der Sippe sind: geringe Größe, sehr kleiner, starkhakiger Schnabel und sehr schwache Füße, deren Hinterzehe sich nach hinten richtet, ziemlich lange Flügel, in denen die zweite Schwinge die längste ist, und mittellanger, gerade abgestutzter oder leicht ausgeschnittener Schwanz. Das Gefieder ist ziemlich hart, aber einfach gefärbt. Unter den inneren Teilen bedienen vor allem die sehr entwickelten Speicheldrüsen Beachtung.
Das Urbild der Sippe, die Salangane ( Collocalia nidific), übertrifft unsere Uferschwalbe kaum an Größe; ihre Länge beträgt dreizehn, die Breite dreißig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Das Gefieder der Oberseite ist dunkel rauchschwarzbraun mit Erzschimmer, das der Unterseite rauchgraubraun. Die Schwingen des sehr schwach ausgeschnittenen Schwanzes sind etwas dunkler als die Oberseite und einfarbig schwarz. Das Auge hat tiefbraune, der Schnabel wie der Fuß schwarze Färbung.

Salangane (Collocalia nidifica)
Früher kannte man die Salangane nur als Bewohnerin der Sundainseln; in der Neuzeit hat man sie auch in den Gebirgen von Assam, in den Nilgerris, in Sikkim, Arrakan, längs der Ostküste der Bucht von Bengalen, in Siam, Cochinchina, auf Ceylon, den Nikobaren und Andamanen beobachtet. Sie ist die Art, über die das meiste berichtet und gefabelt worden ist. »An der Küste von China«, sagt der alte Bontius, »kommen zur Brütezeit kleine Vögelchen vom Geschlecht der Schwalben aus dem Innern des Landes an die Klippen des Meeres und sammeln in dem Meerschlamm am Grund der Felsen einen zähen Stoff, möglicherweise Walrat oder Fischlaich, aus dem sie ihre Nester bauen. Die Chinesen reißen diese Nester von den Klippen und bringen sie massenhaft nach Indien, wo sie für teures Geld gekauft, in Hühner- und Hammelbrühe gekocht und von Feinschmeckern allen übrigen Gaumenreizen vorgezogen werden.« Bis in die neueste Zeit wird diese Meinung mehr oder weniger festgehalten. Fast sämtliche Reisebeschreiber sind der Ansicht, daß der Stoff zu den eßbaren Nestern dem Meer und seinen Erzeugnissen entnommen werde. Erst Raffles hält den Baustoff für eine Absonderung der Schwalbe selbst, die zuweilen mit solcher Anstrengung ausgebrochen werde, daß sich Blut mit ihm vermische. Home besichtigte daraufhin den Magen der Salangane und fand namentlich die Ausführungsgänge der Magendrüsen ganz eigentümlich gestaltet, die Mündung derselben röhrenförmig und verlängert, in mehrere Lappen wie eine Blume zerteilt. Diese Lappen, meint Home, sollen den Schleim zu dem Nest absondern. Marsden untersuchte den Stoff der Nester und fand, daß er ein Mittelding zwischen Gallerte und Eiweiß ist. Er widersteht geraume Zeit den Einwirkungen des heißen Wassers, quillt nach einigen Stunden aus und wird beim Trocknen wieder hart, aber spröde, weil etwas Gallerte im Wasser bleibt. Durch Bernsteins umfassende Beobachtungen wissen wir jetzt genau, aus welchem Stoff die eßbaren Schwalbennester bestehen.
»Es darf uns gar nicht wundern«, sagt dieser ausgezeichnete Forscher, »daß so höchst verschiedene Ansichten über den Stoff der eßbaren Nester bestanden; denn solange man den Angaben der unwissenden und abergläubischen Eingeborenen unbedingten Glauben schenkte und ihre Aussagen als wahr annahm oder sich durch die äußere Ähnlichkeit jener Nester mit andern ganz verschiedenen Stoffen zu voreiligen Schlußfolgerungen verleiten ließ, durfte man kaum hoffen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Nur durch eigene, vorurteilsfreie Beobachtung der Vögel an ihren Brutplätzen konnte man zum Ziele gelangen. Dies ist jedoch mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden, da diese Tiere in dunklen, kaum zugänglichen Höhlen nisten, in denen es oft schwer fällt, die nächsten Gegenstände deutlich zu unterscheiden, wie viel mehr erst die äußerst beweglichen Vögel zu beobachten. Dies gilt jedoch nur von der Salangane im engeren Sinne. Viel leichter ist es, eine andere Art zu beobachten, die auf Java einheimisch ist und dort Kusappi genannt wird, da sie ihre Nester an besser zugänglichen Stellen anlegt, entweder in den vorderen, helleren Teilen der Höhlen, die auch durch die Salanganen bewohnt werden, oder auch an ganz freien Stellen, an überhängenden Felswänden und dergleichen. Mehrere Male war ich so glücklich, diese Art bei der Anlage ihres Nestes genau beobachten zu können, während es mir bei der Salangane aus den oben angeführten Gründen seltener und nie so vollkommen glückte.
Die eßbaren Nester sind ihrer äußeren Gestalt nach schon lange bekannt, und mehrere der älteren Schriftsteller haben gute und genaue Beschreibungen derselben gegeben. Sie haben im allgemeinen die Gestalt des Viertels einer Eischale, wenn man sich diese ihrem Längsdurchmesser nach in vier gleiche Teile zerfällt denkt. Von oben sind sie offen, während der Felsen, an dem sie befestigt sind, zugleich die hintere Wand des Nestes bildet. Dieses selbst ist äußerst dünn; doch breitet sich sein oberer, freier Rand nach hinten, da, wo er sich an den Felsen anlegt, auf beiden Seiten in einen flügelförmigen Anhang von verschiedener Stärke aus, der, indem er mit breiter, platter Grundlage mit dem Gestein verbunden ist, die hauptsächlichste Stütze für das Nest selbst bildet. Letzteres besteht aus einem, bei der erwähnten Dünnheit der Nestwände meistens durchscheinenden, weißlich oder bräunlich gefärbten, leimartigen Stoffe, in dem man schon bei oberflächlicher Betrachtung deutliche Querstreifung wahrnimmt. Die Querstreifen verlaufen wellenförmig, mehr oder weniger in gleicher Richtung miteinander und sind offenbar durch das schichtenweise Auftragen der Neststoffe entstanden. Sie sind die einzige Spur eines Gefüges, die man an diesen Nestern bemerken kann. Die dunkleren, bräunlichen, im Handel wenig geschätzten Nester halte ich für ältere, in denen Vögel ausgebrütet und aufgezogen worden sind, die weißen, teuren dagegen für neu angelegte. Andere glauben sie zwei verschiedenen Vogelarten zuschreiben zu müssen; da ich noch keinen aus einem braunen Neste gefangenen Vogel habe bekommen können, vermag ich die Sache nicht zu entscheiden. Die vielfältigen Übergänge von ganz braunen zu völlig weißen Nestern sowie ihr vollkommen gleicher Bau sprechen für eine Art. Manche Nester zeigen, zumal an ihrer inneren Seite, eine zellen- oder maschenähnliche Bildung, die offenbar eine Folge ist der beim Verdunsten des ursprünglich feuchten Stoffes eintretenden Verdickung und Zusammenziehung derselben. Endlich finden sich noch hier und da einzelne kleine Federn als zufällige Beimengung in und an den Neststoffen.
In dieses Nest nun legt der Vogel, ohne weitere Unterlage, seine beiden glänzendweißen, ziemlich langen und spitzigen Eier. Bisweilen findet man auch deren drei; doch ist zwei wohl die gewöhnliche Anzahl. Ihr Längendurchmesser beträgt etwa zwanzig, ihr Querdurchmesser vierzehn Millimeter.
Das Nest des Kusappi ( Collocalia fuciphaga) ähnelt in seiner äußeren Gestalt dem der Salangane vollkommen, unterscheidet sich von demselben jedoch wesentlich dadurch, daß es hauptsächlich aus Pflanzenstengeln und dergleichen besteht, und daß jene eigentümliche, leim- oder hornartige Masse nur dazu dient, jene Stoffe untereinander zu verbinden und das ganze Nest an seinem Standort zu befestigen. Daher findet sich dieselbe in größerer Menge an den hinteren Teilen des Nestes, zumal an den flügel- oder armförmigen Fortsätzen des oberen, freien Randes. Diese finden sich übrigens weniger regelmäßig als bei den Nestern der andern japanischen Art und fehlen bisweilen gänzlich, besonders wenn der übrige Baustoff ein festerer, einer Unterstützung weniger bedürftiger ist. Ich besitze eine ziemlich bedeutende Anzahl Nester dieser Vögel, die unter dem Dachstuhl eines öffentlichen Gebäudes in Batavia gefunden wurden. Sie sind durchgängig aus feinen, sehr schmiegsamen Blumenstengeln, Pferdehaaren und einzelnen Grashalmen erbaut, welche Stoffe beinahe in gleicher Richtung auf- und übereinander liegen, ohne unter sich, wie bei den Nestern anderer Vögel, verflochten zu sein. Hier hatte das Tier also ein Bindemittel nötig, und daher sind die genannten Baustoffe mit jener mehrerwähnten leim- oder hornähnlichen Masse überzogen und verbunden, ja, dieselbe findet sich in größerer Menge an den hinteren Teilen des Nestes. Drei andere Nester fand ich an einer überhängenden Felswand. Sie waren aus andern Pflanzenstoffen, die sich leicht untereinander verbinden und verflechten lassen. Daher machte der Vogel in diesem Fall auch nur selten von jener Leimmasse Gebrauch; ich fand sie hauptsächlich nur am hinteren Teile des Nestes angewendet; die Pflanzenstoffe waren nur mit dem Leim an die Felsen angeheftet oder höchstens dünn überzogen worden.«
Bernstein kommt nun auf die alten Sagen zurück und erzählt, daß er wiederholt Kusappis beobachtete, während sie sich mit dem Nestbaue beschäftigten, andere eine Zeitlang lebend unterhielt und andere zergliederte und so das Ergebnis gewonnen, daß jener leimartige Stoff nichts anderes ist, als eine Absonderung des Vogels selbst. In einer seiner früheren Mitteilungen hat er bereits auf die auffallende Entwicklung der Speicheldrüsen, namentlich der Unterzungendrüsen, aufmerksam gemacht und die Vermutung ausgesprochen, daß sie es sein möchten, die den Nestschleim absondern. Hiervon hat er sich seitdem überzeugt und zugleich auch gefunden, daß die genannten Drüsen nur während der Brutzeit zu zwei großen Wülsten anschwellen, schon während des Eierlegens aber wieder zusammenschrumpfen und dann wenig größer erscheinen als dieselben Drüsen bei andern Vögeln. Gedachte Drüsen also scheiden in reichlicher Menge einen dicken, zähen Schleim ab, der sich im vorderen Teile des Mundes, in der Nähe der Ausführungsgänge der genannten Drüsen unterhalb der Zunge ansammelt. Dieser Schleim, der eigentliche Speichel, hat viele Ähnlichkeit mit einer gesättigten Lösung von arabischem Gummi und ist gleich diesem so zähe, daß man ihn in ziemlich langen Fäden aus dem Mund herausziehen kann. Bringt man das Ende eines solchen Schleimfadens an die Spitze eines Hölzchens und dreht dieses langsam um seine Achse, so läßt sich auf diese Weise die ganze Masse des augenblicklich vorhandenen Speichels aus dem Munde und selbst aus den Ausführungsgängen der genannten Drüsen herausziehen. An der Luft trocknet er bald ein und ist dann in nichts von jenem eigentümlichen Neststoff verschieden. Auch unter dem Vergrößerungsglas verhält er sich wie dieser. Zwischen Papierstreifen gebracht, klebt er dieselben wie arabisches Gummi zusammen. Ebenso kann man Grashalme damit überziehen und dann zusammenkleben.
»Wenn nun die Vögel mit der Anlage ihres Nestes beginnen wollen, so fliegen sie, wie ich öfters beobachtet habe, wiederholt gegen die hierzu gewählte Stelle an und drücken hierbei mit der Spitze der Zunge ihren Speichel an das Gestein. Dies tun sie oft zehn- bis zwanzigmal hintereinander, ohne sich inzwischen mehr als einige Meter weit zu entfernen. Mithin holen sie den Baustoff nicht jedesmal erst herbei, sondern haben ihn in größerer, sich schnell wieder ansammelnder Menge bei sich. So beschreiben sie zunächst eine Halbkreis- oder hufeisenförmige Form an der erwählten Stelle. Die anfangs dickflüssige Masse verdunstet bald und bildet nun eine feste Grundlage für das weiter zu bauende Nest. Der Kusappi bedient sich hierzu, wie erwähnt, verschiedener Pflanzenteile, die er mehr oder weniger mit seinem Speichel überzieht und verbindet, die Salangane hingegen fährt mit dem Auftragen ihres Speichels allein fort. Sie klammert sich dann, je mehr der Nestbau fortschreitet, an dasselbe an, und indem sie unter abwechselnden Seitenbewegungen des Kopfes den Speichel auf den Rand des schon bestehenden und verhärteten Nestteiles aufträgt, entstehen jene oben erwähnten wellenförmigen Querstreifen. Bei dieser Gelegenheit mögen dann wohl auch die einzelnen kleinen Federn, die wir an den Nestern finden, an dem halb eingetrockneten Speichel kleben bleiben und als zufällige Bestandteile dem Neststoffe beigefügt werden. Auch mag wohl der Reiz, den die angeschwollenen Drüsen verursachen, die Tiere veranlassen, sich der Absonderung derselben durch Drücken und Reiben zu entledigen. Hierbei kann es denn bisweilen geschehen, daß diese Teile wund gerieben werden und somit Veranlassung gegeben wird zum Austritt einiger Blutstropfen; diesem Umstände dürften wohl die kleinen Blutspuren, die man bisweilen an den Nestern wahrnimmt, ihre Entstehung verdanken, übrigens muß ich noch erwähnen, daß die Absonderung des Speichels sowie vieler Drüsen in geradem Verhältnisse zur Menge der aufgenommenen Nahrung steht. Wenn ich meine einige Tage lebend unterhaltenen Vögel gut gefüttert hatte, trat alsbald reichliche Speichelabscheidung ein, die hingegen sehr gering war, wenn die Tiere einige Stunden gehungert hatten. Und hiermit stimmen andere Beobachtungen überein, zumal der Umstand, daß zu manchen Zeiten die Vögel ihre Nester schneller bauen und diese größer und schöner sind als zu andern. Im ersteren Falle hatten die Tiere höchstwahrscheinlich Überfluß an Nahrung, im letzteren Mangel.«
Solchen Beobachtungen gegenüber bedarf es weiterer Auslassungen nicht. Wir wissen jetzt ganz genau, welchen Stoff die Feinschmecker verzehren, wenn sie die berühmten indischen Vogelnester zu sich nehmen.
Nicht so ausführlich sind wir über das Leben der Schwalbe selbst unterrichtet. Die eingehendste Beschreibung verdanken wir Junghuhn; doch schildert auch er uns weniger den Vogel selbst als seine Aufenthaltsorte. »Die schroff gesenkten Mauern der Südküste von Java«, sagt er, »bieten einen malerischen Anblick dar. Das üppigste Waldgebüsch hat sich bis zur äußersten Grenze des Landes vorgedrängt; ja, Pandanen wurzeln noch an den schroffen Wänden selbst oder blicken zu Tausenden vom Rande der Felsmauern in geeigneter Stellung hinab. Unten am Fuße der Mauer ist die Brandung des dort sehr tiefen Meeres tätig und hat im Verlaufe von Jahrtausenden weit überhängende Buchten im Kalkfelsen gebildet. Hier ist es, wo die Salangane gefunden wird. Dort wo die Brandung am stärksten tobt, wo das Meer Höhlen ausgewaschen hat, sieht man ganze Schwärme dieser kleinen Vögel hin und her schwirren. Sie fliegen durch den dichtesten Wellenschaum, der an den Felsen zerschellt. Begibt man sich auf das hervorragende Felsenvorgebirge östlich von Rongkap und setzt sich am Rande der Felsenmauer hin, so erblickt man am Fuße der diesseitigen Wand den Eingang zur Höhle. Folgt man dann mit seinen Blicken dem Spiele des Meeres, das unaufhörlich auf- und niederwogt, so gewahrt man, wie die Öffnung der Höhle oft ganz unter Wasser verborgen ist, bald wieder offen steht, und wie im letzteren Falle die Schwalben mit Blitzesschnelle aus- und einziehen. Ihre Nester kleben an dem Felsen tief im Innern, an der hochgewölbten, finsteren Decke der Höhle. Sie wissen den rechten Augenblick, an dem der enge Eingang zur Höhle gerade offen steht, geschickt zu benutzen, ehe ein neuer Berg von Wasser ihn verschließt. Sooft eine größere Woge sich heranwälzt, tritt das Meer mit dumpfem Donner in die Höhle. Die Öffnung ist dann ganz geschlossen; die Luft im Innern der Höhle wird zusammengepreßt, durch das hineingedrungene Wasser aus einen kleinen Raum zusammengedrängt und übt nun einen Gegendruck aus. Sobald also die Woge hereintritt und die Oberfläche des Meeres am Fuße der Wand wieder anfängt, sich zu einem Tale hinabzusenken, offenbart sich die Ausdehnungsfähigkeit der eingeschlossenen Luft; das hineingedrungene Wasser wird, größtenteils zerstäubt, wieder herausgespritzt, herausgeblasen, kann die noch nicht ganz abgezogene Brandung in wagerechter Richtung bis hundert Meter weit mit Gewalt durchbrechen, und ähnlich wie aus einem losgebrannten Geschütz der Dampf hervorschießt, so fährt nun eine Säule von Wasserstaub laut pfeifend aus der Höhle heraus, die bald wieder von einer neuen Woge geschlossen wird. Während draußen in einiger Entfernung von der Küste der tief indigoblaue Spiegel des Meeres ruhig und hell glänzend daliegt, hört es hier am Fuße der Felsenmauern nicht aus, zu kochen und zu toben. Hier bricht sich das Sonnenlicht in jeder Welle, die zu Staub zerpeitscht wird, mit wunderbarer Klarheit? hier sieht man in jeder Säule, die aus der Höhle geblasen wird, die glänzendsten Regenbogen hingezaubert.
Abgesehen von diesen durch Großartigkeit der Natur und Reichhaltigkeit der Nesternten hervorragenden Siedelplätzen der Salangane kommt diese noch an vielen andern Orten Javas auch im Innern des Landes vor. Die eingangs erwähnte Höhle liegt in der Residenz Bagalen, die Siedlungen der Schwalbe in der Mitte der Insel in den Kalkbergen der Perangeregentschaft in einer unbedingten Höhe von sechs- bis achthundert Meter, ungefähr gleich weit von der Nord- und Südküste entfernt. Hier werden sechs, zu Karang-Bolong neun Höhlen von den Schwalben bewohnt. Bei der Gedahöhle liegt der Rand der Küstenmauer fünfundzwanzig Meter über dem Meeresspiegel zur Ebbezeit, und die Mauer biegt sich eingebuchtet nach innen, bildet jedoch in einer Höhe von acht Meter über dem Meere einen Vorsprung, bis wohin die aus Rotan gefertigte Leiter senkrecht vom Rande herabhängt. Diese Leiter besteht aus zwei seitlichen Rotansträngen, die im Abstände von fünfzig Zentimeter durch Querhölzer miteinander verbunden sind. Die Decke des Eingangs der Höhle liegt jedoch nur drei Meter über dem Spiegel des Meeres, das den Boden des Innenraumes auch zur Ebbezeit in seiner ganzen Ausdehnung bedeckt, während zur Flutzeit die Öffnung, wie geschildert, von jeder herbeirollenden Woge gänzlich geschlossen wird. Die Sammler der Vogelnester können daher nur zur Ebbezeit und bei sehr stillem, niedrigem Wasser in das Innere des Raumes gelangen. Aber auch dann noch würde dies unmöglich sein, wäre der Felsen am Gewölbe der Höhle nicht von einer Menge von Löchern durchbohrt, zernagt und zerfressen. In diesen Löchern, an den hervorragendsten Zacken, hält sich der stärkste und kühnste der Nestersammler oder, wie man auf Java sagt, der Nesterpflücker, der zuerst hineinklettert, fest und bindet Rotanstränge an ihnen an, so daß sie von der Decke anderthalb bis zwei Meter herabhängen. An ihrem Ende werden andere lange Rotanstränge festgeknüpft, die in einer mehr wagerechten Richtung unter der Decke hinlaufen, deren Unebenheiten auf- und absteigend folgen, sich wie eine hängende Brücke durch die ganze über fünfzig Meter breite Höhle hinziehen und im Innern mit der absteigenden Decke bis zu acht Meter über den Spiegel des Meeres sich erheben. Die Daharhöhle ist bei fünfzehn Meter Breite hundertundfünfzig Meter lang. Ihr Eingang liegt nur vier Meter über dem Spiegel des Meeres, das auch ihren Boden bedeckt, und steigt im Innern bis zu zwanzig Meter an.
Nach den Angaben der ältesten und erfahrensten Nestpflücker und eigenen Beobachtungen konnte Junghuhn über das Leben der Salanganen folgendes mitteilen: Die Vögel wohnen, auch wenn sie nicht brüten, in den geschilderten Höhlen, fliegen aber, wenn sie nicht durch die Sorge um ihre Brut im Innern festgehalten werden, bei Aufgang der Sonne in gedrängtem Schwarme aus dem Innern der Höhle und verschwinden, so daß man weder im Gebüsche noch über Bächen und Teichen im Laufe des Tages eine einzige von ihnen erblickt. Erst spät am Abend, wenn die Sonne untergeht und die Fledermäuse sich zum Ausfliegen anschicken, kehrt der ganze Schwarm auf einmal zurück, um des Nachts in der Höhle zu bleiben. Sie fliegen pfeilgeschwind durch die engsten Spalten, ohne anzustoßen, und dies auch, wenn es vollkommen finster ist. Höher gelegene Höhlen teilen sie mit den Fledermäusen, ohne sich gegenseitig zu behelligen. Letztere schlafen bei Tage, zu welcher Zeit die Salanganen die Höhlen verlassen haben, um Nahrung zu suchen, und fliegen, wenn die gefiederten Mitbewohner des Raumes des Abends heimkehren, aus, um erst am folgenden Morgen wieder zurückzukommen, zu welcher Zeit dann die Salanganen von neuem ausziehen. So sind diese verschiedenen Tiere doch nicht gleichzeitig beieinander und stören einander nicht. Die eine Hälfte fliegt jederzeit aus, wenn die andere einfliegt, und kehrt zurück, wenn sie von der andern Schar verlassen wird. Nur wenige Nestersammler haben erkannt, daß die Salanganen wie ihre Verwandten auch, von kleinen Kerbtieren, insbesondere von Mücken leben; die meisten nehmen im Gegenteile verschiedene Seetiere und Teile derselben als die Beute an, welcher die Salanganen nachstreben, glauben daher auch, baß die im Innern der Insel brütenden Vögel tagtäglich mindestens zweimal je siebzig Kilometer zurücklegen müßten, um von ihrer Bruthöhle zum Meere und wieder zum Neste zu gelangen. In den Bandongschen Höhlen brüten die Vögel nach Versicherung der Pflücker viermal im Laufe des Jahres, und während der Brutdauer bleibt stets die Hälfte von ihnen in der Höhle. Männchen und Weibchen sollen sich im Brüten sechsstündlich ablösen und alle Paare bis auf einen Unterschied von zehn Tagen zu gleicher Zeit ihrem Brutgeschäfte obliegen. Niemals machen die Salanganen von einem Neste zweimal Gebrauch, bauen vielmehr bei jedesmaligem Eierlegen ein neues Nest, obgleich sie an ihm einen ganzen Monat lang arbeiten müssen. Das alte Nest wird stinkend und fällt ab.
Man erntet drei- oder viermal im Jahre, in den Bandongschen Höhlen das erstemal im April oder Mai, das zweitemal im Juli oder August, das drittemal im November oder Dezember. Beim Beginn des Einsammelns der Nester sind die Jungen erst aus der Hälfte der Nester ausgeflogen. In der andern Hälfte findet man teils noch unflügge Junge, teils Eier. Erstere werden gegessen, letztere weggeworfen; die Hälfte der jungen Brut geht also bei jeder Ernte verloren. Gleichwohl vermindert sich die Anzahl der Salanganen nicht, ebensowenig wie sie sich da vermehrt, wo man im Jahre nur dreimal erntet und eine Brut ausfliegen läßt. In den Bandongschen Höhlen gilt die erste Ernte als die schlechteste, die zweite als die beste, die dritte als eine ziemlich gute. Die Ernte beginnt, wenn die Mehrzahl der Nester Junge zeigt, die bereits mit Stoppeln versehen sind. Bis zu dieser Zeit, die man die der Reife nennt, begeben sich einige Pflücker jeden Tag in die Höhle, um nachzusehen, in welchem Zustande die Nester mit ihrem Inhalt sich befinden. Diejenigen Nester, in denen Junge mit keimenden Federn liegen, sind die besten und bilden Ware erster, die Nester mit noch ganz nackten Jungen solche zweiter und die Nester mit Eiern endlich solche dritter Güte. Nester mit flüggen Jungen sind schwarz und unbrauchbar.
Die sechs Bandongschen Höhlen liefern jährlich im Durchschnitt dreizehntausendfünfhundertzwanzig oder jedesmal dreitausenddreihundertundachtzig Nester, werden also von sechstausendsiebenhundertundsechzig Vögeln bewohnt. Die Anzahl der Nester, die man zu Karang-Bolong erntet, beläuft sich auf fünfhunderttausend, und wenn man diese auf drei Ernten verteilt, so ergibt sich, daß mehr als dreiunddreißigtausend Salanganen in der Höhle von Karang-Bolong wohnen müssen. Einhundert Nester liefern durchschnittlich einen Kati, und hundert Katis bilden einen Pikol oder fünfhundert Kilogramm. Solcher Pikols erntet man jährlich neunundvierzig bis fünfzig. Die Chinesen bezahlen für den Pikol Nester vier bis fünftausend Gulden oder einen Gulden für zwei bis zweieinhalb Nester, so daß die jährlichen Einkünfte, abgerechnet zehntausend Gulden Unkosten, ungefähr vierundzwanzigtausend Gulden betragen. Diese Angaben wurden von Junghuhn im Jahre 1847 aus den Mitteilungen verschiedener Pflücker, besonders aber aus den Berichten des Aufsehers der Vogelnesthöhlen in Karang-Bolong geschöpft. Hier bilden die Nestpflücker gleichsam eine besondere Kaste, deren Geschäft vom Vater auf den Sohn erbt.
Außer auf Java erntet man auch an verschiedenen andern Plätzen, eigentlich im ganzen indischen Inselmeere, Salanganennester, so daß den Schätzungen der Reisenden zufolge alljährlich Millionen von ihnen nach China ausgeführt werden und der Gesamtwert der Ausbeute ungefähr sechs Millionen Mark beträgt.