
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Papageien sind befiederte Affen. Dies findet nicht bloß der Laie heraus, sondern muß auch der Forscher anerkennen. Wenn es irgendwie zulässig ist, gewisse Tiere einer Klasse mit denen einer andern zu vergleichen, ist die Berechtigung obiger Worte erwiesen. Das wesentlichste Merkmal der Papageien ist der Schnabel, der mit keinem andern Vogelschnabel verwechselt werden kann, so groß auch seine Ähnlichkeit mit diesem oder jenem erscheinen will. Bei der ersten oberflächlichen Betrachtung scheint der Papageischnabel dem der Raubvögel zu ähneln; er ist jedoch bedeutend dicker und stärker, verhältnismäßig höher und im ganzen übereinstimmender geformt. Beachtenswert ist das Vorkommen einer Wachshaut, d. h. einer unbefiederten, aber auch nicht hornigen, durch ihren Namen bezeichneten Stelle, die wie ein Sattel auf der Wurzel des Oberschnabels liegt, und außer den Papageien nur noch den Raubvögeln zugesprochen werden kann. Als hervorragendste Eigentümlichkeit des Papageischnabels sieht Finsch mit Recht das Verhältnis seiner Höhe zur Länge an; erstere, die an der Wurzel die Breite meist um das doppelte übertrifft, ist wenig geringer als die Länge, zuweilen sogar größer. Nicht minder bezeichnend ist der Bau anderer Gliedmaßen und des inneren Leibes der Papageien. »Die Beine«, sagt Burmeister, »sind dick, stark, fleischig, aber nie hoch; der Lauf ist viel kürzer als die Mittelzehe und stets nur mit kleinen Schuppentäfelchen bekleidet. Die ziemlich langen Zehen, deren äußere und innere nach hinten gewendet sind, haben eine starke Sohle, aber nur an der Spitze einen besonderen Ballen; sie sind auf der Oberseite wie der Lauf bedeckt; doch werden die Schuppen gegen die Spitze hin allmählich größer und gehen aus dem letzten Glied vor der Kralle in kurze Tafel- oder Gürtelschilder über. Die Krallen sind nicht lang, aber stark gebogen und ziemlich spitzig, jedoch nie kräftig. Der innere Vorderfinger hat gewöhnlich die kleinste Kralle, und die des Daumens pflegt nicht viel größer zu sein; die größte sitzt an dem vorderen Außenfinger; doch steht ihr die Kralle des hinteren Außenfingers nur wenig nach.« Die Flugwerkzeuge sind, laut Finsch, durchgehends wohl entwickelt, die Flügel groß und spitzig, die Schwungfedern, deren Anzahl zwischen neunzehn und zweiundzwanzig schwankt, meist aber zwanzig beträgt, und unter denen die zweite oder diese mit der dritten, auch wohl die drei ersten, die dritte und vierte, ausnahmsweise selbst die sechste und siebente die andern überragen, durch derbe Schäfte und breite Fahnen ausgezeichnet, am Ende verschmälert oder ab- und zugerundet; die Flügelspitze beträgt meist ebensoviel wie die Länge des Oberflügels oder etwas mehr; am Eckflügel stehen stets vier Federn. Die zwölf Schwanzfedern ändern hinsichtlich ihrer Gestalt wie ihrer Länge vielfach ab, und die Gestalt des Schwanzes ist demgemäß eine sehr verschiedene.
Das Kleingefieder der Papageien besteht aus einer verhältnismäßig geringen Anzahl, daher zerstreut stehender Außenfedern, die an der Außenseite einen großen Afterschaft zeigen, und Dunen dazwischen. Erstere bilden deutlich begrenzte, jedoch mannigfach abändernde Fluren; die Rückgratflur gabelt sich meist in der Höhe der Schulterblätter, die Unterflur höher oder tiefer am Halse; die Schulterflur pflegt doppelt vorhanden zu sein. Bemerken will ich noch, daß die Befiederung oft gewisse Stellen, namentlich Wangen und Augengegend, freiläßt. Die Färbung des Gefieders muß bei aller Verschiedenheit im einzelnen als eine für die Glieder der Ordnung sehr übereinstimmende bezeichnet werden. Ein mehr oder minder prächtiges Blattgrün ist vorherrschend; doch gibt es ebenso hyazinthblaue, purpurrote, goldgelbe und düsterfarbige Papageien. Bezeichnend ist die Verteilung der Farben auf dem Papageigefieder; das Vorhandensein von Farbenfeldern, wie wir es vielleicht nennen können, das häufige Vorkommen von Ergänzungs- oder Gegenfarben auf Ober- und Unterseite (Bläulichviolett, Dunkelblau, Hellblau, Grün oben, Hellgelb, Orangegelb, Zinnoberrot, Purpur unten), das sich sogar auf ein und derselben Schwung- oder Steuerfeder ausspricht, nicht minder eigentümlich das Verdecktsein brennender Farben durch weniger lebhafte, wie sich dies z. B. bei einzelnen Kakadus zeigt, deren zinnoberrote oder gelbe Federwurzeln und Dunen wegen der weißen Federspitzen kaum zur Anschauung kommen. Beide Geschlechter sind meist, aber keineswegs immer, gleich gefärbt, die jungen Vögel in der Regel wenig, ausnahmsweise jedoch erheblich von den alten verschieden.
Die Säugetiere habe ich mit Oken als »Allsinnstiere« bezeichnet und hervorgehoben, daß die Einhelligkeit und gleichmäßige Entwicklung der Sinne eine hohe Stellung bekundet. Wenden wir diese letztere Behauptung auf die Vögel an, so finden wir, daß gerade die Papageien vor ihren Klassenverwandten durch gleichmäßige Entwicklung der Sinne sich auszeichnen. Bei ihnen ist kein einziger Sinn verkümmert, wie sonst so oft bei den Vögeln, kein einziger auf Kosten der übrigen in auffallender Weise entwickelt. Der Falk zeichnet sich durch sein alle andern Sinne überwiegendes Gesicht aus, die Eule durch dieses und durch ihr in gleicher Weise ausgebildetes Gehör, der Rabe durch seinen scharfen Geruch, die Ente wahrscheinlich durch ihren feinen Geschmack, der Specht durch sein Tastgefühl, viele andere Vögel durch feines Empfindungsvermögen; der Papagei sieht, hört, riecht, schmeckt, fühlt und tastet ungefähr gleich scharf. Hinsichtlich der Entwicklung seines Gesichtes und Gehöres bedarf es keines Beweises; die Ausbildung der übrigen Sinne aber bekundet das Niesen des Papageien nach eingezogenem Rauch, die überraschende Kenntnis wohlschmeckender Waldfrüchte oder einfach ein irgendeinem gezähmten Papagei vorgehaltenes Stück Zucker, die Beobachtung des mit seiner Zunge tastenden Vogels oder endlich eine leise Berührung seines Gefieders. Unzählige Male habe ich mich von dieser Allsinnstätigkeit unserer Vögel überzeugt; sie ist nicht wegzuleugnen.
Aber noch weniger zu bestreiten ist die rein geistige Entwicklung der Papageien. Das geistige Wesen, nicht die Gestalt dieser Tiere ist es, das sie als die Affen unter den Vögeln erscheinen läßt. Wir erkennen den Affen im Papagei erst dann, wenn wir diesen geistig geprüft haben. Er hat, auf das Vogelgepräge übertragen, alle Eigenschaften und Leidenschaften des Affen, die guten Seiten desselben wie die schlechten, das Liebenswerte wie die Unarten. Er ist der klügste Vogel, den wir kennen, bleibt aber immer Affe, launenhaft, wetterwendisch. In diesem Augenblick ist er der liebenswürdigste, angenehmste Gesellschafter, im nächsten Augenblick ein unerträgliches Geschöpf. Der Papagei ist verständig, acht- und bedachtsam, vorsichtig, listig, unterscheidet sehr scharf, besitzt ein vortreffliches Gedächtnis und erweist sich deshalb der Belehrung in hohem Grad zugänglich, also bildsam; er ist selbstbewußt, stolz, auch mutig, anhänglich, ja hingebend zärtlich gegen geliebte Wesen, treu bis zum Tode, dankbar, mit Bewußtsein dankbar; er läßt sich erziehen, zum folgsamen, artigen Tier umwandeln – wie der Affe. Aber er ist auch jähzornig, boshaft, tückisch, hinterlistig und vergißt ihm angetane Beleidigungen ebensowenig wie empfangene Wohltaten; er ist rücksichtslos gegen Schwächere, mit seltenen Ausnahmen lieblos gegen Unbehilfliche oder Unglückliche – wie der Affe. Sein Wesen ist ein Gemisch von allen möglichen Eigenschaften.
Daß ein so befähigter Vogel von seinen leiblichen Begabungen den besten Gebrauch zu machen versteht, läßt sich erwarten. Man hat die Papageien andern Vögeln gegenüber zurückstellen wollen, weil man bei ihnen die Beweglichkeit vermißt, die jene teilweise zeigen. Sehr richtig ist, daß ein Falke besser fliegt, ein Specht gewandter klettert, ein Huhn rascher läuft, eine Ente sicherer schwimmt als ein Papagei. Dasselbe ließe sich aber auch zum Nachteile des Menschen sagen! In Wahrheit sind die Papageien sehr bewegungsfähige Tiere. Die großen Arten fliegen scheinbar schwerfällig auf, dann aber im raschen Zug dahin, die kleinen Arten dagegen wundervoll, so wundervoll, daß ich getröstet war über einen mir entfliehenden Wellensittich, als ich ihn fliegen gesehen. Wie ein Edelfalk jagte er durch die Luft, wie eine Schwalbe strich er dahin! »Die Araras«, sagt Prinz von Wied, »haben einen langsamen Flug, schlagen schwer mit ihren Flügeln und der lange Schweif liegt wagerecht nach hinten hinaus! die Maracanas und Perekittos fliegen außerordentlich rasch, schnellen kräftig mit den Flügeln, durchschneiden pfeilschnell die Luft. Die eigentlichen Papageien fliegen mäßig langsam und schlagen sehr schnell mit ihren kurzen Flügeln, um den dicken, kurzen, schweren Körper fortzutreiben.« Andere fliegen in Wellen-, wiederum andere in Zickzacklinien; die Kakadus zeichnen sich, wenn sie schwarmweise die Luft durchschneiden, durch wundervolle Schwenkungen aus, und nur der Eulenpapagei soll, obwohl er mit gut entwickelten Flügeln ausgerüstet ist, von letzteren niemals Gebrauch machen.
Viele Papageien scheinen fremd zu sein auf dem Boden und humpeln hier mehr, als sie gehen; es gibt aber auch Erdpapageien, die ebenso schnell und geschickt laufen wie ein Strandvogel; der australische Erdpapagei wird mit einer Schnepfe verglichen; von einem Graspapagei berichtet Gould, daß er über den Boden dahinrenne wie ein Regenpfeifer! Hüpfen im Gezweig fällt den Papageien schwer, keineswegs aber Bewegung im Geäste. Weitere Zwischenräume überfliegen, geringere überklettern sie, und zwar rasch genug, so schwerfällig das bei einzelnen auch aussehen mag. Sie helfen sich mit dem Schnabel und den Füßen fort, andere Vögel mit den Füßen allein: das ist der ganze Unterschied. Ihr Fuß wird fast zur Hand; sie gebrauchen ihn wenigstens nach Art der Hände. Der Schnabel ist bei den Papageien weit beweglicher als bei irgendeinem andern Mitglied ihrer Klasse, wird auch in vielseitigerer Weise verwendet als von den übrigen Vögeln. Der Papagei benutzt ihn wie das Nagetier seine Schneidezähne, also um Holz abzubrechen, zu zerbeißen und zu zerschleißen und endlich noch, um beim Klettern Hilfe zu leisten.
Die Stimme der Papageien ist stark, oft kreischend, aber doch nicht alles Wohlklanges bar, die mancher Arten sehr biegsam und entschieden ausdrucksvoll. Wenn große Arten gesellschaftsweise zusammenleben und gemeinschaftlich schreien, ist es allerdings kaum zum Aushalten für den menschlichen Hörer. »Man muß«, sagt Humboldt, »in den heißen Tälern der Anden gelebt haben, um es für möglich zu halten, daß zuweilen das Geschrei der Araras das Brausen der Bergströme, die von Fels zu Felsen stürzen, übertönt«. Auch die Kakadus machen sich durch weithin tönendes Geschrei bemerklich; das Kreischen einer zahlreichen Gesellschaft von Edelsittichen ist ohrzerreißend; der Lärm, den eine Schar von Zwergpapageien verursacht, wird mit dem Getöse einer Sensenschmiede verglichen. Einzelne Arten lassen bellende, andere pfeifende, jene schnurrende, andere leise murrende Laute vernehmen; diese stoßen kurze, helle Schreie, jene quakende Laute, andere gellende Rufe aus. Einige Arten schwatzen ihren Weibchen so allerliebste Liedchen vor, daß man sie zu den Sängern zählen würde, wären sie nicht Papageien; andere Arten lernen mit solcher Reinheit Lieder pfeifen, daß sie einen Gimpel beschämen. Die Begabung der Papageien für Nachahmung menschlicher Laute und Worte ist bekannt. Sie übertreffen hierin alle übrigen Tiere; sie leisten Bewunderungswürdiges, Unglaubliches; sie plappern nicht, sondern sie sprechen. Man verstehe mich recht; ich meine damit selbstverständlich nicht, daß sie die Bedeutung der von ihnen nachgeahmten Worte verständen oder imstande wären, Sätze zu erfinden und zu gliedern, sondern behaupte nur, daß sie die sie gelehrten Worte bei passender Gelegenheit anwenden, beispielsweise, wenn sie sachgemäß unterrichtet wurden, morgens bei Begrüßung von Bekannten auch geziemend »guten Morgen«, nicht aber »guten Abend« sagen. Sie verbinden also insofern Begriffe mit den von ihnen erlernten Worten und Satzbruchstücken, als sie im Gedächtnis behalten, bei welcher Gelegenheit oder zu welcher Tageszeit sie dieselben gelehrt wurden, und sie bei einer ähnlichen Gelegenheit oder Zeit die betreffenden Worte, für sie offenbar nur Lautgliederungen, wieder gebrauchen. Genau so verfährt ein Kind, das sprechen lernt; ihm aber kommt mit der Zeit das volle Verständnis der Worte, während dieses dem Papagei wohl für immer versagt bleibt.
Die Papageien bewohnen, mit Ausschluß Europas, alle Erdteile. Von den dreihundertfünfundfünfzig Arten, die Finsch im Jahre 1868 aufführt, leben einhundertzweiundvierzig in Amerika, fünfundachtzig auf den Papuinseln und Molukken, sechzig in Australien, dreißig in Polynesien, fünfundzwanzig in Afrika und neunzehn in Südasien, einschließlich der Sundainseln. Neuere Entdeckungen haben die Anzahl der bekannten Arten um einige zwanzig vermehrt, das Verhältnis der Verteilung aber kaum geändert. Die große Mehrzahl gehört der heißen Zone an; von jenen dreihundertundfünfzig überschreiten nur acht den Wendekreis des Krebses und zweiundsechzig den Wendekreis des Steinbocks. Eine amerikanische Art verbreitet sich nach Norden hin bis zum dreiundvierzigsten Breitengrade, eine andere findet sich auf der südlichen Halbkugel sogar in den »unheimlichen Öden« des Feuerlandes. Im allgemeinen sind sie an die Wälder gebunden, obwohl keineswegs ausschließlich, weil einzelne Arten auch die baumlosen Ebenen, die Steppen z. B., bewohnen, andere in den Anden in Höhen über den Holzgürtel, bis zu dreitausendfünfhundert Meter über das Meer, emporsteigen. In Nordostafrika ist mir aufgefallen, daß sie so gut wie ausschließlich da vorkommen, wo auch Affen leben, daß sie gewissermaßen als unzertrennliche Gefährten von diesen betrachtet werden müssen. Je großartiger die Wälder sind, d. h. je reicher die Pflanzenwelt ist, um so häufiger treten sie auf. »Die Papageien«, sagt Prinz von Wied, »machen in den tropischen Wäldern einen großen, ich möchte sagen, den größten Teil der befiederten Schöpfung aus.« Dasselbe gilt für Australien, für manche Gegenden Indiens und teilweise auch für Afrika. Hier treten sie so häufig auf, wie bei uns zu Lande die Krähen, dort sind sie so gemein, wie in Deutschland die Sperlinge.
Und sie verstehen es, sich bemerklich zu machen. Sie schmücken die Wälder und erfüllen sie mit ihrem Geschrei. »Papageien«, sagt der Prinz, »verschönern mit ihrem verschwenderisch gefärbten Gefieder die dunklen Schatten der tropischen Wälder.« – »Es ist unmöglich«, versichert Gould, »den Zauber des Anblicks zu beschreiben, den gewisse Papageien, zumal die hochrot gefärbten Arten, gewähren, wenn sie sich in Flügen in den silberblätterigen Akazien Australiens umhertummeln. Ihr herrliches Gefieder sticht wunderbar ab gegen die Umgebung.« – »Die Kakadus«, ruft Mitchell begeistert aus, »verwandeln die Höhen, in denen sie leben, zu Gefilden der üppigsten Wonne.« – »Ich habe«, berichtet Audubon, »Baumzweige von ihnen so vollständig bedeckt gesehen, als es nur möglich sein konnte.« – »Morgens und abends«, bestätigt Schomburgk, »sieht man die unzählbaren Mengen von Papageien in bedeutender Höhe unter unerträglichem Geschrei dahinziehen. Eines Nachmittags sah ich solch einen riesigen Zug sich auf die Uferbäume niederlassen; die Zweige bogen sich tief herab unter der Last der Vögel.« Was wäre einer jener wunderbaren Wälder unter den Wendekreisen ohne sie? Der tote Garten eines Zauberers, ein Gefilde des Schweigens, der Öde. Sie sind es, die das Leben wachrufen und wachhalten, die Auge und Ohr in gleicher Weise zu beschäftigen wissen.
Außer der Brutzeit leben die meisten Papageien in Gesellschaften oder in oft äußerst zahlreichen Scharen. Sie erwählen sich einen Ort des Waldes zur Siedelung und durchstreifen von ihm aus tagtäglich ein weites Gebiet. Die Gesellschaften halten treuinnig zusammen und teilen gemeinsam Freud und Leid. Sie verlassen gleichzeitig am frühen Morgen ihren Schlafplatz, fallen auf einem und demselben Baum oder Feld ein, um sich von den Früchten derselben zu nähren, stellen Wachen aus, die für das Wohl der Gesamtheit sorgen müssen, achten genau auf deren Warnungen, ergreifen alle zusammen oder wenigstens kurz nacheinander die Flucht, stehen sich in Gefahr treulich bei und suchen sich gegenseitig nach Kräften zu helfen, kommen zusammen auf einem und demselben Schlafplatz an, benutzen ihn so viel als möglich gemeinschaftlich, brüten auch, falls es irgendwie angeht, in Gesellschaft. »Schon bei dem ersten Schimmer der heiteren tropischen Morgensonne«, erzählt uns der Prinz, »erheben sie sich von ihrem nächtlichen Standorte, trocknen die vom Tau der Nacht stark benetzten Flügel, üben sie, scherzend und laut rufend, mannigfaltige Schwenkungen über dem hohen Wald beschreibend, und ziehen dann schnell dahin, ihrer Nahrung nach. Am Abend kehren sie unfehlbar auf ihren Stand zurück.« Auch Tschudi beobachtete in Peru die täglichen Wanderungen der Papageien. Eine der dort lebenden Arten wird wegen der Regelmäßigkeit, mit der sie täglich vom Gebirge herabkommt und dahin wieder zurückkehrt, vom Landvolk »Tagarbeiter« genannt. Diese täglichen Wanderungen erstrecken sich zuweilen auf Entfernungen von zwölf bis zwanzig Kilometer und geschehen offenbar der Nahrung halber.
Der Schlafplatz selbst ist verschieden. Er kann eine dichte Baumkrone, eine durchlöcherte Felsenwand, eine Baumhöhle sein. Letztere scheint besonders bevorzugt zu werden. Auch habe ich in den Urwäldern am Blauen Strome die Papageien in der Dämmerung wiederholt in Höhlen einschlüpfen sehen und andere so regelmäßig auf den vielfach durchlöcherten Adansonien beobachtet, daß mir eine derartige Nachtherberge nach Art der Spechte wohl glaublich erscheint. In Indien schläft der Halsbandsittich, wie uns Layard mitteilt, in Bambusdickichten. Eine sehr lebendige Schilderung des Lebens und Treibens an solchem Schlafplatze gibt Layard von dem Halsbandsittich, der auf Ceylon sehr häufig ist. »Zu Chilaw habe ich solch massenhafte Flüge von Papageien zu ihren Schlafplätzen, Kokosnußbäumen, die den Markt beschatteten, kommen sehen, daß das durch sie hervorgebrachte Geräusch das babylonische Stimmenwirrsal der Käufer vollständig verschlang. Man hatte mir vorher von den Schwärmen erzählt, die zu diesem Platz kamen, und ich stellte mich deshalb eines Abends auf einer nahe gelegenen Brücke auf, in der Absicht, diejenigen Flüge, die von einer einzigen Richtung herkämen, zu zählen. Ungefähr um vier Uhr nachmittags begann der Zuzug; zerstreute Schwärme wendeten sich heimwärts. Ihnen folgten bald stärkere, und im Verlauf einer halben Stunde war der Zug in vollem Gange. Ich fand sehr bald, daß es mir unmöglich wurde, die Flüge noch zu zählen; denn sie vereinigten sich zu einem lebendigen, brausenden Strome. Einzelne flogen hoch in der Luft bis gerade über ihre Schlafplätze und stürzten sich dann plötzlich unter verschiedenen Wendungen auf die Kronen der Bäume herab; andere schwärmten längs des Bodens dahin, so dicht über ihm, daß sie fast mein Antlitz streiften. Sie eilten vorüber mit der Schnelligkeit des Gedankens, und ihr glänzendes Gefieder leuchtete mit prächtigem Schimmer im Strahl der Sonne. Ich wartete auf meinem Schaupunkte bis der Abend hereinbrach, und konnte, nachdem ich nichts mehr zu sehen vermochte, noch lange die ihrer Herberge zufliegenden Vögel vernehmen. Als ich einen Schuß abfeuerte, erhoben sie sich mit einem Geräusch, gleich dem Rauschen eines gewaltigen Windes; bald aber setzten sie sich wieder fest, und es begann nun solch ein Getöse, daß ich es niemals vergessen werde. Das schrillende Geschrei der Vögel, das flatternde Geräusch ihrer Schwingen, das Rasseln der Blätter auf den Palmen war so betäubend, daß ich mich herzlich freute, als ich, glücklich entronnen, mein Haus wieder erreicht hatte.«
Nächst einem gesicherten Schlafplatz sind dichte Baumkronen ein Haupterfordernis für das Wohlbehagen der Papageien. Es kommt ihnen weniger auf Schutz gegen die Witterung als auf gute Versteckplätze an. Allerdings lieben sie die Wärme vor allem; sie scheuen jedoch auch die Kühle nicht gerade und noch weniger, mindestens zeitweilig, die Nässe. »Bei den heftigen tropischen Gewitterregen, die zuweilen die Luft verdunkeln«, sagt der Prinz, »sieht man die Papageien oft unbeweglich auf den höchsten dürren Astspitzen der Bäume sitzen, und munter erschallt ihre Stimme, während das Wasser von ihnen herabfließt. Dichtes Laub und dicke Baumäste, wo sie Schutz finden könnten, mögen in der Nähe sein; allein sie ziehen den warmen Gewitterregen vor und scheinen sich darin zu gefallen. Sobald aber der Regen vorüber ist, suchen sie sogleich ihre festen Federn von der Nässe zu befreien.« Anders ist es bei gutem Wetter. Dann bevorzugen sie, wie mich Stumpfschwanzpapageien und Halsbandsittiche der afrikanischen Waldungen belehrt haben, die dichtesten Bäume entschieden, sei es, um sich vor den Sonnenstrahlen zu schützen, sei es, um sich zu verbergen. Das letztere tun sie gewiß, sobald sie irgendwelche Gefahr merken. Sie wissen, welchen Schutz ihnen, den in die Blattfarbe gekleideten Vögeln, eine dichtbelaubte Baumkrone gewährt. Es ist nicht leicht, in ihr Papageien zu bemerken. Man weiß, daß vielleicht ihrer fünfzig auf einem Baum versammelt sind und sieht keinen einzigen. Beim Versteckenspielen kommt nicht bloß die Blattfarbe des Gefieders, sondern auch die fast allen Papageien eigene List zur Geltung. Sie wollen nicht gesehen werden. Einer der Gesellschaft hat den sich nahenden Feind rechtzeitig bemerkt und gibt ein Zeichen; alle übrigen schweigen sofort still, ziehen sich in die Mitte der Krone zurück, gewinnen, lautlos weiterkletternd, die dem Feinde entgegengesetzte Seite des Wipfels, fliegen weg und lassen erst, wenn sie bereits gegen hundert Schritte zurückgelegt haben, ihre Stimme vernehmen, wie es scheinen will, mehr zum Hohne des glücklich getäuschten Widersachers, als um andere der Gesellschaft zu locken. Solch feines Spiel treiben sie namentlich dann, wenn sie sich, um zu fressen, auf einem Baume versammelt haben, wie denn überhaupt ihre diebischen Einfälle stets mit bemerkenswerter List und Vorsicht ausgeführt werden.
Die Nahrung der Papageien besteht vorzugsweise aus Früchten und Sämereien. Viele Loris aber ernähren sich fast oder ganz ausschließlich von Blütenhonig, Blütenstaub und vielleicht noch von den Kerbtieren, die in den Blütenkelchen sitzen; Araras und Keilschwanzsittiche fressen neben den Früchten und Körnern wohl auch Knospen und Baumblüten, und einzelne Kakadus nehmen gern Kerbtierlarven, Würmer und dergleichen zu sich. Überhaupt ist es mir gar nicht unwahrscheinlich, daß die großen Arten der Ordnung weit mehr tierische Nahrung verzehren, als wir glauben. Dafür scheint der Blutdurst gewisser Papageien zu sprechen, ebenso auch die Gier, die gefangene nach Fleischkost an den Tag legen, sobald sie einmal daran gewöhnt wurden. Papageien, die ich gefangen hielt, überfielen andere ihrer Art, bissen ihnen den Schädel auf und entleerten das Hirn; ob sie dasselbe auch fraßen, ist mir nicht mehr erinnerlich. Ein anderer Papagei, der aus und ein flog, beschlich, wie sein Besitzer mir erzählte, junge Sperlinge oder andere vor kurzem ausgeflogene Vögel, fing sie, rupfte sie sehr hübsch, fraß sie an und warf sie dann weg. Nach solchen Erfahrungen dürfen wir uns kaum wundern, wenn uns die neuesten Berichte über die Nestorpapageien erzählen, daß wenigstens einzelne Arten dieser beachtenswerten Sippe ausgesprochene Fleisch-, ja selbst Aasfresser sind. Dessenungeachtet bleibt festzuhalten, daß Pflanzenstoffe die hauptsächliche Nahrung der Papageien bilden.
Ergötzlich ist, die Papageien bei ihren diebischen Einfällen auf Fruchtbäume und Felder zu beobachten. Sie zeigen sich auch hierin, wie überhaupt in der Art und Weise, sich zu ernähren, wiederum so recht als befiederte Affen. Die List und Verschlagenheit, mit der sie ihre Räubereien betreiben, fallen jedem Beobachter auf. Ein mit reifen Früchten beladener Baum, ein gerade ergiebiges Feld zieht sie von weitem herbei. »In Flügen«, so berichtet Pöppig, »fallen die großen, goldgrünen Araras der Anden auf die hochroten Erythrinen und gelben Tachien nieder, deren Blüten sie gern verzehren. Furchtbar ist ihr Geschrei; allein ihre List lehrt sie seine Gefährlichkeit kennen, wenn sie die Plünderung eines reifenden Maisfeldes beginnen. Jeder bezwingt dann seine Neigung zum Lärmen, und nur unterdrückte, murrende Laute sind hörbar, während das Werk der Zerstörung unglaublich rasch vorschreitet. Nicht leicht vermag der Jäger oder der erbitterte Indianer die schlauen Diebe zu beschleichen; denn stets bleibt ein Paar der ältesten als Wachen auf den höchsten Bäumen ausgestellt. Dem ersten Warnungszeichen antwortet ein allgemeiner halblauter Ruf der gestörten Räuber; beim zweiten Krächzen entflieht unter betäubendem Geschrei der ganze Haufen, nur um nach der Entfernung ihres Feindes sogleich ihre verderbliche Tätigkeit von neuem zu beginnen.« Schomburgk bestätigt diese Mitteilung durch seine eigenen Beobachtungen und fügt ihr hinzu, daß die Gegenwart einer zahlreichen Menge von Papageien gewöhnlich nur durch das Herabfallen der ausgefressenen Hülsen verraten wird, die, wenn sie auf die breiten Blätter der Gesträuche des Unterholzes stürzen, ein weit hörbares Geräusch verursachen, »als wenn eine Hagelwolke ihren Inhalt ausschüttet«. Levaillant erfuhr das Verstummen der Papageien bei Ankunft eines verdächtigen Wesens gelegentlich ihrer Massenversammlungen während der Mittagszeit. »Sie halten sich dann«, sagt er, »so still, daß man auch nicht das leiseste Geräusch von ihnen hört, wenngleich sie zu Tausenden versammelt sind. Fällt aber zufällig ein Flintenschuß, so erhebt sich plötzlich der ganze Haufen mit wütendem Geschrei in die Luft.«
Unglaublich groß und die ernsteste Abwehr seitens des Menschen rechtfertigend sind die Verwüstungen, die Papageien im Felde und Garten anrichten. Vor ihnen ist wenig sicher, nichts eigentlich geschützt. »Sie und besonders die großen Araras«, sagt der Prinz, »zersplittern mit ihrem riesenhaften, kräftigen, beweglichen Schnabel die härtesten Früchte und Nüsse«; aber ebensogut verarbeiten sie auch eine schlüpfrige Frucht oder ein kleines Korn. Die Riefen- oder Feilkerben im Oberschnabel erleichtern das Festhalten glattschaliger oder kleiner Nahrung ungemein, und die bewegliche Zunge hilft dabei wesentlich mit. Im Nu ist eine Nuß zerknackt, eine Ähre entkernt, ein Samenkorn enthülst. Reicht der Schnabel allein nicht aus, dann wird auch der Fuß noch zu Hilfe genommen, und geschickt führen sie die mit ihm festgehaltene Speise zum Munde. Wie die Affen verwüsten sie weit mehr, als sie verzehren. Die Unmassen, die vereint auf die Felder oder Fruchtbäume fallen, fressen dort, soviel sie können, beißen noch mehr ab, tragen wohl auch noch einige Kornähren auf die Bäume, um sie dort mit größerer Ruhe für ihren vielbegehrenden Magen zu verwerten. Sie erscheinen in Obstgärten, untersuchen jeden Baum, der in Frucht steht, pflücken von dieser nach Belieben, beißen sie an, werfen sie, falls sie nicht allen Ansprüchen solcher Schlecker genügt, auf den Boden herab und nehmen dafür eine andere. Während des Fressens klettern sie allgemein von unten nach oben; sind sie auf der Spitze des Wipfels angekommen, so schweben sie, meist ohne Flügelschlag, einem zweiten Baume zu, um dort dieselbe Verwüstung zu beginnen. In Nordamerika oder in Chile überfallen sie die Obstbäume, auch wenn deren Früchte noch unreif sind, der milchigen Kerne wegen; man kann sich denken, was sie dabei vernichten! In manchen Gegenden werden sie zur wirklichen Landplage; hier und da machen sie den Anbau mancher Feldfrüchte geradezu unmöglich. Die einen haben für diese, die andern für jene Feld- oder Gartenfrucht besondere Vorliebe; gefährdet ist also alles, was der Mensch zu eigenen Gunsten sät und pflanzt, und an Freundschaft zwischen ihm und den Vögeln ist selbstverständlich nicht zu denken.
Nach eingenommener Mahlzeit fliegen die Papageien zur Tränke und zum Bade. Sie trinken viel, nach Audubon und Schomburgk, auch Salz- oder wenigstens Brackwasser. Außer gelegentlichen Regenbädern nehmen sie auch solche in Lachen. Wie Levaillant uns mitteilt, baden sie sich, »daß die Tropfen sie wie in Regen einhüllen«. Nach Audubons Beobachtungen paddeln sie gern im Sande wie die Hühner und stäuben dabei ihr Gefieder ordentlich ein, kriechen auch wohl in die Nisthöhlen der größeren Eisvögel, um dasselbe zu erreichen. Salzhaltige Erde suchen sie auf; bei Sulzen im Walde erscheinen sie regelmäßig.
Die Fortpflanzung der Papageien fällt in die Monate, die in ihrer Heimat unserm Frühling entsprechen und der Fruchtreife vorausgehen. Alle Arten, über deren Lebensweise wir unterrichtet sind, leben in strenger Ehe auf Lebenszeit, und beide Gatten hängen mit innigster und treuester Liebe aneinander. Gegen die Paarzeit hin vermehren sie die Beweise gegenseitiger Anhänglichkeit, so wenig sie sonst auch mit solchen kargen. Männchen und Weibchen verlassen einander jetzt keinen Augenblick mehr, tun alles gemeinschaftlich, sitzen dicht aneinandergeschmiegt und überhäufen sich gegenseitig mit Zärtlichkeiten. Mit Recht hat man einzelne Arten die »Unzertrennlichen« genannt; mit demselben Recht könnte man alle so nennen. Die größeren Arten scheinen nur einmal im Jahre zu brüten und bloß zwei Eier zu legen; die australischen Graspapageien und die andern Breitschwänze überhaupt weichen jedoch von dieser Regel ab; sie legen regelmäßig drei bis vier, ja einzelne sogar sechs bis zehn Eier und brüten, wie aus Beobachtungen an gefangenen zu schließen, zwei- bis dreimal im Jahr. Auch Sittiche und Kakadus legen regelmäßig mehr als zwei Eier, brüten aber wohl nur einmal. Die Eier selbst sind immer weiß von Farbe, glattschalig und rundlich.
Baumhöhlen sind die bevorzugten, nicht aber ausschließlichen Nistplätze der Papageien. Einige amerikanische Arten brüten in Erd- oder Felsenhöhlen, indische Sittiche, nach Jerdon, häufig in den Höhlungen alter Gebäude, in Pagoden, Grabmälern, Häusern usw.; der Mönchsittich erbaut aus dicken Zweigen große, ungefüge Nester; die Erdpapageien legen die Eier auf den nackten Boden. Audubon versichert, daß mehrere Weibchen in eine und dieselbe Nesthöhle legen; ich halte diese Angabe für irrtümlich. So viel ist aber richtig, daß die Papageien in größeren Gesellschaften und zuweilen in ungeheuren Scharen vereinigt nisten. Schon Molina erzählt von einer zahlreichen Ansiedlung nistender Papageien in Chile; Pöppig schildert sie, wohl die derselben Art, ausführlicher. »Die Uneingeweihten«, sagt er, »mögen diese geselligen Niederlassungen sehr überraschen. Man nähert sich bei einer mühsamen Streiferei um die Mittagsstunde einer senkrechten Felsenwand und glaubt sich ganz allein; ringsumher herrscht die tiefste Stille, die in allen wärmeren Gegenden Amerikas die Mitte des Tages bezeichnet, wann die meisten Tiere in Schlaf versunken sind. Eine Art von Knurren wird von allen Seiten her hörbar; allein man sieht sich umsonst nach den Tieren um, die es hervorbringen könnten. Plötzlich ertönt der Warnungsruf eines Papageien; er wird von vielen andern beantwortet, und ehe man noch recht das Ganze begreift, ist man von Scharen jener zänkischen Vögel umringt, die mit augenscheinlichem Zorn in engem Kreise um den Wanderer fliegen und auf ihn zu stoßen drohen. Aus der Menge von Löchern in der mürben Felswand blicken, possierlich genug, die runden Köpfe der Papageien hervor, und was von ihnen nicht umherfliegt, stimmt wenigstens durch lautes Schreien in den Aufruhr ein. Jede Öffnung bezeichnet ein Nest, das von den Eignern in den Tonschichten, die sich zwischen den Felswänden befinden, ausgehöhlt wird, und gar nicht selten mag man von ihnen einige hundert zählen. Immer sind aber solche Ansiedlungen so klug angelegt, daß weder von unten noch von oben ein Raubtier sich ihnen nähern kann.« Derartige Gesellschaften können sich im Walde nicht sammeln, weil hier die Schwierigkeit der Nestanlage größer ist. Alte, hohe, womöglich unersteigliche Bäume mit vielen Höhlungen werden sehr gesucht, in Mittelafrika vor allen die Adanfonien, auf oder in denen selbst dann Papageien nisten, wenn die Riesenbäume außerhalb des Waldes stehen. So fand ich eine vereinzelte Gruppe von Affenbrotbäumen in der kordofanischen Steppe von Papageien bevölkert, obgleich die Bäume noch nicht einmal ihren Blätterschmuck angelegt hatten. Ohne ihre Höhlungen wären sie ganz sicher gemieden worden!
Nicht immer finden die Papageien einen Nistbaum, dessen hohles Innere ein geschickter Specht oder ein freundlicher Zufall erschloß, sondern oft genug müssen sie selbst die ihnen nötige Kinderstube herrichten. Dann beweisen sie, wie vielseitig ihr Schnabel verwendet werden kann. Mit ihm arbeitet der Papagei, und zwar hauptsächlich, nicht aber ausschließlich, der weibliche Gatte des Paares, ein kleines Loch, das einen versprechenden Einblick in das morsche Innere gestattet, zweckmäßig aus. Der Vogel zeigt sich dabei sehr geschickt, hängt sich wie ein Specht an der Rinde an und nagt mehr, als er schneidet, mit dem Schnabel einen Holzspan nach dem andern ab, bis das Haus gegründet. Das währt manchmal wochenlang; aber Ausdauer erringt das Ziel, übrigens ist die Höhle die Hauptsache; auf das Nest selbst kommt es nicht an. Selbst eine Höhle, die viel zu wünschen übrig läßt, befriedigt die bescheidenen Anforderungen des brütenden Papageien. Der nackte, morsche Boden genügt vielen, einige Späne andern. Doch gibt es Ausnahmen. Zwergpapageien kleiden, wie ich an gefangenen beobachtete, die Nisthöhlung mit fein zerschlissenen Spänen, Holzfasern oder Stroh aus, und einzelne Plattschweifsittiche sollen aus Grashalmen und Federn eine Nestunterlage herstellen.
In der Regel brüten beide Gatten des Paares abwechselnd. Bei kleineren Arten, wie z. B. bei dem Wellensittich, beträgt die Brutzeit sechzehn bis achtzehn Tage; von andern Papageien sind neunzehn, dreiundzwanzig, fünfundzwanzig Tage vermerkt worden; wie lange Araras brüten mögen, ist unbekannt. Die Jungen entschlüpfen dem Ei als äußerst hilflose Wesen; ihre Entwicklung geht aber überraschend schnell vor sich. Sie sind anfänglich mit Flaum sehr spärlich bekleidet; nach fünf bis sechs Tagen brechen die ersten Federstoppeln hervor; am achten oder zehnten Tage ihres Lebens öffnen sie die Augen. Wellensittiche verließen am dreiunddreißigsten Tage ihres Daseins das Nest und flogen zwei Tage später umher.
Beide Eltern tragen den Jungen Nahrung zu und atzen sie auch noch einige Zeit nach dem Ausfliegen. Die Nahrung wird, wenn sie aus Körnern besteht, vor dem Verfüttern im Kropfe der Alten aufgeweicht und den Jungen in den Schnabel gespien. Schomburgk beobachtete, daß ein Paar, das in der Nähe seines Lagerplatzes im Wald genistet hatte, seine Jungen nur zweimal des Tages fütterte, und zwar um elf Uhr vormittags und um fünf Uhr nachmittags. An zärtlicher Sorge für das Wohl ihrer Kinder lassen es die Eltern nicht mangeln. Sie verteidigen ihre Sprossen bei drohender Gefahr mit aufopferndem Mut auch in der Gefangenschaft und gegen den sonst von ihnen geliebten Pfleger. Einzelne Arten nehmen sich mit derselben Zärtlichkeit, die sie ihren eigenen Kindern widmen, verwaister Jungen an, und nicht bloß hilfloser ihrer eigenen Art, sondern auch fremder. »Der Wundarzt des Schiffes Triton, unser Reisegefährte zwischen Neuholland und England«, so erzählt Cunningham, »besaß einen blauen Bergpapagei und einen andern sehr schönen, kleineren, den er so jung aus dem Nest gehoben hatte, daß er seine Nahrung noch nicht selbst aufraffen konnte. Der ältere übernahm es, ihn zu füttern, sorgte eifrig für seine Bedürfnisse und bewachte ihn mit der innigsten Zärtlichkeit. Die gegenseitige Freundschaft der Vögel schien mit der Zeit zuzunehmen; sie brachten den größten Teil des Tages mit Liebkosen zu, schnäbelten sich, und der ältere breitete seine Flügel aufs zierlichste über den kleinen Schützling aus. Ihre Freundschaftsbezeugungen wurden aber zuletzt so laut, daß man sie trennte, um den Reisenden keinen Anlaß zur Klage zu geben. Der jüngere wurde also zu mehreren andern in meine Kajüte versetzt. Nach einer zweimonatigen Trennung gelang es dem blauen Bergpapagei, zu entkommen, und siehe da, die Stimme seines jungen Freundes leitete ihn gerade in meine Kajüte, wo er sich an jenen Käfig anklammerte. Nunmehr wurden die beiden Freunde nicht wieder getrennt; aber vierzehn Tage später starb der jüngere an den Folgen einer Verletzung, die der Fall des Käfigs ihm verursacht hatte. Sein Freund war seitdem stumm und folgte ihm bald nach.« Diese Erzählung steht nicht vereinzelt da.
Durchschnittlich scheinen die Papageien bereits im zweiten Jahre ihres Lebens die volle Pracht ihres Gefieders erlangt zu haben und fortpflanzungsfähig zu sein. Die kleineren Arten der Ordnung sind erfahrungsgemäß schon im ersten Jahre ihres Lebens zeugungsfähig. Dessenungeachtet leben sie lange Jahre. Man hat an Gefangenen wunderbare Erfahrungen gemacht. Sie haben die Familie, in deren Mitte sie die Jugendzeit ihres Lebens verbrachten, lange überdauert; sie haben, wie in Amerika eine Sage geht, ein ganzes Volk dahinsterben und vergehen sehen. »Es ist wahrscheinlich«, bemerkt Humboldt, »daß die letzte Familie der Aturer erst spät ausgestorben sei. Denn in Maipures lebt noch ein alter Papagei, von dem die Eingeborenen behaupten, daß man ihn darum nicht verstehe, weil er die Sprache der Aturer rede.
Möglicherweise erliegen die meisten größeren Papageien der Last des Alters, nicht aber ihren Feinden. Solche haben auch sie, doch keinen schlimmeren als den Menschen. Die Papageien werden allerorten verfolgt und mit einer gewissen Leidenschaft gejagt. Es geschieht dies ebensowohl, um sie zu nutzen, als um sich ihrer zu erwehren. Letzteres macht sich überall notwendig, wo Pflanzungen an Wälder stoßen, die von Papageien bewohnt werden. »Man bilde sich nicht ein«, sagt Audubon, »daß alle die Übergriffe, die die Papageien sich zuschulden kommen lassen, seitens der Pflanzer ohne ernstliche Vergeltung hingenommen werden. Im Gegenteil: die Vögel werden wegen ihrer räuberischen Einfälle in das Besitztum des Bauern von diesem massenhaft abgeschlachtet. Mit geladenem Gewehr in der Hand schleicht sich der erboste Landmann herbei, und acht oder zehn von den Räubern erliegen dem ersten Schusse. Die Überlebenden erheben sich, schreien laut auf, fliegen vier oder fünf Minuten lang in Kreisen umher, kehren zu den Leichen der Genossen zurück, umschwärmen sie mit lautem, klagendem Geschrei und fallen als Opfer ihrer Anhänglichkeit, bis schließlich so wenige übrig bleiben, daß sie der Bauer nicht für zahlreich genug hält, sein Kraut und Lot ferner an sie zu wenden. Ich habe im Laufe weniger Stunden in dieser Weise mehrere Hundert von ihnen vertilgt und Körbe mit den erbeuteten gefüllt. Die angeschossenen wissen sich übrigens ihrer Haut zu wehren und bringen mit ihrem scharfen Schnabel gefährliche Wunden bei.« Das Fleisch der erbeuteten Papageien wird, obgleich es hart und zähe ist, doch gern gegessen, mindestens zur Herstellung kräftiger Brühen verwendet. Schomburgk rühmt die Papageisuppen nach eigener Erfahrung als vorzügliches Gericht; die Chilenen sind förmlich erpicht auf dasselbe. Auch die Indianer Amerikas oder die Wilden Australiens stellen den Papageien ihres Fleisches wegen eifrig nach.
Noch öfter werden die Vögel ihrer schönen Federn halber gejagt. Die Vorliebe der Urvölker für Papageienfedern ist uralt und allgemein. »In lang vergangenen Zeiten«, berichtet Pöppig, »brachten die Bewohner der wärmeren Waldgegenden den Inkas die Federn der Araras als Frongabe zur Schmückung ihrer Paläste, und die früheren Geschichtsschreiber Perus melden, daß diese Federn und die Koka die einzigen Erzeugnisse waren, die die Urbarmachung und Anvölkerung der gefürchteten heißen Wälder ehemals veranlaßten.« Auch später wurden die Papageien noch einmal Ursache zu einer weltgeschichtlichen Begebenheit. Ein Flug Papageien nämlich half Amerika entdecken. Pinzon, der Begleiter und Untergebene des großen Genuesers, hatte diesen dringend gebeten, den bisher festgehaltenen Lauf der Schiffe zu ändern. »Es ist mir«, versicherte er, »wie eine Eingebung, daß wir anders steuern müssen.« »Die Eingebung aber und was das Herz ihm sagte«, so belehrt uns Humboldt in seinem Kosmos, »verdankte Pinzon, wie den Erben des Kolumbus ein alter Matrose erzählte, einem Fluge Papageien, den er abends hatte gegen Südwesten fliegen sehen, um, wie er vermuten konnte, in einem Gebüsch am Lande zu schlafen. Niemals hat der Flug der Vögel gewichtigere Folgen gehabt. Man konnte sagen, er habe entschieden über die ersten Ansiedelungen im neuen Kontinent, über die ursprüngliche Verteilung romanischer und germanischer Menschenrassen.«
Der Nutzen, den die Papageien uns bringen, ist genau derselbe, den wir den Affen abzugewinnen wissen. Außer der Verwendung des Fleisches und Kleides der Vögel dienen sie uns als gern gesehene Gesellschafter im Zimmer. Die Zähmung der Papageien erinnert in gewisser Hinsicht an die Unterjochung unserer Haustiere. Sie ist uralt. Plinius beschreibt ihr Gebaren in anschaulicher Weise; ihre Schönheit und Klugheit befreundete sie den Römern so, daß diese Liebhaberei auf öffentlichem Markt gerügt wurde. »O unglückliches Rom«, rief der strenge Zensor Marcus Portius Cato aus, »in welche Zeiten sind wir verfallen, da die Weiber Hunde auf ihrem Schoße ernähren und die Männer Papageien auf der Hand tragen!« Man setzte sie in Käfige von Silber, Schildpatt und Elfenbein, ließ sie von eigens bestellten Lehrern unterrichten, lehrte sie hauptsächlich das Wort »Cäsar« aussprechen und bediente sich eines besonderen Werkzeuges zu ihrem Unterricht. Der Preis eines sprechenden Sittichs überstieg oft den Wert eines Sklaven. Ovid fand einen Papagei würdig, dichterisch besungen zu werden; Heliogabal glaubte seinen Gästen nichts Köstlicheres vorsetzen zu können als Papageiköpfe. Um die Zeit der Kreuzzüge schmückten sie die Käfige in den Häusern reicher Leute unseres Vaterlandes und wurden auch hier zum Sprechen abgerichtet, wie Christian von Hameln mitteilt, der singt:
»Ich wollte, daz der anger sprechen sollte
als der sytich in den glas.«
In Amerika fanden die ersten Entdecker gezähmte Papageien in und vor den Hütten der Eingeborenen. Als die Spanier unter Nicuesa und Hojeda im Jahre 1609 das an der Landenge von Darien gelegene Karaibendorf Yurbaco überrumpeln wollten, verrieten die wachsamen Papageien in den Wipfeln der Bäume vor den Hütten den Anzug der Feinde und ermöglichten ihren Pflegern, rechtzeitig zu flüchten. Durch Schomburgk erfahren wir, daß der Eingeborene Südamerikas seine gezähmten Papageien noch heutigestags frei fliegen läßt, ohne ihnen die Flügel zu stutzen. »Ich sah mehrere«, schreibt er, »die sich des Morgens unter die Flüge der wilden mischten, die über das Dorf hinwegflogen und bei der Rückkehr am Abend sich wieder auf die Hütte ihres Herrn niederließen.« Daraus geht hervor, daß zu den indianischen Niederlassungen im Walde die Papageien gehören wie zu unsern Bauernhöfen die Hühner. Nur nehmen jene weit innigeren Anteil an dem menschlichen Treiben als unser Hausgeflügel zu tun pflegt. Bewundernswürdig und uns noch nicht recht verständlich ist die Fertigkeit der Indianer, Papageien binnen kürzester Frist zu zähmen.

Papageien ( Psittacidae)
Im Vergleich zu den frei die Hütten der Indianer umfliegenden hat der für Europa bestimmte Papagei freilich ein trauriges Los. Am übelsten ergeht es ihm, bevor er den Ort seiner Bestimmung erreicht. Der Indianer des Urwaldes, der ihn fing, um ihn gegen die Erzeugnisse Europas zu vertauschen, übergibt ihn in der ersten besten Hafenstadt den Händen eines Matrosen, der weder von der Pflege, noch von der einem derartigen Vogel ersprießlichen Nahrung etwas weiß. Kaum mehr als die Hälfte aller Papageien, die an Bord eines Schiffes gebracht werden, überstehen die weite Seereise, und von denen, die glücklich in Europa angelangt sind, gehen auch noch viele in den dunklen, schmutzigen, verpesteten Buden der Händler zugrunde. Erst wenn der Vogel in geeignete Pflege kommt, bessert sich sein Schicksal; er ist dann aber oft leutescheu, mißtrauisch, heftig und unartig geworden und verliert erst nach längerer Behandlung die Herbheit seines Wesens.
Aber er ist klug und lernt es bald, sich in die veränderten Umstände zu finden. Zunächst gewöhnt er sich an allerlei Kost. Anstatt der saftigen Früchte und der Körner seiner heimatlichen Wälder werden ihm die Nahrungsmittel des Menschen geboten. Sie behagen ihm um so besser, je mehr er von ihnen kennenlernt. Anfänglich genügt ihm Hanf oder Kanariensamen, bald aber verlangt er mehr. Durch Darreichung von Süßigkeiten wird er zum verwöhnten Schlecker, der mit einfacher Nahrung sich nicht begnügt. Man kann ihn an fast alle Stoffe gewöhnen, die der Mensch genießt, auch an Kaffee, Tee, Wein, Bier und dergleichen; er berauscht sich sogar durch den Genuß geistiger Getränke. Bloß auf die kleinsten Arten der Ordnung paßt vorstehende Schilderung nicht; sie verschmähen außer ihrem Körnerfutter und Kräuterblättern andere Nahrung. Erfahrungsgemäß genügen den meisten größeren Papageiarten Hanf, hartgekochter Reis, Hafer, Mais, Salat, Kohl und Früchte, den kleineren Hirse, Kanariensamen, Salat und Pflanzenblätter. Bittere Mandeln und Petersilie sind Gift für sie und werden ihnen verderblich.
Wie unter allen hochstehenden Tieren gibt es auch unter den Papageien, ich meine innerhalb einer und derselben Art, mehr oder minder gelehrige oder, was dasselbe sagen will, höher oder geringer begabte. Der eine lernt rasch und viel, der andere langsam und wenig, der dritte gar nichts. Doch vermag ein regelrechter Unterricht viel, sehr viel. Ihr vortreffliches Gedächtnis ist für das Sprechenlernen ebenso wesentlich wie die Beweglichkeit ihrer Zunge, die ihnen das Nachahmen menschlicher Laute ermöglicht. Sie erfassen einen Begriff, erlernen ein Wort; zu dem einen erwerben sie sich mehrere, und ihre Fähigkeit wächst, je mehr sie dieselbe beanspruchen. So nimmt das gefiederte Kind des Urwaldes im Umgang mit dem Menschen mehr und mehr von diesem an und wird nach und nach zu einem Wesen, dem wir Anerkennung nicht versagen. Der Papagei wird gewissermaßen menschlich im Umgang mit Menschen, so wie ein Hund durch Erziehung gebildet, ich möchte sagen, gesittet wird. Wer wissen will, ob er einen männlichen oder weiblichen Papagei besitzt, kommt in den meisten Fällen bei den großen verständigsten Arten fast immer zum Ziele, wenn er abwechselnd einen Mann und eine Fran ersucht, dem Papagei zu nahen, mit ihm zu kosen, ihn zu erzürnen. Geht er leicht auf Liebkosungen eines Mannes ein, so ist er höchst wahrscheinlich ein Weibchen, läßt er sich leicht erzürnen, ein Männchen. Ebenso verhält es sich, wenn eine Frau einen männlichen Papagei liebkost und einen weiblichen reizt. Ich habe dies nicht glauben wollen, mich von der Wahrheit aber überzeugen müssen. Verschiedenen Menschen des gleichen Geschlechts gegenüber benimmt sich ein und derselbe Papagei keineswegs immer gleich. In den meisten Fällen prüft er, bevor er urteilt oder handelt; zuweilen aber bekundet er gegen jemand von vornherein Abneigung, und diese mindert sich nicht, sondern vermehrt sich eher mit der Zeit. Oft muß man seine Menschenkenntnis bewundern. Auf alles dieses muß man Rücksicht nehmen, wenn man einen Papagei unterrichten oder erziehen will. Ebenso wie jedes andere Wesen, das von einem Höherstehenden Lehre annehmen soll, verlangt dieser einen regelmäßigen Unterricht und bei aller Liebe in der Behandlung milden Ernst. Sonst läßt er sich wohl verziehen, nicht aber erziehen. Übergroße Zärtlichkeit in der Behandlung verdirbt ihn ebenso sicher als übergroße Strenge. Läßt man ihn frei in einem größeren Raum umherfliegen, so wird er selten zahm und lernt noch seltener sprechen. Größere Freiheit darf man ihm erst gestatten, wenn der ihm gewordene Unterricht fast beendet ist.
Bisher wurden sie auch in Tiergärten, die für die Hebung der Tierpflege außerordentlich genützt haben, arg vernachlässigt. Man setzte sie, wie in den Tierschaubuden, angekettet auf Holzgestelle oder stellte sie reihenweise in Käfigen nebeneinander. Es war und ist noch heute für die Besucher eines zahlreich bevölkerten Papageienhauses mit wirklicher Qual der Gehörwerkzeuge verbunden, in solchem Hause längere Zeit zu verweilen. Papageien, die gewöhnt sind, ihresgleichen und andere Vögel in einer gewissen Ordnung zu sehen, erheben, sobald diese Ordnung gestört wird, ein Zetergeschrei. Sie zeigen dem Wärter ganz unfehlbar jedes von dem alltäglich gewohnten abweichende Ereignis durch ohrzerreißendes Schreien an und unterstützen dieses noch besonders durch lebhafte Gebärden, durch Schlagen mit den Flügeln, schnelles wiederholtes Verneigen des Kopfes und dergleichen Zeichen ihrer Erregtheit. Genau so benehmen sie sich, wenn ein ihnen auffallender Mensch in ihren Wohnraum tritt, und wenn einmal einer zu schreien begann, stimmen die andern gewiß sofort mit ein. Dann ist es in ihrer Gesellschaft wirklich kaum zum Aushalten, und alle die Einwendungen, die gegen das Gefangenhalten von Papageien gang und gäbe sind, werden laut. So kommt es, daß die Papageienhäuser in den Tiergärten beinahe gemieden werden.
In der Neuzeit hat man wiederholt, namentlich in England und bei uns zulande, versucht, freigelassene Papageien einzubürgern. Die Vögel haben sich wenigstens in Großbritannien bald an unser europäisches Klima gewöhnt, sich in unsern Waldungen seßhaft gemacht, wiederholt genistet und Junge aufgebracht, würden auch sicherlich trefflich gedeihen, wenn es nicht, wie ein englischer Berichterstatter sich ausdrückt, »so viele erbärmliche Flinten gäbe«. Man schießt die auffallenden Fremdlinge einfach tot, wo man sie bemerkt, und bereitet damit allen Einbürgerungsversuchen, deren Nützlichkeit übrigens sehr fraglich sein dürfte, ein jähes Ende.
*
Die Einteilung der Sittiche ist wegen der überraschenden Übereinstimmung aller wesentlichen Merkmale sämtlicher Mitglieder der Ordnung schwierig; scharfe Grenzen zwischen den verschiedenen Hauptgruppen sind daher kaum zu ziehen. Ich nehme eine einzige Familie an. Obenan stelle ich die Kurzschwanzpapageien ( Psittacinae) kenntlich an ihrem kurzen, höchstens mittellangen, gerade abgeschnittenen oder sanft gerundeten Schwanz. Diese Unterfamilie ist über alle warmen Erdteile verbreitet, tritt besonders zahlreich in Amerika und Afrika, am spärlichsten in Australien auf und ist nur in Polynesien nicht vertreten.
Ein allgemein bekannter, hochbegabter Papagei, der Jako ( Psittacus erithacus), Vertreter der urbildlichen Sippe der Graupapageien ( Psittacus), mag die Reihe der Arten eröffnen. Die Merkmale der Sippe sind kräftiger, auf der Firste abgerundeter Schnabel, lange Flügel mit wohlentwickelter Flügelspitze, mittellanger, fast gerade abgeschnittener Schwanz und großfederiges Gefieder, das Nasenlöcher, Wachshaut, Zügel und Augenkreis unbekleidet läßt. Der Jako selbst ist leicht beschrieben, denn er zeigt eigentlich nur zwei Hauptfarben auf seinem Gefieder. Der Schwanz ist scharlachrot; alle übrigen Federn sind aschgrau, etwas lichter gerandet. An Kopf und Hals treten diese Ränder stärker hervor als im übrigen Gefieder, und deshalb erscheinen diese Teile lichter. Wenn der feine Puderstaub, der in der Regel das Gefieder dick bedeckt, abgewischt wird, sehen die Federn schieferschwarzblau aus. Mancherlei, zum Teil prachtvoll gefärbte Spielarten, bei denen einige Armschwingen oder auch andere Teile des Gefieders rot angeflogen sind, kommen vor, gelangen aber selten nach Europa, weil die an der Westküste wohnenden Kaufleute solche Vögel, in Westafrika »Königspapageien« genannt, für sich zu erwerben pflegen. Der junge Jako unterscheidet sich vom alten durch fahleres, bräunliches Grau des Gefieders und durch grauen Augenstern. Der Augenstern des alten Jako ist gelb, der Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau. Das Männchen ist ein wenig größer als das Weibchen. Die Länge beträgt einunddreißig, die Breite fünfundsechzig, die Fittichlänge zweiundzwanzig, die Schwanzlänge acht Zentimeter.
Das Verbreitungsgebiet des Jako erstreckt sich im Westen Afrikas von Senegambien bis Benguela und reicht nach Osten hin bis zum Tschadsee, den westlichen Quellflüssen des Nil und dem Nyanzasee, fällt also ziemlich mit dem der Ölpalme zusammen. Innerhalb dieses ungemessenen Gebietes tritt der Vogel fast überall sehr häufig auf, und es erscheint daher im hohen Grade befremdend, daß wir über sein Freileben erst in der allerneuesten Zeit Kunde erlangt haben. Meine Leser danken mit mir Reichenow, der den Graupapagei eingehender und sachgemäßer beobachtet hat als jeder andere und so freundlich gewesen ist, seine Erfahrungen mir zur Verfügung zu stellen, das Nachstehende:
»Wohin man sich auch wendet, überall begleitet einen das Gekrächze der Jakos. Sie sind in Westafrika, namentlich aber an der Goldküste, im Nigerdelta, am Kamerun und Gabun überaus häufig; denn die Natur bietet ihnen hier in den unzugänglichen Waldungen des Schwemmlandes der Flußmündungen so außerordentlich geschützte und zusagende Wohnorte, daß die Verfolgung, die sie seitens der Eingeborenen und der wenigen sie bedrohenden Feinde zu erleiden haben, kaum in Betracht kommt. Hauptsächlich die Mangrovewaldungen nahe der Küste sind es, in denen sie nisten, indem sie vorhandene Höhlungen in den Bäumen benutzen oder Astlöcher mit Hilfe ihres kräftigen Schnabels zu geeigneten Brutstellen erweitern. Während der Brutzeit, die in die Regenmonate, je nach Lage der betreffenden Örtlichkeit nördlich oder südlich des Äquators also in unsere Sommer- oder Wintermonate fällt, leben die Paare mehr oder weniger einzeln; nach der Brutzeit dagegen schlagen sie sich nebst ihren Jungen mit andern Artgenossen zu Gesellschaften zusammen, die vereint umherstreifen, gemeinschaftlich Nahrung suchen und gemeinsam Nachtruhe halten. Sie wählen nunmehr zu bestimmten Schlafplätzen die höchsten Bäume eines Wohngebietes und vereinigen sich hier allabendlich. Aus verschiedenen Richtungen her erscheinen um Sonnenuntergang größere oder kleinere Trupps, so daß die Anzahl der endlich versammelten Vögel oft viele Hunderte erreichen kann. Solche Schlafplätze werden bald bemerkbar. Weithin durch die Gegend schallt das Gekrächze der ankommenden und aufbäumenden Vögel, und erst mit dem Eintritt der Dunkelheit verstummt es gänzlich. Am nächsten Morgen erhebt es sich von neuem und verkündet jetzt den allgemeinen Aufbruch. Fortwährend lärmend, krächzend und kreischend, ziehen die Graupapageien dem Binnenland zu, um sich in den auf den Hochebenen mit Vorliebe angelegten Maisfeldern der Neger gütlich zu tun. Halbreifer Mais bildet ihre Lieblingsnahrung, und erschreckend sind die Verheerungen, die sie in den Feldern anrichten. Gegen Sonnenuntergang erst treten sie den Rückzug an, um sich wiederum auf ihren Schlafplätzen zu versammeln. Bei diesen regelmäßigen Streif- und Raubzügen halten sie stets dieselben Zugstraßen ein, insofern sie auf letzteren nicht beunruhigt werden. Wir benutzten solche bald erkundeten Wechsel zum Anstand, um unserer Küche aufzuhelfen, konnten jedoch einen und denselben Platz niemals längere Zeit nacheinander behaupten, weil die klugen Vögel die betreffenden Stellen sich merkten und in weitem Bogen umflogen.
Der Flug der Graupapageien ist erbärmlich zu nennen. Mit kurzen, schnellen Flügelschlägen streben sie in gerader Richtung ihrem Ziel zu; es gewinnt den Anschein, als ängstigten sie sich und fürchteten, jeden Augenblick herabzufallen. Als wir die Küste betraten und zum erstenmal in der Ferne fliegende Jakos bemerkten, glaubten wir Enten vor uns zu sehen; denn deren Flug glich der ihrige. Ein Schuß bringt die fliegenden Jakos vollständig außer Fassung; sie stürzen nach dem Knalle, oft förmlich sich überschlagend, tief herab und erheben sich erst langsam wieder. Lautes Krächzen, wie sie es sonst nur angesichts eines sie bedrohenden Raubvogels ausstoßen, verrät die Angst, die sie ausstehen. Schreckhaft zeigen sie sich überhaupt bei jedem ungewöhnlichen Ereignisse.«
Über das Brutgeschäft selbst vermochte Reichenow eigene Beobachtungen nicht zu gewinnen, und wir sind daher auf die Angaben von Keulemans angewiesen. Auf der Prinzeninsel, wo der letztgenannte Reisende sammelte, findet die Brutzeit im Dezember, nach der Regenzeit, statt. Als Nest dient eine meist sehr tiefe Baumhöhlung. Das Weibchen legt bis fünf reinweiße, ungleichhälftige, nach dem stumpfen Ende sanft, nach dem spitzen stark abfallende und stumpf zugespitzte Eier. Da die Vögel ihre Nester nur im unzugänglichsten Waldesdickicht anlegen, ist es nicht leicht, diese zu finden. In einem gewissen Umkreise findet man oft einige hundert brütende Paare, meist aber nur ein Nest in je einem Baum. Die Alten wissen ihre Brut gut zu verteidigen und werden hierbei von ihren Genossen unterstützt. Die Eingeborenen nehmen die Jungen nicht aus dem Nest, weil sie glauben, in demselben herrsche eine solche Hitze, daß man sich die Finger verbrennen würde, wollte man mit der Hand in die Nesthöhle greifen.
»Unter den gefiederten Räubern«, fährt Reichenow fort, »scheint namentlich der Geierseeadler ( Gypohierax angolensis) ein gefährlicher Feind der Graupapageien zu sein. Ich sah ihn mehrfach letztere verfolgen und erkannte an ihrer entsetzlichen Angst, wie sehr sie diesen Raubvogel fürchteten. Daß dieser, trotzdem er kein gewandter Flugkünstler ist, die ungeschickten Flieger einzuholen und zu überwältigen vermag, unterliegt keinem Zweifel.«
Dohrn rühmt den Braten, den ein zweckentsprechend zubereiteter Jako liefert, als vortrefflich von Geschmack; Reichenow dagegen läßt nur einer aus dem sehr fetten Fleisch gekochten Suppe Gerechtigkeit widerfahren und sagt von dem Fleisch, das wie Rindfleisch aussieht, es sei so zähe, daß man trotz scharfer Messer und guter Zähne es nicht zu zerkleinern vermöge. Die Eingeborenen urteilen wie Dohrn; doch ist hierauf nicht viel zu geben, weil die Neger und alle Innerafrikaner überhaupt jeden Vogel, der in ihre Hände fällt, nachdem sie ihn getötet, mit Haut und Federn und Eingeweiden ins Feuer werfen und, sobald er äußerlich verkohlt ist, als Leckerbissen betrachten und verspeisen. Den Jako jagt man übrigens weniger seines Fleisches als seiner roten Schwanzfedern halber, weil alle Neger die letzteren zu kriegerischem Kopfputze und anderm Zierat benutzen oder auch wohl zu vorgeblichem Zauberwerke, als »Medizin« verwenden.
Überall, wo der Jako vorkommt, wird er von den Eingeborenen gefangen, gezähmt und zum Sprechen abgerichtet, auch als Tauschgegenstand oder als Handelsware verwertet. Denham, Clapperton und Oudney brachten lebende Jakos vom Tschadsee nach England, Heuglin traf denselben Vogel im Lande der Niamniam und Bongo, Livingstone in der Umgegend des Nyanzasees als gezähmten Hausgenossen der Neger an; alle Reisenden, die die Westküste Afrikas besuchten, fanden ihn lebend im Besitz der Eingeborenen, bei dem einen Stamm häufiger, bei dem andern seltener. »Der Jako«, bemerkt Reichenow ferner, »ist der einzige Vogel, der von Westafrika aus regelmäßig auf den europäischen Tiermarkt gelangt; denn die verhältnismäßig wenigen andern Käfigvögel, die aus diesen an anziehenden und fesselnden Erscheinungen so reichen Gegenden zu uns kommen, treffen mehr oder weniger unregelmäßig ein. Der Grund zur Erklärung dieser Tatsache liegt in der Teilnahmslosigkeit und Unzugänglichkeit der Eingeborenen jener Gegenden. Die Neger der Westküste Afrikas sind zu träge, um sich mit dem Vogelfang zu befassen. Vollständig stumpf gegen die sie umgebende Natur, empfinden sie auch keine Freude an gefiederten Hausgenossen. Die Vogelwelt hat für ihren Haushalt nur die eine Bedeutung: den Magen zu füllen. Ich sah daher auch bloß bei den geweckten Bewohnern der Goldküste kleine Käfigvögel. Der Jako aber macht fast allerorten eine Ausnahme von dieser Regel. Man sieht daher die Papageien in den Dörfern allenthalben auf den Strohdächern der Hütten oder auf Bäumen, die für sie vor den Hütten aufgerichtet sind, nach Art unserer Haustauben sitzen und erfreut sich des ungewohnten Schauspiels in so hohem Maß, daß das entzückte Auge das gemarterte Ohr beschwichtigt.
Der Jako ist einer der beliebtesten Stubenvögel und verdient die Gunst, die er genießt; denn er besitzt Sanftmut, Gelehrigkeit und Anhänglichkeit an seinen Herrn, die Bewunderung erregen. Sein Ruhm wird sozusagen in allen Sprachen verkündet; von ihm erzählt jede Naturgeschichte. Eine Menge anmutiger Geschichten von ihm sind aufgezeichnet worden. Ein ganz besonders hervorragender Jako, vielleicht der ausgezeichnetste aller Papageien überhaupt, lebte jahrelang in Wien und Salzburg. Das Wundertier wurde im Jahre 1827 von dem Ministerialrat Andreas Mechletar im Auftrage des Domkapitulars Josef Marchner zu Salzburg von einem Schiffskapitän zu Triest für fünfundzwanzig Gulden gekauft und kam im Jahre 1830 in den Besitz des Domceremoniarius Hanikl. Dieser gab ihm täglich vormittags von neun bis zehn oder abends von zehn bis elf regelrechten Unterricht, beschäftigte sich außerdem viel mit ihm und bewirkte so die hohe Ausbildung seiner geistigen Fähigkeiten. Nach Hanikls Tode wurde der Papagei für hundertfünfzig Gulden und im Jahre 1840 zum zweiten Male für dreihundertsiebzig Gulden verkauft. Ein Freund meines verstorbenen Vaters, Graf Gourcy Droitaumont, war der erste, der im Jahre 1835 in Okens »Isis« einen Bericht über den Vogel gab. Diesen Bericht hat der letzte Besitzer, von Kleimayrn, auf Wunsch unseres Lenz vervollständigt, und so konnte letzterer das ihm Mitgeteilte wie folgt zusammenfassen:
»Der Jako achtet auf alles, was um ihn her vorgeht, weiß alles zu beurteilen, gibt auf Fragen die richtige Antwort, tut auf Befehl, was ihm geheißen wird, begrüßt Kommende, empfiehlt sich Gehenden, sagt nur früh ›Guten Morgen‹ und nur abends ›Gute Nacht‹, verlangt Futter, wenn er Hunger hat. Jedes Mitglied der Familie ruft er bei seinem Namen, und das eine steht mehr bei ihm in Gunst als das andere. Will er mich bei sich haben, so ruft er: ›Papa, komm her!‹ Was er spricht, singt und pfeift, trägt er ganz so vor wie ein Mensch. Zuweilen zeigt er sich in Augenblicken der Begeisterung als Improvisator, und seine Rede klingt dann genau wie die eines Redners, den man von weitem hört, ohne ihn zu verstehen.
Nun das Verzeichnis dessen, was der Jako spricht, singt, pfeift usw.: ›Geistlicher Herr! guten Morgen.‹ ›Geistlicher Herr! ich bitt' um a Mandl.‹ ›Magst a Mandl? Magst a Nuß? Bekommst schon was? Da hast was.‹ ›Herr Hauptmann, grüß Gott, Herr Hauptmann.‹ ›Frau Baumeisterin, gehorsamer Diener.‹ ›Bauer, Spitzbub, Spitzbub, Bauer, Wilddieb, gehst weiter? gehst weiter, gehst nach Haus, gehst nach Haus oder nicht? wart, du Kerl!‹ ›Du Lump du! Du Kerl, du abscheulicher du!‹ ›Braver Paperl, guter Paperl!‹ ›Du bist a braves Buberl, gar a brav's Buberl!‹ ›Bekommst an Kukuruz, bekommst schon was.‹ ›Nani! Rani!‹ ›Herr Nachbar! Zeit lassen! Herr Nachbar! Zeit lassen!‹ Wenn jemand an der Tür klopft, so ruft er sehr laut, sehr deutlich und ungemein täuschend wie ein Mann: ›Herein, herein! Empfehl mich, Herr Bräu, gehorsamer Diener! Freut mich, daß ich die Ehre hab', freut mich, daß ich die Ehre hab'.‹ Er klopft auch selbst an sein Haus und ruft obiges. – Er ahmt den Kuckuck sehr gut nach. – ›Gib mir a Busserl, a schön's Busserl; kriegst a Mandl.‹ ›Schau her da! Komm heraus!‹ ›Komm herauf, komm her da!‹ ›Mein liebes Paperl!‹ ›Bravo, bravissimo!‹ ›Beten, gehen wir zum Beten!‹ ›Gehen wir zum Essen!‹ ›Gehen wir zum Fenster!‹ ›Hieronymus, steh auf!‹ ›Ich geh, bfiet Gott!‹ (behüt' dich Gott!) ›Es lebe unser Kaiser! er lebe recht lange!‹ ›Wo kommst du her? Verzeihen Ihr Gnaden, ich hab' glaubt, Sie sein a Vogel.‹ – Wenn er etwas zerbeißt oder in seinem Hause etwas ruiniert, so sagt er: ›Nicht beißen, gib Ruh! Was hast 'tan?‹ ›Was hast du getan? Wart', du Spitzbub du! Du Kerl du! Wart', ich hau dich!‹ ›Paperl, wie geht's dir denn, Paperl?‹ ›Hast was z'essen?‹ ›Guten Appetit!‹ ›Bst! Bst! Guts Nacht!‹ ›Der Paperl darf herausgehen, komm, allo komm!‹ ›Paperl, schieß, schieß, Paperl!‹ Dann schießt er, indem er laut ruft: ›Puh!‹ ›Gugu! Gugu!‹ (da da da da da). ›Geh nach Haus! Gehst nach Haus? Allo marsch!‹ ›Gleich geh nach Haus! Wart', ich hau dich!‹ Er läutet an einer Glocke, die in seinem Hause angebracht ist, und ruft laut: ›Wer läut'? Wer läut'? Der Paperl.‹ ›Kakadu, Kakadu!‹ ›Gagagaga! Wart' mit dein Ga, du – – du!‹ ›'s Hunderl ist da, a schön's Hunderl ist da, gar a schön's Hunderl!‹ Dann pfeift er dem Hunde. – Er fragt: ›Wie spricht's Hunderl?‹ Dann bellt er. Darauf spricht er: ›Pfeif 'n Hunderl!‹ Dann pfeift er dem Hunde. Wenn man ihm befiehlt: ›Schieß!‹ so schreit er: ›Puh!‹ Dann macht er ein ordentliches Kommando: ›Halt! richt' euch! Halt, richt'! Macht euch fertig! Schlagt an, hoch! Feuer! Puh! Bravo, bravissimo!‹ Bisweilen läßt er das ›Feuer‹ aus und ruft nach dem ›Schlagt an, hoch!‹ gleich ›Puh!‹ Worauf er aber nicht ›Bravo, bravissimo!‹ ruft, gleichsam im Bewußtsein seines Fehlers. – ›Bfiet Gott, a Dio! Bfiet Ihnen Gott!‹ So sagt er zu den Leuten, wenn sie fortgehen. ›Was? mich beuteln? was? mich beuteln?‹ Er macht ein Zetergeschrei, als wenn er gebeutelt würde, dann ruft er wieder: ›Was? mich beuteln? mich beuteln? Wart, du Kerl! Mich beuteln?‹ ›Ja, ja, ja, so geht's auf der Welt! A so, a so!‹ Dann lacht er mit der größten Deutlichkeit. ›Der Paperl ist krank, der arme Paperl ist krank.‹ ›Hörst den Hansel?‹ ›Gugu, Gugu! Da ist der Paperl!‹ ›Wart', ich will dich beuteln, dich!‹ Wenn er den Tisch decken steht oder von dem zweiten oder dritten Zimmer aus es hört, so ruft er gleich: ›Gehen wir zum Essen! Allo! komm zum Essen!‹ Wenn sein Herr im zweiten oder dritten Zimmer frühstückt, so ruft er: ›Kakau (Kakao)! Bekommst an Kakau, bekommst schon was!‹
Wenn er zur Chorzeit das Glöcklein von der Domkirche läuten hört, so ruft er: ›Ich geh, bfiet Gott! ich geh!‹ Wenn sein Herr außer der Chorzeit ausgeht, so ruft der Papagei, ist er auch die ganze Zeit still gewesen, beim Öffnen der Tür fast jederzeit so recht gutherzig: ›Bfiet Gott!‹ Waren aber fremde Personen da, so ruft er bei ihrem Fortgehen: ›Bfiet Ihnen Gott!‹ Wenn er bei Nacht im Zimmer seines Herrn ist, so bleibt er so lange ruhig, als sein Herr schläft. Ist er aber bei Nacht in einem andern Zimmer, so fängt er mit Tagesanbruch zu sprechen, zu singen und zu pfeifen an.
Der Eigentümer des Jako hatte eine Wachtel. Als sie im Frühjahr das erstemal ihr ›Pickerwick‹ schlug, kehrte sich der Papagei gegen sie und rief: ›Bravo! Paperl! Bravo!‹ Um zu sehen, ob es möglich wäre, ihn auch etwas singen zu lehren, wählte man anfangs solche Worte, die er ohnehin aussprechen konnte, z. B. wie folgt: ›Ist der schöne Paperl da? ist der brave Paperl da? ist der liebe Paperl da? ist der Paperl da? Ja, ja!‹ Später lernte er das Liedchen singen: ›O Pitzigi, o Pitzigi, blas anstatt meiner Fagott, blas anstatt meiner Fagott, blas, blas, blas, blas anstatt meiner Fagott, blas anstatt meiner Fagott!‹ Er stimmt auch Akkorde an und pfeift eine Skala hinauf und herunter sehr geläufig und sehr rein, pfeift andere Stückchen und Triller; doch pfeift und singt er dieses alles nicht jederzeit im nämlichen Tone, sondern bisweilen um einen halben oder ganzen Ton tiefer oder höher, ohne daß er falsche Töne hervorbringt. In Wien lernte er auch eine Arie aus der Oper ›Martha‹ pfeifen, und da ihm dabei von seinem Lehrmeister nach dem Takt vorgetanzt wurde, so ahmte er den Tanz wenigstens dadurch nach, daß er einen Fuß nach dem andern hob und dabei den Körper possierlich hin und her bewegte.
Kleimayrn starb im Jahre 1853. Jako begann, und wie es schien aus Sehnsucht nach seinem geliebten Herrn, zu kränkeln, wurde im Jahre 1854 ganz matt in ein kleines Bettchen gelegt, sorgfältig gepflegt, schwatzte da noch fleißig, sagte oft mit trauriger Stimme: ›Der Paperl ist krank, armer Paperl ist krank‹, und starb.«
Ich könnte noch von mehreren grauen Papageien berichten, die es ebenfalls weit brachten in der Kunst zu sprechen; doch schließt Vorstehendes eigentlich alles in sich ein, was ein Vogel dieser Art hierin leisten kann. Nur erwähnen will ich noch, daß das wundervolle Gedächtnis und die Nachahmungsgabe des geistvollen Tieres auch ihre Schattenseiten hat. Die ersten Lehrmeister des grauen Papageis pflegen die Matrosen zu sein, die später oft in den Bedienten des Hauses entsprechende Hilfe finden. Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, daß in solcher Schule der Wortschatz des Papageis nicht immer mit dem Edelsten und Feinsten bereichert wird. Leider kommen später auch dem wohlgezogensten Vogel oft genug alte Worte wieder in Erinnerung, und mitten unter seine hübschen Sätze und Redensarten mischt er die rohesten und gemeinsten. Zudem findet der Papagei die absonderlichsten Töne, Laute und Geräusche oft äußerst nachahmenswert, lernt mit derselben Fertigkeit wie Worte das Knarren einer Tür in seiner Nähe, das Bellen des Hundes, das Miauen der Katzen, das Husten eines alten Menschen nachahmen und stört durch alles dies oft wesentlich sein im übrigen liebenswürdiges Geplauder.
Aber nicht bloß über den Verstand, sondern auch über das Gemüt des grauen Papageis sind hübsche Beobachtungen bekannt geworden. »Ein Freund von mir«, erzählt Wood, »besaß einen Vogel dieser Art, der die zierlichste und liebenswürdigste Pflegemutter anderer kleiner hilfloser Geschöpfe war. In dem Garten seines Eigners gab es eine Zahl von Rosenbüschen, die von einem Drahtgehege umwoben und von Schlingpflanzen dicht umsponnen waren. Hier nistete ein Paar Finken, das beständig von den Einwohnern des Hauses gefüttert wurde, die gegen alle Tiere freundlich gesinnt waren. Die vielen Besuche des Rosenhaines fielen Polly, dem Papagei, bald auf; er sah, wie dort Futter gestreut wurde, und beschloß, so gutem Beispiel zu folgen. Da er sich frei bewegen konnte, verließ er bald seinen Käfig, ahmte den Lockton der alten Finken täuschend nach und schleppte den Jungen hierauf einen Schnabel voll nach dem andern von seinem Futter zu. Seine Beweise von Zuneigung gegen die Pflegekinder waren aber den Alten etwas zu stürmisch; unbekannt mit dem großen Vogel, flogen sie erschreckt von dannen, und Polly sah jetzt die Jungen gänzlich verwaist und für ihre Pflegebestrebungen den weitesten Spielraum. Von Stund' an weigerte sie sich, in ihren Käfig zurückzukehren, blieb vielmehr Tag und Nacht bei ihren Pflegekindern, fütterte sie sehr sorgfältig und hatte die Freude, sie großzuziehen. Als die Kleinen flügge waren, saßen sie auf Kopf und Nacken ihrer Pflegemutter, und dann kam es vor, daß Polly sehr ernsthaft mit ihrer Last umherging. Doch erntete der Papagei wenig Dank; als den Pflegekindern Schwingen gewachsen waren, flogen sie auf und davon.«
Gefangene Jakos schreiten selten zur Fortpflanzung. Doch sind einige Fälle bekannt, daß sie auch im engen Gebauer legten, brüteten und Junge zogen. Schon Buffon berichtet von einem Pärchen, das fünf bis sechs Jahre nacheinander jedesmal vier Eier legte und seine Jungen regelmäßig aufzog. Auch Laboc erzählt Ähnliches, und neuerdings hat Buxton an seinen frei fliegenden Jakos erfahren, daß sie in einer Baumhöhlung drei Junge aufzogen. Eines von diesen starb; die beiden andern aber flogen lustig mit den übrigen Papageien, die Buxton aussetzte, umher und fanden sich mit ihnen jeden Morgen ein, um ihr Futter in Empfang zu nehmen.
Zweckmäßig gepflegte, möglichst einfach gefütterte Jakos erreichen ein hohes Alter. Derjenige, den der Kaufmann Minninck-Huysen in Amsterdam besaß, hatte, bevor er durch Erbschaft seinem späteren Besitzer zufiel, bereits zweiunddreißig Jahre in der Gefangenschaft gelebt und hielt dann noch einundvierzig Jahre aus. Ungefähr vier bis fünf Jahre vor seinem Ende wurde er altersschwach. Seine Lebhaftigkeit und seine Geistesfähigkeiten, namentlich sein Gedächtnis, nahmen ab und schwanden endlich gänzlich dahin. In den letzten zwei Jahren konnte er nicht mehr auf seiner Stange sitzen, sondern nur noch auf dem Boden hocken. Zuletzt war er nicht mehr imstande, selbst zu fressen, und mußte gefüttert werden. Auch seine Mauser ging in den letzten Jahren seines Lebens nur sehr unvollkommen vonstatten. Altersmatt und schwach schwand er ganz allmählich dahin.
*
Eine der zahlreichsten Sippen der Unterfamilie umfaßt die Amazonen- oder Grünpapageien ( Amazona), große oder mittelgroße, gedrungen gebaute Vögel mit sehr kräftigem, mäßig gewölbtem Schnabel, dessen Firste nur nach hinten zu scharfkantig abgesetzt ist, mäßig langem Fittich, unter dessen Schwingen die zweite und dritte die längsten sind, wenig oder kaum vorragender Flügelspitze, kurzem, höchstens mittellangem, etwas gerundetem Schwanze und derbem, breitem, am Ende abgestutztem Kleingefieder, das Wachshaut und Augenkreis in der Regel frei läßt.
Die Amazonenpapageien, von denen man einige dreißig Arten unterschieden hat, sind so übereinstimmend gebaut und gefärbt, daß Finsch in ihnen die am höchsten entwickelte Sippe der ganzen Ordnung, also gewissermaßen die Urbilder der Papageien überhaupt, erkennen zu dürfen glaubt. Diese Ansicht wird durch die hohe geistige Begabung unserer Papageien unterstützt und mag deshalb erwähnt sein. Das Verbreitungsgebiet der Gruppe erstreckt sich von den Platastaaten bis Südmexiko; als Brennpunkt desselben darf der Amazonenstrom gelten. Einige Arten bevölkern Westindien und vertreten sich hier auf den verschiedenen Eilanden gegenseitig, haben auch einen so beschränkten Wohnkreis, daß man geneigt ist, sie als ständige Abarten einer und derselben Form aufzufassen. Lebensweise, Sitten und Gewohnheiten, Wesen und Betragen sämtlicher Arten stimmen in allen Zügen überein; das von einem zu Sagende gilt mit unerheblichen Beschränkungen für alle.
Als Vertreter der Sippe mag uns der Amazonenpapagei, »Kurika« und »Papageio« der Brasilianer ( Amazona amazonica), gelten. Er zählt zu den mittelgroßen Arten seiner Sippschaft; die Länge beträgt fünfunddreißig, die Breite sechsundfünfzig, die Fittichlänge neunzehn, die Schwanzlänge zehn Zentimeter. Das Gefieder ist dunkel grasgrün, das des Hinterhalses durch verwischte schwärzliche Endsäume der Federn gezeichnet, ein breiter Stirnrand lilablau, der Oberkopf nebst Backen hochgelb, der Flügelbug grün, an der Handwurzel gelb; die Handschwingen sind, mit Ausnahme der ersten schwarzen, an der Wurzel der Außenfahne mattgrün, dahinter indigoblau, die zweite bis vierte Armschwinge an der Wurzel grün, in der Mitte zinnoberrot, an der Spitze indigoblau, die übrigen, ausgenommen die zwei letzten grünen, außen grün, innen schwarz und am Ende blau, die Unterseite aller Schwingen schwarz, innen in der Wurzelhälfte grün, die unteren Flügeldecken grün, die vier äußeren Schwanzfedern jederseits innen licht zinnoberrot, außen dunkelgrün, an der Spitze grüngelb; die fünfte Steuerfeder zeigt auf der grünen Innenfahne einen roten Fleck, die zweite und dritte einen ebenso gefärbten, aber verwaschenen an der Wurzel und am Schaft; das Rot der übrigen ist in der Mitte durch einen breiten grünen Querstreifen getrennt; die unteren Schwanzdecken haben gelbgrüne Färbung; die Schwanzfedern von unten gesehen auf matt zinnoberrotem Grunde in der Mitte einen grünen Quer- und einen breiten gelbgrünen Endstreifen. Der Augenstern ist zinnoberrot, der Schnabel horngelb, an der Spitze dunkelbraun, der Fuß bräunlich. Gefangene ändern leicht ab und stellen dann verschiedene, zum Teil sehr hübsche Spielarten dar.
Das Verbreitungsgebiet des Amazonenpapageis erstreckt sich vom mittleren Brasilien bis Britisch-Guayana und Trinidad und reicht nach Westen hin bis Bogota, Ecuador und Venezuela.
»In allen von mir bereisten Gegenden der brasilianischen Ostküste«, sagt Prinz von Wied, der die Kurika oder Kuricke am ausführlichsten schildert, »ist dieser Papagei einer der gemeinsten. Ich fand ihn überall in Menge, wo dichte Urwälder an die Manguesümpfe und Flußmündungen grenzen; denn er brütet sowohl hier als dort, scheint aber die Früchte der Mangue zu lieben. Schon in den Umgebungen von Rio de Janeiro, da, wo große Waldungen sind, trifft man diese Papageien in Menge an; aber auch an den nördlichen Flüssen, am Parahiba, Espirito Santo, am Belmonte, überall haben wir sie gefunden und besonders morgens und abends ihre laute Stimme in den sumpfigen, häufig von der Flut unter Wasser gesetzten Gebüschen der Flußmündungen gehört. Diese Gebüsche sind für die brasilianischen Flüsse etwa dasselbe, was an den europäischen die Weidengebüsche; nur sind gewöhnlich die Bäume höher, weshalb auch oft die Papageien in starken, hohlen Ästen oder Stämmen derselben nisten.
In der Brutzeit fliegt die Kuricke paarweise, gewöhnlich hoch in der Luft, laut schreiend und rufend, schnell dahin. Außer der Paarzeit hält sie sich immer in manchmal höchst zahlreichen Gesellschaften. Ich habe solche, ich möchte sagen unzählige Gesellschaften kurzgeschwänzter Papageien in den Waldungen des Mucuri und an andern Orten zusammengesehen, wo der ganze Wald von ihnen und ihrem außerordentlichen Geschrei erfüllt war. Auch waren hier mehrere Arten dieser Vögel vereint. Es dauerte lange, bis die Flüge vorüber waren, und ihr vereinter Ruf war merkwürdig anzuhören. Eine Gesellschaft trieb die andere von den Bäumen auf, und diese Unruhe belebte ganz besonders ihre Stimme. Solche Vereinigungen unter den Papageien sind zwar zahlreich; doch kann man sie mit den ungeheuren Zügen der Wandertaube in Nordamerika nicht vergleichen.
Fallen diese Vögel in dem Urwalde auf einen hohen, dichtbelaubten Baum, so ist es oft schwer, sie zu sehen. Die grüne Farbe schützt sie sehr; man bemerkt aber ihr Dasein an dem Herabfallen der Fruchthülsen und Kerne. Während sie fressen, sind sie still; sobald sie jedoch aufgeschreckt werden, geben sie sogleich ihre laute Stimme von sich. Man schießt sie in Menge, weil sie ein kräftiges Essen geben; eine Papageibrühe ist nicht bloß in Brasilien, sondern auch in Surinam ein beliebtes Gericht.«
Sämtliche Amazonenpapageien werden sich hinsichtlich ihrer Fortpflanzung wahrscheinlich ähneln. Diejenigen, über deren Lebensweise auch in dieser Beziehung Beobachtungen veröffentlicht wurden, legen während des Frühlings drei bis vier weiße Eier in Baumhöhlungen auf die losgebissenen Späne der Höhlenwandungen selbst. Sie brüten, ungestört, nur einmal im Jahre, und zwar im Frühling jener Länder. Die aus dem Nest genommenen Jungen werden außerordentlich zahm und lernen deutlich sprechen. Deshalb findet man sie in Brasilien häufig in den Wohnungen und bringt sie in Menge in die Städte, wo Matrosen sie kaufen, um sie mit sich nach Europa zu nehmen. Hier gehören sie zu den gewöhnlichsten Papageien. Sie erweisen sich gelehrig, wenigstens gegen ihre rechtmäßigen Gebieter oder gegen diejenigen, die sich am meisten mit ihnen beschäftigen, sind auch ziemlich sanft und liebenswürdig, verdienen also wohl das Lob, das man ihnen spendet. Ein Amazonenpapagei, der Buxton entflogen war und sich drei Monate lang im Garten umhertrieb, bis der herannahende Winter ihn veranlaßte, das gastliche Dach des Hauses wieder aufzusuchen, ergötzte nach seiner Rückkehr allgemein durch genaueste Wiederholung der von verschiedenen Stubenmädchen in ängstlichem Tone an ihn ergangenen Einladungen, doch zurückkehren zu wollen, schien also offenbar zu wissen, daß jene Einladungen ihm gegolten hatten. Ein Amazonenpapagei, den mein Vater sah, hing mit inniger Liebe an der Tochter des Hauses, während er nicht nur gegen fremde, sondern selbst gegen die andern Glieder der Familie sich bösartig zeigte. Diese mochten noch so freundlich mit ihm reden; er antwortete ihnen nicht und bekümmerte sich nicht um sie. Ganz anders aber benahm er sich, wenn seine Gönnerin erschien. Er kannte ihren Schritt und gebärdete sich höchst erfreut, wenn er sie auf der Treppe kommen hörte. Sobald sie in das Zimmer trat, eilte er ihr entgegen, setzte sich auf ihre Schultern und gab durch verschiedene Bewegungen und Laute seine Zufriedenheit zu erkennen oder schwatzte, als ob er sich mit seiner Herrin unterhalten wolle. Liebkosungen, die ihm gespendet wurden, erwiderte er, indem er seinen Schnabel sanft an die Wangen seiner Gebieterin drückte, und immer ließ er dabei zärtliche Laute vernehmen. Das Fräulein durfte unbesorgt mit ihm spielen; er nahm ihre Finger in den Schnabel, ergriff selbst die Oberlippe, ohne solches Vertrauen jemals zu mißbrauchen. Wenn seine Herrin abwesend war, gebärdete er sich traurig, saß ruhig auf einer und derselben Stelle, fraß gewöhnlich nicht und war mit einem Wort ein ganz anderer geworden als sonst. Ich habe mehrere Amazonenpapageien gesehen, auch selbst solche gepflegt, die sich im wesentlichen ebenso liebenswürdig zeigten, auch erfahren, daß sich Wildlinge leicht zähmen lassen, darf sie daher jedermann empfehlen.
*
Unter dem Sippennamen Langflügelpapageien ( Pionias) vereinigen wir einige vierzig Arten der Unterfamilie. Ihre Größe schwankt zwischen der einer Taube und der einer Dohle; die Gestalt ist kurz und dick, also gedrungen. Die Langflügelpapageien verbreiten sich über drei Erdteile. Südamerika beherbergt die Hälfte von ihnen, Afrika den größeren, Asien den geringeren Teil der andern Hälfte. Ihre Lebensweise weicht nicht erheblich von dem Tun und Treiben anderer Kurzschwanzpapageien ab.
Wenn auch vielleicht nicht das schönste, so doch eines der auffallendsten Glieder der reichen Sippe ist der Fächerpapagei ( Pionias accipitrinus). Das Gefieder des Hinter- und Seitenhalses, der ganzen Oberseite und der Schenkel ist glänzend dunkelgrün, das des Vorder- und Oberkopfes licht bräunlichgelb, wie heller Milchkaffee, der Schläfe, Ohrgegend, Zügel und Kopfseiten sowie des Kinns bräunlichfahl, durch verwaschene, fahlweiße Schaftstreifen und Schaftflecke gezeichnet, das aus breiten Federn bestehende, sehr verlängerte, aufrichtbare und dann eine fächerförmige Holle bildende des Hinterkopfes und Nackens dunkelkarminrot, ins Veilchenfarbene spielend, jede Feder an der Wurzel braunfahl, an der Spitze durch einen breiten, blauen Saum geziert, das der ganzen Unterseite, mit Ausnahme der seitlichen, außen grünen Brustfedern, ebenso gefärbt und gezeichnet; die Handschwingen und deren Deckfedern sind ganz, die vorderen Armschwingen nur in der Wurzelhälfte der Innenfahne schwarz, die drei letzten grün, die Schwanzfedern, mit Ausnahme der äußersten innen schwarzen, außen dunkel schwarzblauen, grün wie der Rücken, innen breit mattschwarz gerandet, die Unterschwanzdecken endlich grün. Der Augenstern ist braun; Schnabel, Füße sowie die nackten Augenkreise sehen braunschwarz aus. Die Länge beträgt, nach Burmeister, siebenundzwanzig, die Fittichlänge achtzehn, die Schwanzlänge vierzehn Zentimeter. Soviel bis jetzt bekannt, bewohnt der Fächerpapagei vorzugsweise die Waldungen um den Amazonenstrom, Surinam und Guayana, wie es scheint überall minder häufig als andere Papageien.
Ich habe längere Zeit einen Fächerpapagei gepflegt und zwei andere in Tiergärten gesehen. Alle drei, insbesondere aber mein Pflegling, waren höchst anmutende Vögel. Zutraulich und hingebend wie irgendein wohlgezähmter Papagei, sanft und ruhig, ich möchte sagen leidenschaftslos, befreundete sich mein Gefangener bald innig mit mir, begrüßte mich durch verlangendes Gebärdenspiel, wenn ich an seinem Käfig vorüberging, und gab sich mit ersichtlichem Behagen Liebkosungen hin, die ich ihm spenden durfte, ohne befürchten zu müssen, von ihm gebissen zu werden. Die oft zu förmlicher Arglist ausartende Bosheit anderer Papageien lag ihm fern. Auch er liebte es, wenn man ihm im Gefieder nestelte, und hob denn gewöhnlich langsam die verlängerten Federn seines Hinterhauptes, um den ihn außerordentlich schmückenden Fächer nach und nach voll zu entfalten. Dies aber geschah keineswegs im Zorn, wie Schomburgk meint, sondern viel öfter bei freudiger Erregung.
Ein anderer Fächerpapagei, den ich beobachtete, gab so verschiedenartige Töne und Laute zu hören, daß ich glauben mußte, dieselben seien ihm angelernt worden und er würde, hätte man sich zweckentsprechend mit ihm abgegeben, sprechen gelernt haben. Über die hohe Begabung des Vogels konnten Zweifel nicht bestehen. Zwar fehlten ihm fast alle die ausdrucksvollen Gebärden, durch die beispielsweise ein Kakadu sich verständlich zu machen strebt; er unterschied aber sehr genau zwischen ihm bekannten und fremden Leuten, bekundete rege Teilnahme für alles um ihn her, achtete auf den Ruf seiner Freunde und ging zuvorkommend auf deren Wünsche ein. So konnte es nicht fehlen, daß er bald zu einem mit vollstem Recht bevorzugten Liebling von mir wurde.
*
Die Zwergpapageien ( Agapornis) gehören zu den anmutigsten Gliedern dieser Unterfamilie; ihre äußere Erscheinung wenigstens ist gefällig und gewinnend, und auch ihr Betragen in mancher Beziehung anziehend und fesselnd. »Die deutschen Dichter«, sagt Schomburgk, »kannten die zärtliche Liebe nicht, die zwischen einem Pärchen der Zwergpapageien waltet; deshalb wählten sie ein Taubenpaar zum Sinnbild der idyllischen Liebe. Allein, wie weit bleibt ein solches in seiner Zärtlichkeit hinter jenem zurück! Hier herrscht die vollkommenste Harmonie zwischen dem beiderseitigen Wollen und Tun; frißt das eine, so tut dies auch das andere; badet sich dieses, so begleitet es jenes; schreit das Männchen, so stimmt das Weibchen unmittelbar mit ein; wird dieses krank, so füttert es jenes, und wenn noch so viele auf einem Baum versammelt sind, so werden doch niemals die zusammengehörenden Pärchen sich trennen.«
Unter allen mir bekannten Arten der Sippe stelle ich den Rosenpapagei ( Agapornis roseicollis) obenan. Er zählt zu den größeren Arten der Sippe; seine Länge beträgt siebzehn, die Fittichlänge zehn, die Schwanzlänge fünf Zentimeter. Die vorherrschende Färbung des Gefieders ist ein schönes Grasgrün, das unterseits etwas lichter wird und auf den Seiten einen gelben Schimmer zeigt; ein Stirnstreifen und die Augenbrauen sind blaß scharlach-, Zügel, Backen, Ohrgegend und Kehle zart pfirsich- oder blaß rosenrot, nach unten zu unmerklich in die grüne Färbung übergehend, Bürzel und obere Schwanzdecken himmelblau, die Schwingen außen grasgrün, nach der Spitze zu dunkler, fast schwärzlich, unterseits schwärzlich, innen verloschen bläulich gesäumt, die beiden mittelsten Steuerfedern einfarbig grün, die übrigen grün, am Ende grünlichblau, vorher durch eine schwärzliche Querbinde, in der Wurzelhälfte aber mit einem zinnoberroten Fleck gezeichnet. Der Augenstern ist dunkelbraun, der schmale Augenkreis weißlich, der Schnabel wachsgelb, an der Spitze grünlich, der Fuß blaugrünlich. Der junge Vogel unterscheidet sich von beiden gleichgefärbten Eltern durch düsterere Färbung und den Mangel der roten Stirnbinde.
Das Vaterland des Rosenpapageis ist der Südwesten Afrikas; doch scheint der Vogel, wie Kirk angibt, auch im Südosten, zumal im Sambesigebiet, vorzukommen. Nach Ortlepps Angabe ist er ein großer Liebling der Bauern von Limpopo und wird häufig im Käfig gehalten.
Mitteilungen über sein Freileben gibt meines Wissens nur Andersson. »Dieser hübsche kleine Papagei ist über ganz Damara- und Großnamakaland verbreitet, wird aber auch in Owakango und am Ngamisee gefunden. Man begegnet ihm stets in kleinen Flügen und niemals weit entfernt von einem Gewässer. Zu einem solchen begibt er sich mindestens einmal täglich und kann demgemäß dem durstigen Reisenden zu einem verläßlichen Führer werden, falls dieser erfahren genug ist, um hieraus Vorteil zu ziehen und die oft sehr kleinen oder an ungewöhnlichen Stellen belegenen Trinkplätze aufzufinden.
Der Rosenpapagei hat einen ungemein schnellen Flug; die kleinen Schwärme eilen gedankenschnell an einem vorüber, wenn sie ihre Futterplätze wechseln oder sich zur Tränke begeben, durchmessen jedoch selten verhältnismäßig weite Strecken in einem Zuge. Während sie fliegen, stoßen sie in rascher Folge scharfe Laute aus, und ebenso lassen sie sich vernehmen, wenn sie plötzlich erschreckt wurden. Ihre Nahrung besteht aus Beeren und großen beerenartigen Sämereien.
Diese Papageien bereiten sich kein eigenes Nest, sondern nehmen von dem anderer Vögel, insbesondere des Siedelsperlings und Mahaliwebers, Besitz. Ich vermag nicht zu sagen, ob sie die rechtmäßigen Eigner vertreiben oder sich nur der verlassenen Nester derselben bedienen; Rosenpapageien und Siedelsperlinge aber habe ich in annähernd gleicher Anzahl im Schutze eines und desselben Nestdaches hausen sehen. Die reinweißen Eier sind länglicher als die der Spechte.«
Gefangene Rosenpapageien, die ich mehrere Jahre nacheinander pflegte und beobachtete, haben mich in hohem Grade angezogen. Ihr Wesen und Gebaren sticht vorteilhaft ab von dem Tun und Treiben anderer Zwergpapageien; sie sind offenbar begabter, leiblich und geistig reger als diese, besitzen alle anmutenden Eigenschaften derselben und noch andere dazu, die sehr für sie einnehmen. Vielleicht sagt man nicht zuviel, wenn man sie zu den anmutigsten aller Papageien überhaupt rechnet. Sie halten ihr Gefieder stets in bester Ordnung, sehen daher immer höchst sauber aus, gefallen auch wegen ihrer schlanken Haltung, sind sehr munter, lebhaft und rege, viel in Bewegung, laut, verträglich, mindestens gegen ihresgleichen, äußerst zärtlich gegen ihren Gatten und hingebend in der Pflege ihrer Brut. In ihren kletternden Bewegungen ähneln sie andern Kurzschwanzpapageien, erinnern aber auch an die Zierpapageien, da sie sich zuweilen wie diese, den Kopf nach unten gerichtet, an der Decke ihres Käfigs aufhängen. Ihre Stimme ist für ein kleines Zimmer fast zu gellend, behelligt jedoch in einem größeren Raume, zumal im freistehenden Fluggebauer, wenig oder nicht. Am besten bezeichnet man sie, wenn man sie ein Zwitschern nennt, das zuweilen in Trillern übergeht. Nach meinem Gehör läßt sich der gewöhnliche Stimmlaut durch ein zehn- bis zwanzigmal wiederholtes »Zickzick«, der Warnungston durch »Tirrirrirrirrit zit tit zit, tiet, tiet« oder auch durch »Ziterititititie«, mit angehängtem »Zit«, übertragen. Zuweilen sitzt das Männchen in lässiger Haltung, mit etwas gesträubten Federn und geschlossenen Augen, wie in sich versunken, regungslos auf einer und derselben Stelle und gibt einen zwitschernden Gesang zum besten, dessen einzelne Töne zwar dieselben sind, die man auch beim Locken und Schwatzen vernimmt, jedoch durch verbindende Laute erweicht und vertönt werden, hinsichtlich ihrer Stärke und Betonung auch sehr verschieden sind, so daß ansprechende Mannigfaltigkeit entsteht.

Blaukrönchen ( Coryllis galgulus) 180
Fesseln die Rosenpapageien schon, wenn man sie einzeln oder in größeren Gesellschaften hält, jeden achtsamen Pfleger, so entfalten sie ihre ganze Eigenartigkeit doch erst, wenn sie sich zum Brüten anschicken. Der Zufall belehrte mich über die unerläßlichen Bedürfnisse dieser Vögel. Anderssons Angaben über das Freileben waren zur Zeit, als ich die ersten Rosenpapageien erwarb, noch nicht veröffentlicht worden; ich konnte daher nicht ahnen, daß sich deren Fortpflanzungsgeschäft so wesentlich von dem anderer Zwergpapageien und Sittiche überhaupt unterscheidet. Meine Pfleglinge waren gepaart, die Pärchen überhäuften sich auch gegenseitig mit Zärtlichkeiten, schritten aber nicht zum Brüten. Gegen ihre Käfiggenossen, kleine Webefinken, benahmen sie sich ebenso unfriedfertig als gegen ihresgleichen verträglich, zerstörten deren Nester und trieben anderweitigen Unfug. Ich hielt das für Übermut, wie man ihn an Papageien oft beobachtet, und ließ sie gewähren. In die für sie bestimmten Nistkästchen schlüpften sie aus und ein, schienen dieselben aber mehr als Verstecke, denn als Nistplätze zu betrachten. Sie waren unzweifelhaft brütlustig; es fehlte ihnen aber offenbar an etwas. Da sie bisher nur Körnerfutter, Glanz, Hirse, Hanf und Hafer angenommen, Mischfutter aber verschmäht hatten, kam ich auf den Gedanken, daß sie vielleicht Knospenfresser sein möchten, und ließ ihnen grüne beblätterte Weidenzweige reichen. Wenige Minuten später saßen sie auf denselben, entblätterten sie rasch und benagten Knospen und Rinde. Anfänglich wollte mir scheinen, als ob diese Arbeit ebenfalls nur aus Zerstörungslust, nicht aber, um sich zu ernähren, unternommen werde; als ich jedoch aufmerksam weiter beobachtete, bemerkte ich, daß meine Vögel nunmehr endlich erwünschte Baustoffe gefunden hatten. Geschickt spleißten sie ein Schalenstück von sechs bis zehn Zentimeter Länge ab, faßten es hierauf so mit dem Schnabel, daß das eine Ende etwa drei Zentimeter weit hervorragte, drehten sich um, sträubten die Bürzelfedern, nestelten mit dem Schnabel in ihnen, und der Splitter blieb zwischen den wieder geglätteten Federn haften. Ein zweiter, dritter, sechster, achter wurden in derselben Weise abgelöst und befestigt; manch einer fiel dabei zum Boden herab, ohne weitere Beachtung zu finden, manch einer wurde von dem allzu eifrigen Gatten wieder zwischen den Federn hervorgezogen; schließlich aber blieben doch einige haften; der Papagei erhob sich, schwirrte langsam und vorsichtig zum Nistkästchen auf, schlüpfte mit voller Ladung ein und kehrte leer zurück. Ob auch andere Zwergpapageien in ähnlicher Weise verfahren, weiß ich nicht, halte es jedoch für wahrscheinlich.
Wenige Tage nach Beginn des Eintragens der Niststoffe erfolgte die erste Begattung des einen Pärchens, einige Tage später die eines zweiten. Wann das erste Ei gelegt wurde, wie lange die Brütezeit, wie lange die Wiegenzeit der Jungen währt – dies alles vermag ich nicht zu sagen, weil ich den Vögeln durch Untersuchen ihres Nestes nicht hinderlich oder lästig werden wollte. Ich habe bloß erfahren, daß das Nest aus den abgespleißten Splittern sauber hergestellt wird und ungefähr zwei Dritteln einer hohlen Halbkugel gleicht, daß das weiße Ei sehr rundlich und verhältnismäßig groß ist, daß die zwei bis fünf Jungen zehn oder elf Wochen nach der ersten Paarung ausschlüpfen und daß deren oben beschriebenes Kleid im dritten oder vierten Monat durch Verfärbung in das ihrer Eltern übergeht, aber erst im achten Monat des Lebens durch Vermauserung neu gebildet wird, wogegen der anfangs schwärzliche Oberschnabel schon etwa vier Wochen nach dem Ausfliegen verbleicht. Gefüttert wurden die Jungen von beiden Eltern, und zwar nicht allein mit Pflanzenstoffen, sondern auch mit Nachtigallenfutter, was die Folgerung erlaubt, daß die Alten in der Freiheit ihnen wahrscheinlich nebenbei Kerbtiere zutragen werden. Ihr Gebaren ist ganz das ihrer Eltern; sie bekunden deren Munterkeit, Regsamkeit und Achtsamkeit vom ersten Tage ihres Lebens an, bald auch deren Scheu und Vorsicht, lernen ihren Erzeugern bald die listige Art ab, sich zu verstecken, und sind vom fünften Monat ihres Lebens an nicht mehr von jenen zu unterscheiden. Unmittelbar nach der ersten Brut, noch bevor die Jungen von dieser recht selbständig geworden sind, schreiten die Alten zur zweiten und, wie es scheint, letzten des einen Jahres.
*
Zu den Kurzschwanzpapageien zählt Finsch endlich noch die Zierpapageien ( Loriculus). Sie sind meist noch kleiner als die Zwergpapageien und die Liliputaner innerhalb ihrer Ordnung. Da ich das Glück gehabt habe, einen Zierpapagei länger als zwei Jahre zu pflegen, wähle ich ihn zum Vertreter der Gruppe. Das Blaukrönchen, wie ich das reizende Vögelchen nennen will ( Loriculus galgulus), ist etwa ebensogroß wie unser Feldsperling. Sein Gefieder ist vorherrschend grasgrün, ein runder Fleck auf der Scheitelmitte dunkel ultramarinblau, ein dreieckiger, mit der Spitze nach unten gerichteter Fleck auf dem Rücken orangefarben, ein großer, länglich runder Querfleck auf der Kehle, wie die Bürzel- und oberen Schwanzdeckfedern, brennend scharlachrot, ein schmaler Querstreifen auf dem Unterrücken, über dem roten Bürzel, wie die Säume der unteren Schenkelseitenfedern, hochgelb; die Schwingen sind innen schwarz, unterseits wie die Schwanzfedern ebenda meerblau, ihre unteren Deckfedern grün. Der Augenstern hat dunkelbraune, der Schnabel einfarbig schwarze, die Wachshaut hellgraue, der Fuß graulichgelbe Färbung. Das etwas lichter als das Männchen gefärbte Weibchen zeigt anstatt des blauen einen grünen Scheitel- sowie einen kleineren, bläulichgrünen Oberrückenfleck und entbehrt des roten Kehlfleckes. Beim jungen Vogel ist das Gefieder düsterer, der Scheitelfleck nur angedeutet und weder der Rücken- noch der Kehlfleck vorhanden.
Soviel bis jetzt nachgewiesen werden konnte, lebt das Blaukrönchen ausschließlich auf Borneo, Sumatra, Banka und der Südspitze Malakkas. Über das Freileben gibt nur Solomon Müller, der die lieblichen Vögel im Süden Borneos beobachten konnte, einige Nachrichten. Der tätige und kenntnisreiche Reisende fand unseren Zierpapagei bei den Dajakers als beliebten Käfigvogel, gewöhnlich gesellschaftlich eingebauert in einem runden, drehbaren Käfig aus Bambusrohr, der durch das Klettern des Papageis in Bewegung gesetzt wird. In der Freiheit nährt er sich von Baumknospen, zarten Sprossen und Baumblüten, zumal denen der Erythrinen; in der Gefangenschaft erhält er gekochten Reis und ab und zu rohe Bananen, die er gern verzehren soll. Im übrigen bemerkt Müller nur noch, daß man den kleinen Vogel zwischen dem grünen Laube und den roten Blüten der Erythrinen schwer wahrzunehmen imstande sei. Über das Fortpflanzungsgeschäft ist nichts bekannt.
Zu meiner Freude gelang es mir mehrmals, gefangene Blaukrönchen zu erwerben. Sie und wohl alle Ziersittiche überhaupt müssen als allerliebste Geschöpfe bezeichnet werden, bekunden harmlose Zutunlichkeit, sind regsam, nicht aber stürmisch und schwatzen singend oder singen schwatzend, ohne durch lautes, gellendes Geschrei oder Gekreisch abzustoßen. Alle Bewegungen erfolgen mit ungewöhnlicher Leichtigkeit und Zierlichkeit. Eilfertig, trippelnden, nicht aber watschelnden Ganges, rennen sie über den Boden dahin; ohne Bedenken wagen sie einen Sprung von einer, für die kurzen Beinchen bedenklichen Weite; rasch und gewandt klettern sie, Schnabel und Füße mit derselben Sicherheit gebrauchend, am Gitter empor.
Der Flug, den ich, obschon in beschränktem Maße, im Gesellschaftskäfige beobachten konnte, ist leicht und anscheinend mühelos, so rasch auch die Schwingen bewegt werden. Das polternde Geräusch, das ein auffliegender Zwergpapagei verursacht, habe ich von ihnen nicht vernommen. Um auszuruhen, verweilen sie bloß ausnahmsweise in der üblichen Stellung, nehmen vielmehr regelmäßig, beim Schlafen stets die Lage der rastenden Fledermaus an, indem sie mit den Beinen an der Decke des Käfigs oder einem dürren Sitzzweige sich anklammern und nicht allein den Leib, sondern auch den Kopf gerade herabhängen lassen, so daß der Rücken, der eingezogene Hals, der Scheitel und der Schnabel eine gerade Linie bilden, während der Schwanz, wohl um nicht anzustoßen, schief nach hinten und oben gerichtet und das Gefieder lässig gesträubt wird. Die schmucken Tierchen erhalten in dieser Lage ein gänzlich anderes Aussehen als sonst: sie erscheinen noch einmal so dick als während des Sitzens, förmlich kugelig. Oft hängt sich der eine oder der andere nur an einem Beine auf und zieht das andere so weit ein, daß die geschlossene Klaue eben noch sichtbar ist, wechselt auch wohl ab, um das eine Bein zeitweilig zu entlasten. Erschreckt flüchten sie stets zur Decke empor, gleichsam, als ob sie sich am sichersten fühlten, wenn sie sich aufgehängt haben. In dieser Lage werden auch unbedeutende Geschäfte erledigt, beispielsweise die Federn ein wenig geordnet, ebenso einige Behaglichkeit ausdrückende Laute hergeplaudert, obschon das eine wie das andere regelmäßiger im Sitzen geschieht. Fühlt der Zwergpapagei das Bedürfnis, sich zu entleeren, so wird der Schwanz ein wenig mehr als sonst gestelzt, der Leib etwas gebogen und hierauf der meist in einem umhäuteten Klümpchen bestehende Unratballen gegen dreißig Zentimeter weit weggeschleudert. Im Zustande tieferer Ruhe oder während des Schlafes bläht sich die kleine Gestalt noch mehr auf als sonst und schließen sich die Lider bis auf einen kleinen Spalt. Daß die Zwergpapageien auch alle übrigen Stellungen, die Sittichen möglich sind, und zwar mit spielender Leichtigkeit annehmen, bedarf kaum besonderer Erwähnung; kopfoberst und kopfunterst gilt ihnen vollständig gleich. Die beschriebene Fledermausstellung ist jedoch diejenige, die man am häufigsten sieht, und so bezeichnend, daß ich vorschlagen würde, die Vögel »Hänge- oder Fledermauspapageien« zu nennen, erschiene mir dieser Name ebenso ansprechend wie sie selber.
Die geistigen Anlagen der Ziersittiche dürften mit denen der Zwergpapageien annähernd auf einer und derselben Stufe stehen. Die Blaukrönchen sind harmlos und mit Bewußtsein zutraulich. Sie lernen bald ihren Pfleger und dessen Familienglieder kennen, lassen sich weder durch ihn, noch durch diese im geringsten stören, gestatten, daß man dicht an ihren Käfig tritt, zeigen sich auch dann nicht ängstlich, wenn man letzteren hin und her trägt, gehen meist nicht einmal aus ihrer hängenden Stellung in eine andere über. Sie erkennen fremde Leute recht wohl, vertrauen aber auch ihnen, während sie das Erscheinen eines Hundes in die größte Aufregung versetzt. Doch gebärden sie sich, nach Art kleiner Papageien überhaupt, niemals so ausdrucksvoll wie ihre größeren Ordnungsverwandten, zetern auch nicht, wenn sie erregt werden, wie dies selbst die Zwergpapageien zu tun pflegen. Ihr Betragen ist in jeder Hinsicht ruhig und gemessen; sie leben, sozusagen, still vor sich hin. Beide Gatten des Paares vertragen sich ausgezeichnet gut; keiner aber erweist dem andern ersichtliche Zärtlichkeiten: das gegenseitige Nesteln im Gefieder, das Schnäbeln und anscheinende Küssen anderer Papageien habe ich bei ihnen niemals beobachtet.
Höchst ansprechend ist der Gesang des sonst ziemlich schweigsamen Männchens, Mit dem Schlage eines Finken kann er sich freilich in keiner Weise messen, besteht vielmehr aus schwatzenden, schwirrenden, zwitschernden und einigen pfeifenden Lauten, wird aber mit so viel Behagen vorgetragen und wirkt so anmutend, daß man ihn recht gern hört. An Reichhaltigkeit sowie an Wendungen und Vertonungen steht er dem Gesange des Wellensittichs vielleicht etwas nach, schwerlich aber, für mein Ohr entschieden nicht, in der Gesamtwirkung. Der Sänger pflegt sich während des Vortrages hoch aufzurichten, den Hals soviel als möglich zu strecken und trotzdem die roten Kehlfedern zu sträuben, so daß deren Bewegungen jene der Kehlmuskeln wiedergeben oder doch andeuten. Jeder einzelne Vortrag währt eine bis zwei Minuten; dann tritt eine kurze Pause ein, und das singende Geschwätz beginnt von neuem.
Glanz- oder Kanariensamen, der wohl während der Seereise gereicht worden sein mag, in Stückchen geschnittenes Obst und frische Ameisenpuppen bildeten das Futter der von mir gepflegten Ziersittiche. Hierbei befanden sie sich wohl und überstanden die Mauser, ohne von ihrer Lebhaftigkeit etwas einzubüßen und auch ohne ihr Kleid irgendwie zu verändern.
*
Australien scheint für die Vögel ein wahres Eden zu sein. Die dort lebenden Saugetiere sind verkümmerte Gestalten, die eben nur an die vollkommeneren anderer Erdteile erinnern, die Vögel hingegen, die den gedachten Erdteil ihre Heimat nennen und zum großen Teile in wunderbarer Farbenpracht prangen, ebenso vollkommen gebildet als irgendwo anders. Keine einzige dieser Familien verleiht dem Erdteile ein so bestimmtes Gepräge wie die Papageien. Zwischen dem grünen Laubwerke der Gummibäume schimmern, wunderbaren Blüten vergleichbar, die blendenden Kakadus hervor; von den gelbblühenden Akazien hernieder leuchten mit den lebhaftesten Farben geschmückte Plattschweifsittiche, und um die Blüten der Bäume tummeln sich die honigsaugenden Pinselzüngler in ewig beweglichen Gruppen, während die kleinen Graspapageien die oft trostlosen Ebenen des Innern freudig beleben. Wie bei uns die Schwalben durch die Straßen der Städte und Dörfer huschen, schwirren in Australien Flüge von Papageien über dieselben Wege dahin, und wie unsere Sperlinge auf den Landstraßen sich tummeln, sieht man dort sie gleichsam vertretende Papageivögel in buntem Gewimmel den Boden bedecken. Wenn der einsam wohnende Landwirt seine Ernte eingeheimst, erscheinen Flüge dieser Tiere, die nach Hunderten zählen, vor den Toren der Scheuern, wie bei uns die Tauben, und suchen in dem ausgedroschenen Stroh nach den letzten Körnern umher. Dichterisch fühlende Reisende sind begeistert von dem ewig wechselnden Schauspiel, das die Prachtvögel gewähren; der Ansiedler hingegen haßt sie von Grund seines Herzens, weil sie nur zu oft verwüstend in sein Besitztum einfallen, und schießt sie mit derselben Gleichgültigkeit zusammen, mit der bei uns ein Bauer unter die räuberischen Spatzen feuert.
Unter den mehr als sechzig bestimmten verschiedenen Papageiarten, die Australien bevölkern, nehmen die Kakadus einen hohen Rang ein. Sie bilden eine ziemlich scharf in sich abgeschlossene Gruppe der Papageien und werden deshalb mit Recht in einer besonderen Familie ( Plictolophinae) vereinigt. Ihr am meisten in die Augen fallendes Merkmal ist die aufrichtbare Federhaube, die den Kopf schmückt, und dieses eine Kennzeichen genügt auch, sie von allen übrigen Papageien zu unterscheiden. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von den Philippinen bis Tasmanien und von Timor und Flores bis zu den Salomonsinseln. Innerhalb dieses Kreises beherbergen fast alle Länder und Inseln Kakadus; einzelne Arten verbreiten sich jedoch über weite Landstriche oder über mehrere Eilande, während die Mehrzahl ein auffallend beschränktes Wohngebiet zu haben scheint. Hier leben die meisten Arten in großen, oft ungeheuren Scharen, die sich in Waldungen verschiedenen Gepräges ansässig machen, von hier über die Fluren und Felder dahinstreichen und den Beschauern unter allen Umständen ein zauberhaft erhabenes Schauspiel gewähren.
In ihrem Wesen und Treiben ähneln die Kakadus den übrigen Papageien. Sie gehören aber zu den liebenswürdigsten von allen. Wenn sie in Massen von Tausenden zusammenleben, mag ihr unangenehmes Geschrei allerdings so betäubend werden können, daß sie die Gunst des Menschen verscherzen; wenn man jedoch den einzelnen Vogel kennenlernt, wenn man sich mit ihm befreundet, gewinnt man ihn lieb. Alle Kakadus sind kluge und verständige, die meisten ernste und sanfte Vögel. Ihre geistige Begabung ist außerordentlich entwickelt, ihre Neugier ebensogroß wie ihr Gedächtnis, die Eigenart des einzelnen bemerkenswert. Kaum zwei von ihnen haben genau dasselbe Benehmen. Der Kakadu befreundet sich gern und innig mit den Menschen, zeigt weniger Tücke, als andere Papageien, und erkennt dankbar die ihm gespendete Liebe, die er von jedem in gleicher Weise zu begehren scheint. Erst schlimme Erfahrungen machen ihn unfreundlich und unliebenswürdig. Man mag sich hüten, einen Kakadu von sich abzuwenden; denn sein vortreffliches Gedächtnis bewahrt die empfangenen Eindrücke treulich jahrelang auf. Er vergißt empfangene Beleidigungen schwer oder nicht, und das einmal erwachte Mißtrauen kann kaum wieder besänftigt werden; ja, es geschieht nicht selten, daß der beleidigte Vogel sich sogar rachsüchtig zeigt und später den, der ihm eine Unbill zufügte, gefährdet. Dieser Charakterzug ist vielleicht der einzig unangenehme, den der Kakadu bekundet; im allgemeinen ist mildes Wesen bei ihm vorherrschend. Er will lieben und geliebt sein und bekundet dies seinem Pfleger bald auf alle erdenkliche Weise. Hat er sich einmal mit dem Lose seiner Gefangenschaft ausgesöhnt und an einen Menschen angeschlossen, so läßt er sich gern von diesem und bald von allen andern streicheln, neigt willig seinen Kopf, sobald man Miene macht, ihn zu liebkosen, lüftet sein Gefieder förmlich der Hand entgegen. Es mag sein, daß ihm ein behagliches Gefühl erwächst, wenn man mit den Fingern in seinem Gefieder nestelt und auf der zwischen den dünn stehenden Federn leicht erreichbaren nackten Haut reibt und kraut; jene Willigkeit gewinnt jedoch stets den Anschein vergessener Hingebung und muß deshalb bestechen.
»Wohl keine Sippe der Sittiche insgemein«, bemerkt Linden, »verdient den Namen ›gefiederte Affen‹ mehr als die Kakadus. Dies zeigt sich insbesondere auch in der Luft, alles nachzuahmen. Was in einem Nachbarkäfig geschieht, erregt ihre Aufmerksamkeit, und wenn sie es vermögen, tun sie es nach, ungewöhnliche Bewegungen und Gebärden oder Stimmlaute ebensowohl wie uns angenehme oder unangenehme Handlungen. Einer meiner Gelbwangenkakadus läuft in gewissem, gleichmäßigem Takte auf seiner Sitzstange hin und her, tanzt, turnt und treibt allerlei Künste. Alles dies wird von den andern nachgeahmt, zuerst vielleicht stümperhaft, später besser, zuletzt so ausgezeichnet, daß der ursprüngliche Lehrmeister sich übertroffen sehen muß. Wie erheiternd dieses Gebaren auf den Beschauer wirkt, läßt sich nicht schildern. Es liegt in der Nachahmung ein gewisser Mutwille und zugleich Eifer, etwas ebensogut oder noch besser auszuführen. Wird von einem ein Futtergeschirr losgebrochen und als Spielball im Käfig umhergeworfen, so ruht der Nachbar nicht, bis auch er dasselbe getan hat. Er bekundet dabei eine Kraft und Beweglichkeit des Schnabels ohnegleichen; denn dieses eine Werkzeug wird als Hammer, Zange, Schraubenzieher benutzt und leistet Erstaunliches. Mit aller List habe ich Futtergeschirre befestigt, sie mit Draht um die Eisenstäbe gewunden, von außen mit Mutterschrauben fest angezogen usw.; aber meine Kakadus wissen den Schraubenwindungen ganz gut entgegenzuarbeiten und bringen früher oder später alles los. Meine Käfige bestanden vormals aus Drahtgeflecht; allein es war immer nur eine Frage der Zeit, bis wieder ein enggeflochtener Teil losgetrennt und dann die Öffnung rasch genug erweitert wurde, um das Durchschlüpfen behufs Verübung von allerlei Unfug zu ermöglichen.« Die Lust zum Zerstören ist, wie ich hinzufügen will, bei Kakadus besonders ausgeprägt, und die Leistungen der Vögel übertreffen in der Tat alle Vorstellungen. Sie zernagen, wie ich aus eigener Erfahrung verbürgen kann, nicht allein Bretter von fünf bis sechs Zentimeter Dicke, sondern sogar Eisenblech von einem Millimeter Stärke; sie zerbrechen Glas und versuchen selbst das Mauerwerk zu durchhöhlen. Von gewöhnlichen Vogelketten, die sie an einen Ständer befestigen sollen, befreien sie sich mit Leichtigkeit. Die sinnreichsten Vorkehrungen, um sie an der Flucht zu verhindern, schützen wohl manchmal, aber keineswegs immer. Fiedler schreibt mir, daß sie selbst eine doppelt, also gegeneinander wirkende Schraube aufzudrehen verstehen. Dies alles trägt dazu bei, uns einen hohen Begriff von ihrem Verstande zu geben.
Die natürliche Stimme der Kakadus ist ein abscheuliches, unbeschreibliches Kreischen. Die Laute »Kakadu«, die die meisten in bestechend zarter Weise aussprechen und mit denen sie auch regelmäßig ihre freundschaftlichen Gesinnungen oder ihre Hingebung an den Pfleger ausdrücken wollen, sind nichts anderes als ihnen angelernte Worte. Letzteres hat Bernstein, der Kakadus vielfach in der Freiheit beobachten konnte, mitgeteilt und Finsch wiederholt. Um mir Gewißheit hierüber zu verschaffen, wandte ich mich an den Tierhändler Hagenbeck und erfuhr von ihm, wie ich ebenfalls schon in meinen »Gefangenen Vögeln« erwähnt habe, das Nachstehende: »Am regelmäßigsten habe ich das Wort ›Kakadu‹ von den aus Indien stammenden Arten gehört; aber die australischen sagen es ebenfalls. Ja, ich glaube mit Bestimmtheit behaupten zu können, daß man es von allen Arten überhaupt vernehmen kann. Jedoch waren es immer zahme Vögel, die ihren Namen sprachen. Von wilden, die man bekanntlich sehr leicht als alt gefangene oder doch vernachlässigte erkennt, hörte ich die Worte nie, und zwar ebensowenig von indischen wie von australischen Arten. Vor kurzem erhielt ich vierzehn Gelbwangenkakadus, von denen nicht ein einziger ›Kakadu‹ sagte. Endlich muß ich bemerken, daß die australischen Arten das Wort ›Kakadu‹ englisch aussprechen und ebensooft › pretty cokey‹ sagen, was doch unbedingt beweist, daß sie wenigstens die betreffenden Worte erst in der Gefangenschaft gelernt haben.« Vollste Aufklärung hierüber gibt mir von Rosenberg. »Ich muß bemerken«, schreibt er mir, »daß das Wort ›Kakatua‹ von wildlebenden Vögeln niemals vernommen wird und auch nicht vernommen werden kann, weil es erst den jung gefangenen angelernt wird. Es ist malaiischen Ursprungs und bedeutet ›Alter Vater‹ (Kaka = Vater, tua = alt). Diejenigen Vögel also, die es aussprechen, stammen entweder aus malaiischen Ländern oder sind jung in die Hände von Malaien gelangt.« Durch diese Bemerkung Rosenbergs wird mir auch die zarte Betonung der betreffenden Worte verständlich; es mögen, nein, es müssen Frauen und Kinder sein, die das Lehramt bei den frischgefangenen Vögeln übernehmen.
Wie andere Papageien leben auch die Kakadus im Freien in Gesellschaften, die selbst während der Brutzeit noch in einem gewissen Verein bleiben. Die Nacht verbringen sie wohlverborgen in den dichtesten Kronen der höchsten Bäume; den Morgen begrüßen sie mit weithin tönendem Geschrei. Dann erheben sie sich und fliegen mit leichten Schwingenschlägen, viel schwebend und gleitend, dahin, irgendeinem Fruchtfelde oder einem andern nahrungversprechenden Orte zu. Sie beuten ihr Gebiet nach Möglichkeit aus. Früchte, Körner und Sämereien bilden wohl ihre Hauptnahrung; nebenbei fressen sie aber auch kleine Knollen und Zwiebeln, die sie mit dem langen Oberschnabel sehr geschickt aus dem Boden graben, oder sie nehmen Pilze auf und verschlingen außerdem, wie die Hühner tun, kleine oder mittelgroße Quarzstücke, jedenfalls aus demselben Grunde wie andere Körnerfresser, um die Nahrung zu zerkleinern. Der Kropf und Magen der getöteten enthält stets die verschiedensten Nahrungsstoffe durcheinander. Auf frischgesäeten Feldern und im reifenden Mais können sie höchst empfindlichen Schaden anrichten. Sie sind mit Ausnahme der Mittagsstunden während des ganzen Tages in Tätigkeit und achtsam auf alles, was vorgeht. Jedes neue Ereignis wird mit Geschrei begrüßt; namentlich wenn ein Flug sich niedergelassen hat und ein anderer vorüberkommt, erhebt sich ohrenzerreißender Lärm, dessen Mißtöne man sich einigermaßen vorstellen kann, wenn man das Geschrei einiger wenigen Gefangenen durch eigene Erfahrung kennengelernt hat. Sobald ein Flug sich gesättigt hat, kehrt er wieder nach dem Ruheort im Walde zurück und verweilt nun eine Zeitlang wenigstens verhältnismäßig ruhig, um zu verdauen. Dann geht es zum zweiten Male nach Nahrung aus, und mit einbrechender Nacht versammelt sich die Masse wiederum auf dem gewohnten Schlafplatze.
So ungefähr leben die Scharen bis zur Brutzeit. Nunmehr trennen sie sich in Paare, und jedes derselben sucht nun eine passende Höhlung zur Aufnahme des Nestes aus. Dieses findet sich je nach den Umständen in Baumhöhlen aller Art, namentlich in hohlen Ästen, aber auch in den Spalten der Felsen. Steile Felswände an den Flüssen Südaustraliens werden alljährlich von Tausenden unserer Vögel besucht, in gleicher Weise wie die Klippen der nordischen Meere von den in noch größeren Mengen auftretenden Möwen. Man behauptet, daß einzelne dieser Wände von den Papageien ganz durchlöchert seien, und die Kraft und Festigkeit des Schnabels läßt Arbeiten im Gestein in der Tat glaublich erscheinen. Das Gelege besteht immer nur aus zwei, höchstens drei reinweißen, etwas spitzigen Eiern, die denen einer Zwerghenne ungefähr an Größe ähneln, aber durch ihren Glanz sich hinlänglich unterscheiden.
Freundschaften zwischen zwei verschiedenartigen Kakadus sind etwas durchaus Gewöhnliches, und wenn die Freunde beiden Geschlechtern angehören, bildet sich zwischen ihnen regelmäßig ein Liebesverhältnis heraus, das früher oder später zu einem innigen Ehebunde wird. Beide Genossen oder Gatten pflegen dann ebenso unzertrennlich nebeneinander zu sitzen wie die Zwergpapageien und sich mit Zärtlichkeiten aller Art zu überhäufen. In Lindens Vogelhaus hat sich ein riesiger Gelbwangenkakadu einem kleinen Ducorpkakadu zugesellt und erweist der erwählten Genossin eheliche Liebkosungen. »Schon wiederholt«, schreibt mir Linden, »habe ich die Paarung beobachtet. Die Zärtlichkeit, die derselben vorangeht und nachfolgt, ist auffallend. Beide umhalsen sich gegenseitig, umschlingen sich förmlich mit den Flügeln und küssen sich wie zwei Verliebte. Zum Eierlegen haben sie es jedoch noch nicht gebracht, und alle Nistkästen, die ich ihnen gab, verfielen binnen wenigen Stunden ihrem unermüdlichen Schnabel.«

Molukkenkakadu ( Cacatua moluccensis)
Des Schadens wegen, den die oft in so großer Menge auftretenden Kakadus den Landwirten zufügen, werden sie in ihrer Heimat eifrig verfolgt und zu Hunderten erlegt. Erfahrene Reisende erzählen, daß sie, wenn sie feindliche Nachstellungen erfahren, sich bald ungemein vorsichtig zeigen, wie andere Papageien auch oder wie die Affen, mit wirklicher List ihre Raubzüge ausführen und deshalb schwer von den Feldern zu vertreiben sind. In eigentümlicher Weise betreiben die Eingeborenen die Jagd auf diese Vögel. »Vielleicht«, erzählt Kapitän Grey, »kann es kein fesselnderes Schauspiel geben als die Jagd der Neuholländer auf Kakadus. Sie benutzen hierzu die eigentümliche, unter dem Namen ›Bumerang‹ bekannte Waffe, ein sichelartig geformtes, plattes Gerät aus hartem Holz, das mit der Hand mehr als dreißig Meter weit geschleudert wird, die Luft in kurzen Kreisen durchschneidet und trotz der vielfachen Abweichungen von dem geraden Wege mit ziemlicher Sicherheit das Ziel trifft, dieselbe gefährliche Waffe, die auch von den Innerafrikanern in Holz und Eisen hergestellt wird. Ein Eingeborener verfolgt einen starken Flug unserer Vögel im Felde oder im Walde, am liebsten da, wo hohe, prachtvolle Bäume ein Wasserbecken umgeben. Solche Orte sind es hauptsächlich, die die Kakadus aussuchen, und hier sieht man sie oft in unzählbaren Scharen versammelt, kletternd im Gezweige oder fliegend von Baum zu Baum. Hier pflegen sie auch ihre Nachtruhe zu halten. Der Eingeborene schleicht mit Beobachtung aller Vorsichtsmaßregeln zu solchen Lachen herbei, drückt sich von einem Baum zum andern, kriecht von Busch zu Busch und gibt sich die größte Mühe, die wachsamen Vögel so wenig als möglich zu beunruhigen. Aber so lautlos sein federnder Gang auch ist, die Kakadus nehmen ihn doch wahr, und ein allgemeiner Aufruhr bekundet das Nahen des gefährlichen Feindes. Die Vögel wissen, daß Gefahr im Anzuge ist; sie sind nur noch ungewiß über sie. So kommt der Verfolger zuletzt bis an das Wasser heran und zeigt unverhüllt seine dunkle Gestalt. Mit ohrenzerreißendem Schreien erhebt sich die weiße Wolke in die Luft, und in demselben Augenblick schleudert der Neuholländer seine Waffe unter sie. Der Bumerang tanzt in den wunderbarsten Sprüngen und Drehungen über das Wasser hin, erhebt sich aber im Bogen mehr und mehr und gelangt bald genug mitten unter die Vögel. Eine zweite, dritte, vierte gleichartige Waffe wird nachgesandt. Vergeblich versuchen die geängsteten Tiere zu entrinnen; der scheinbar regellose Flug des Geschosses macht sie verwirrt und lähmt ihre Flucht. Einer und der andere kommt mit dem Bumerang in Berührung und wird zu Boden geworfen, sei es, indem die sausende Waffe ihm den Hals abschlägt oder einen Flügel zertrümmert. Schreiend vor Schmerz und Grimm stürzt einer der fliegenden zu Boden, und erst wenn der dunkle Jäger seinen Zweck erfüllt hat, besinnt sich die Masse und fliegt schreckerfüllt davon oder sucht in den dichtesten Baumkronen Zuflucht.«

Inkakakadu ( Cacatua leadbeateri)
Bei geeigneter Pflege hält der Kakadu auch in Europa viele Jahre lang aus; man kennt Beispiele, daß einer länger als siebzig Jahre im Bauer lebte. Seine Haltung erfordert wenig Mühe; denn er gewöhnt sich nach und nach an alles, was der Mensch ißt. Doch tut man wohl, ihm nur die einfachsten Nahrungsstoffe zu reichen: Körner mancherlei Art, gekochten Reis und etwas Zwieback etwa, weil er bei zu reichlichem Futter leicht allzu fett wird oder auch mancherlei Unarten annimmt, die dann schwer auszurotten sind. Wer sich ihn zum Freunde gewinnen will, muß sich viel und eingehend mit ihm beschäftigen, ihm liebevoll entgegentreten und ihm manche Unart verzeihen. Unter guter Pflege wird früher oder später jeder Kakadu zahm und lohnt dann durch die treueste Anhänglichkeit die auf ihn verwendete Mühe. Doch darf man sich nicht verleiten lassen zu glauben, daß er, unter so glücklichen Verhältnissen er auch leben möge, jemals vergessen könnte, wozu ihm die Schwingen gewachsen sind.
*
Vorstehende Schilderung bezieht sich im wesentlichen auf die Kakadus im engeren Sinne des Wortes ( Cacatua), große oder mittelgroße, also ungefähr zwischen Krähen- und Dohlengröße schwankende, sehr gedrungen gebaute Papageien. Ihr Gefieder, das einen mehr oder minder breiten Kreis um das Auge freiläßt, ist aus breiten, am Ende abgerundeten, seidenartig weichen Federn zusammengesetzt und durch die aus den verlängerten Stirn- und Oberkopffedern gebildete, sehr verschiedenartig gebaute Haube ausgezeichnet. Seine vorherrschende Färbung ist weiß, die der Haube dagegen bunt.
Der Molukkenkakadu ( Cacatua moluccensis), »Golabi-Kakatua« der Hindus, dürfte als würdigster Vertreter der Sippe allen übrigen obenangestellt werden. Er ist neben einem australischen Verwandten die größte Art und trägt ein weißes, blaß rosenrot überhauchtes Kleid von hoher Schönheit, dem die siebzehn Zentimeter langen, mennigroten, durch weiße gedeckten Federn der Haube zu hohem Schmuck gereichen. Die Wurzelhälfte der Schwingen und des Schwanzes sind unterseits gelblich, der Augenstern ist tiefbraun, der kleine Augenkreis graublau oder bläulichweiß, der Schnabel wie der Fuß schwarz, grau überpudert, bei freilebenden pflaumenblau angehaucht. Im Freileben nimmt, laut brieflicher Mitteilung von Rosenbergs, das zarte Rosenrot des Gefieders mit dem Alter so an Tiefe zu, wie man es an gefangenen Vögeln niemals sieht.
Über das Freileben des Molukkenkakadu danke ich der Freundlichkeit von Rosenbergs eingehende Mitteilungen, die meinen Lesern um so willkommener sein dürften, als wir bisher in dieser Beziehung noch nicht das geringste wußten. »Der Molukkenkakadu«, so schreibt mir der erfahrene Reisende, »bewohnt so gut als ausschließlich die Insel Ceram. Nur sehr selten fliegt er einmal auf die zwei ganze Minuten südlicher gelegene Insel Amboina hinüber; ich meinesteils habe ihn hier bloß ein einziges Mal beobachtet und auch erlegt. Auf Amboina und bei den Strandbewohnern Cerams führt er den Namen ›Katalla‹. In seiner Heimat gehört er zu den gewöhnlichen Erscheinungen. Hauptsächlich ist er es, der sowohl an der Küste wie im Innern, in der Ebene wie im Gebirge den stillen Wald der im allgemeinen an Vögeln nicht reichen Insel belebt. Einen prächtigen Anblick gewährt es, ihn, unstreitig den schönsten seiner Gattung, in seinem Tun und Treiben zu beobachten. Sein Flug ist geräuschvoll, kräftig, führt in gerader Richtung dahin, wird auch zuweilen, namentlich wenn man den Vogel aufgescheucht hatte, mit lautem Geschrei begleitet. Man sieht unsern Kakadu auf dem Boden wie auch in den höchsten Baumkronen, und zwar stets beschäftigt, ebenso auch beständig auf seine Sicherheit bedacht. In einsamen Gebirgswäldern ist er allerdings leicht zu beschleichen, in bewohnten Gegenden aber, zumal da, wo er vielfache Nachstellungen erfahren mußte, außerordentlich scheu. Gewöhnlich sieht man ihn paarweise, nach der Brutzeit jedoch ebenso in Flügen, und zu solchen schart er sich stets, wenn es gilt, ein Fruchtfeld zu plündern. Nach Aussage der Eingeborenen hält das Männchen Zeit seines Lebens treu zum erwählten Weibchen. Getreide, Körner und verschiedene Baumfrüchte bilden die Nahrung.
Gegen Ende der trockenen Jahreszeit sucht sich das Weibchen eine passende Baumhöhlung, arbeitet dieselbe mehr oder weniger sorgfältig aus und legt auf den zu Boden herabgefallenen Spänen und Mulmstücken drei bis vier glänzend weiße Eier von etwas mehr als vier Zentimeter Länge, die binnen fünfundzwanzig Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen legen schon im Nest das Kleid ihrer Eltern an. Von den eingeborenen Alfuren, die gute Baumsteiger sind, werden die Jungen häufig ausgehoben, gezähmt und dann verkauft.«
Unter den australischen Arten tritt der Inkakakadu ( Cacatua leadbeateri), »Jakkul« der Eingeborenen Australiens, durch seine Schönheit besonders hervor. Sein weißes Gefieder ist am Vorderkopfe, an der Stirn und den Halsseiten, auf der Mitte und Unterseite der Flügel, der Bauchmitte und auf dem Wurzelteile der Innenfahne der Schwanzfedern rosa-, und unter den Flügeln schön lachsrot. Prächtig ist die Haube. Die einzelnen Federn sind hochrot an der Wurzel, gelb gefleckt in der Mitte und weiß zugespitzt am Ende. Bei niedergelegter Haube sieht man nur die weißen Spitzen; sowie aber der Vogel seinen Schopf aufrichtet, tritt das brennende Rot leuchtend hervor, und die gelben Mittelflecke vereinigen sich dann zu einem Bande, durch das die Haube nur noch schöner wird. Das Weibchen unterscheidet sich durch weniger lebhafte Färbung der Unterseite und kleinere gelbe Flecke in den Federn der Haube. In der Größe steht der Inkakakadu hinter dem Molukkenkakadu zurück, ist namentlich schlanker gebaut.
Nach Gould ist dieser Prachtvogel weit über den Südwesten Australiens verbreitet, hält sich aber vorzugsweise an die hohen Gummibäume und an das Buschholz, das im Innern des Landes die Ufer der Flüsse bekleidet, und läßt sich niemals in der Nähe des Strandes sehen. Zur Brutzeit erscheint er alljährlich an bestimmten Plätzen, und zwar in großer Menge. Die eintönigen Wälder des Innern belebt er in der angenehmsten Weise. Seine Stimme ist mehr klagend als die seiner Verwandten und hat nicht den rauhen Ausdruck derselben. Die Pracht des Vogels, sowie die Liebenswürdigkeit seines Wesens, reißt jeden, der ihn sieht, zum Entzücken hin. Die Gefangenschaft verträgt er ebenso gut wie irgendein anderer seiner Familie.
*
Als die nächsten Verwandten der geschilderten Art dürfen wir wohl die Langschwanzkakadus ( Calyptorrhynchus) betrachten, meist sehr große Arten von Raben- bis Dohlengröße herab, die, ihrer langen Flugwerkzeuge halber, noch größer aussehen, als sie tatsächlich sind. Im Gegensatz zu den Kakadus, denen sie sonst sehr ähneln, ist die vorherrschende Färbung des ausgebildeten Kleides ein stahlglänzendes Schwarz, das meist durch eine rote oder gelbe Schwanzbinde oder einen lebhaft gelben Ohrfleck gehoben wird.
Als Verbindungsglied der Kakadus und Rabenkakadus darf der Helmkakadu ( Calyptorrhynchus galeatus) bezeichnet werden. Der Vogel, der einem mittelgroßen Kakadu ungefähr gleichkommt, ist dunkel schieferschwarz, licht quer gewellt, weil jede Feder am Ende einen schmalen, hell graulichweißen Saum trägt; Kopf, Nacken, Backen und Haube prangen in prachtvollem Scharlachrot; die Armschwingen zeigen außen düster erzgrüne Säume, die Unterdeckfedern und die Unterseite der Schwingen und des Schwanzes sind grauschwarz. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel hornweiß, der Fuß schwärzlich. Gould berichtet, daß er in den Waldungen an der Südküste Australiens und aus einigen benachbarten Inseln sowie in den nördlichen Teilen von Vandiemensland vorkomme, woselbst er die höchsten Bäume bewohne und die Samen verschiedener Gummibäume genieße; Peron fand ihn auf der Kingsinsel, und das Museum zu Sidney besitzt ihn von dem Moretonbusen. Haltung und Bewegung, Sitten und Gewohnheiten sind die anderer Kakadus; ich wenigstens habe niemals besondere Unterschiede finden können.
Genauer als über den Helmkakadu sind wir über andere Mitglieder seiner Sippe unterrichtet. Als eigentlicher Vertreter derselben darf der Rabenkakadu oder »Gering-Gora« der Eingeborenen Australiens ( Calyptorrhynchus banksi) angesehen werden. Er übertrifft alle bisher genannten Kakadus an Größe; seine Gesamtlänge beträgt ungefähr siebzig, die Fittichlänge zweiundvierzig, die Schwanzlänge dreißig Zentimeter. Das Gefieder, mit alleiniger Ausnahme der Schwanzfedern, ist beim Männchen glänzend schwarz, grünlich schimmernd, beim Weibchen grünlich schwarz, am Kopf, an den Halsseiten und auf den Flügeldecken gelb gefleckt, auf der Unterseite blaßgelb gebändert. Ein breites scharlachrotes Band zieht sich bei dem Männchen mitten über den Schwanz, läßt jedoch die beiden mittelsten Schwanzfedern und die Außenfahne der beiden seitlichen Federn frei. Bei dem Weibchen verlaufen breite gelbe, rotgelb gesprenkelte Bänder in derselben Weise, und auch die unteren Schwanzdeckfedern sind derartig gezeichnet. Die Rabenkakadus sind ausschließlich in Neuholland zu Hause, hier aber auf verschiedene Strecken des Erdteils verteilt.

Ararakakadu oder Rasmalos ( Microglossus aterrimus)
Die Rabenkakadus sind echte Baumvögel, die sich hauptsächlich von dem Samen der Gummi- und anderer Bäume ihres Vaterlandes nähren, gelegentlich aber auch, abweichend von andern Papageien, fette Maden verzehren. Im Gegensatz zu den übrigen Kakadus halten sie sich nur in kleinen Gesellschaften von vier bis acht Stück zusammen, die nur zuweilen, namentlich wenn sie wandern oder streichen, Flüge bilden. Jeder Teil des Erdteiles, von der Nordküste an bis Vandiemensland, besitzt seine eigene Art. Der Flug unseres Vogels ist schwerfällig; die Flügel werden schlaff und mit Beschwerde bewegt. Er steigt selten hoch in die Luft, fliegt jedoch demungeachtet zuweilen meilenweit in einem Zug. Dabei stößt er oft seine Stimme aus, die von der rauhen anderer Kakadus verschieden, d. h. wenig kreischend ist. Andere Arten haben sich durch ihren Ruf die Namen erworben, die ihnen die Australier gegeben haben. Einige lassen im Fluge ein eigentümlich weinerliches Geschrei hören, andere schreien, wenn sie sitzen und fressen, wie unsere Raben. Auf dem Boden bewegen sie sich ziemlich schwerfällig, wie andere Papageien auch, in den Kronen der Bäume dagegen geschickt, obwohl immer langsam.
Eigentümlich ist die Art und Weise, wie sich die Rabenkakadus ernähren. Einige Arten haben die Gewohnheit, beim Fressen die kleinen Zweige der dortigen Fruchtbäume abzuschneiden, anscheinend aus Mutwillen, und alle benutzen ihren starken Schnabel, um versteckt lebende Kerbtiere, namentlich Larven, aus dem Holz herauszuarbeiten. Die großen Raupen, die sie von den Gummibäumen auflesen, genügen ihnen nicht immer; sie befehden auch, wahrscheinlich durch den Geruch geleitet, die tief im Holz arbeitenden Maden, schälen geschickt die Rinde der Äste ab und nagen erstaunlich große Höhlungen in die Zweige, bis sie auf die gesuchte Beute gelangen. Einige Arten scheinen Kerbtiernahrung jeder andern Speise vorzuziehen, die andern halten sich mehr an Sämereien und namentlich an die Samen der Casuarinen und Banksien. Früchte scheinen sie zu verschmähen; sie üben aber ihren Übermut auch an diesen, indem sie sie abbeißen, noch bevor sie reif sind, zum großen Ärger und Schaden der Einwohner.
Soviel man bis jetzt weiß, brüten die Rabenkakadus ausschließlich in Baumhöhlen. Sie erwählen dazu immer die höchsten und unzugänglichsten Bäume, regelmäßig solche, an denen selbst die Eingeborenen nicht emporklettern können. In der Höhlung bereiten sie sich kein eigentliches Nest, sondern sammeln höchstens die behufs der Ausglättung abgebissenen Späne am Boden an. Die zwei bis fünf weißen Eier, die sie legen, sind ziemlich groß, 4,5 Zentimeter lang und 4 Zentimeter dick. Über Brutgeschäft und Erziehung fehlen Berichte.
Außer dem Menschen sollen Raubbeuteltiere und große Raubvögel den Rabenkakadus mit Erfolg nachstellen. Ihr Fleisch wird von den weißen Bewohnern Neuhollands nicht, von den Eingeborenen dagegen, wie alles Genießbare, das das arme Land bietet, sehr hoch geschätzt. Gefangene Rabenkakadus sind seltene Erscheinungen unseres Tiermarktes; sie dauern auch im Käfige meist nur kurze Zeit aus. Der Eindruck, den sie auf den Beobachter machen, ist kein günstiger. Sie sind viel ruhiger und offenbar in jeder Beziehung minder begabt als ihre lichtfarbenen Verwandten.
*
Auf Neuguinea und den benachbarten Inseln, namentlich auf den Aruinseln, auch in Nordaustralien, lebt ein Papagei, den man ebenfalls zu den Kakadus rechnet: der Ararakakadu ( Microglossus aterrimus). Der Vogel zählt zu den größten aller Papageien, und sein Schnabel ist der gewaltigste, der einen von ihnen bewehrt. Dieser riesige Schnabel ist länger als der Kopf, viel länger als hoch, stark seitlich zusammengedrückt, der Oberschnabel im Halbkreis herabgebogen und in eine lange, dünne, nach innen gekrümmte Spitze ausgezogen, vor derselben mit einem rechtwinkeligen Vorsprung versehen, an die die Spitze des von jenem nicht umschlossenen, durch seine breiten Laden und die rechtwinkelig von diesen abgesetzte Dille ausgezeichneten Unterschnabels stößt. Die Familienangehörigkeit des Vogels begründet sich hauptsächlich auf den kurzen, viereckigen Schwanz und die Federholle auf dem Kopf, die übrigens ganz anders gebildet ist als bei den wahren Kakadus. Ihm eigentümlich ist die ziemlich lange, fleischige, walzige, oben ausgehöhlte und an der vorderen Spitze abgeflachte, tiefrote, am Ende hornige und wie mit einem schwarzen Panzer gedeckte Zunge, die ziemlich weit aus dem Schnabel vorgeschoben und wie ein Löffel gebraucht werden kann, indem der Vogel mit ihr die von dem Schnabel zerkleinerten Nahrungsmittel aufnimmt und der Speiseröhre zuführt. Die Zungenränder sind sehr beweglich und können vorn von rechts und links her gegeneinander gewölbt werden, so daß sie den ergriffenen Speisebissen wie in einer Röhre einschließen, in der er leicht zum Schlund hinabgleitet.
Der Rasmalos, wie der Ararakakadu auf Neuguinea genannt wird, übertrifft die meisten Araras an Stärke. Sein Gefieder ist gleichmäßig tiefschwarz gefärbt und schillert etwas ins Grünliche, bei dem lebenden Vogel aber vorherrschend ins Grauliche, weil mehliger Staub auf den Federn liegt. Die nackten, faltigen Wangen sind rot gefärbt. Die Holle besteht aus langen und schmalen Federn, deren Färbung mehr ins Grauliche spielt als das übrige Gefieder.
Über das Freileben des Vogels ist wenig bekannt. Mac Gillivray fand ihn in der Nähe des Vorgebirges York ziemlich häufig, in der Regel paarweise. Er lebte hier auf den höchsten Gummibäumen, ließ ein gellendes Geschrei wie »wit wit« vernehmen, war sehr scheu und ernährte sich vorzugsweise von Palmnüssen, die neben Quarzstücken den Magen der getöteten füllten. Wallace beobachtete und sammelte ihn auf den Aruinseln. »Er bewohnt hier die niedrigen Stellen des Waldes und wird einzeln, aber meist zu zweien oder dreien gesehen, fliegt langsam und geräuschlos und verzehrt verschiedene Früchte und Samen, besonders aber den Kern der Kanarinuß, die an hohen, in Fülle vorhandenen Waldbäumen auf allen von ihm bewohnten Inseln in Menge wächst. Die Art, wie er diesen Samen frißt, deutet auf eine Wechselbeziehung zwischen Schnabelbildung und Gewohnheit, die die Kanarinuß als seine besondere Nahrung erscheinen läßt. Die Schale dieser ziemlich dreieckigen, außen ganz glatten Nuß ist so außerordentlich hart, daß nur ein schwerer Hammer sie aufbrechen kann. Der Ararakakadu nimmt ein Ende in seinen Schnabel, hält es mit seiner Zunge fest und schneidet durch seitliche sägende Bewegungen der scharfrandigen unteren Kinnlade ein queres Loch hinein. Daraus faßt er die Nuß mit dem Fuß, beißt ein Stück davon ab und hält es in der tiefen Kerfe des Oberkiefers fest, ergreift sodann die Nuß, die jetzt durch das fasernde Gewebe des Blattes am Hinausgleiten gehindert ist, wieder, setzt den Rand des Unterkiefers in dem Loch ein und bricht mit einem mächtigen Ruck ein Stück der Schale aus. Nunmehr nimmt er die Nuß wieder in seine Krallen, sticht die sehr lange und scharfe Spitze des Schnabels in das Innere und bohrt den Kern heraus, den er Stück für Stück verspeist. So scheint jede Einzelheit in Form und Bau des außerordentlichen Schnabels seinen Nutzen zu haben, und wir können leicht einsehen, daß die Ararakakadus im Wettkampf mit ihren tätigen und zahlreicheren weißen Verwandten sich erhalten haben durch ihre Fähigkeit, eine Nahrung zu verwenden, die kein anderer Vogel aus seiner steinigen Schale herauszulösen vermag. Anstatt des rauhen Gekreisches der weißen Kakadus läßt er ein klagendes Pfeifen vernehmen.« Als besonders ausfallend hebt Wallace noch die Hinfälligkeit des gewaltigen Vogels hervor, der einer verhältnismäßig leichten Wunde erliegt.
Auf Amboina wird der Rasmalos nach Rosenbergs Angabe oft gesehen. In Europa gehört er zu den größten Seltenheiten der Sammlungen. Von dem Rasmalos, der früher im Tiergarten zu Amsterdam lebte, schrieb mir Westerman Nachstehendes: »Wir besitzen unsern Rasmalos seit dem achtundzwanzigsten Mai 1860. Es ist uns nur mit großer Mühe geglückt, ihn an ein geeignetes Futter zu gewöhnen. Jetzt frißt er Hanf und alles, was ich esse, Fleisch ausgenommen. Bei dieser Nahrung befindet er sich gesund und wohl. Abweichend von allen andern mir bekannten Papageien, gebraucht der Rasmalos seine eigentümlich gestaltete Zunge in absonderlicher Weise. Er nimmt das Futter mit dem Fuß an, bringt es an den Schnabel, zerstückelt es und drückt nur die Spitze seiner Zunge, die mit einem runden, hornartigen Blättchen versehen ist, auf den abgetrennten Bissen, der auf dem Blättchen kleben bleibt. Nun wird die Zunge zurückgezogen und der Bissen verschluckt. Das geht langsam vor sich, und daraus folgt, daß die Mahlzeit sehr lange währt.«
*
Zu den von dem Gesamtgepräge der Familie am meisten abweichenden Arten zählt der Keilschwanzkakadu, die »Corella« oder der »Kakadupapagei« der Ansiedler Neuhollands ( Callipsittacus novae-hollandiae), Vertreter einer besonderen wohl begründeten Sippe, deren Kennzeichen die folgenden sind. Der Schnabel ist schwächer als jener der Kakadus, diesem jedoch ganz ähnlich. Die Corella kommt einer unserer größten Drosseln ungefähr gleich, erscheint aber des langen Schwanzes halber größer. Das Gefieder ist sehr bunt und ansprechend gezeichnet, die Hauptfärbung ein dunkles Olivengraubraun, das unterseits in Grau übergeht; Oberkopf, Zügel und Backen sind blaß strohgelb, die Haubenfedern ebenso, an der Spitze aber grau; ein runder Fleck in der Ohrgegend ist safranrot, nach hinten weißlich gerandet. Der Augenring ist tiefbraun, der nackte Augenkreis grau, der Schnabel grauschwärzlich, an der Wurzel bräunlich, die Wachshaut grau, der Fuß graubraun. Das Weibchen unterscheidet sich von dem Männchen durch die hellere Oberseite, die blaßrötlich graubraune Unterseite und den blaß strohgelben Ohrfleck. Der junge Vogel ähnelt dem Weibchen.
Gould, dem wir die erste Lebensbeschreibung der Corella verdanken, fand den schönen Vogel in namhafter Menge im Innern Australiens. Im Osten Australiens scheint er häufiger zu sein als im Westen; im Sommer brütet er allerorten in den Ebenen des oberen Hunter oder am Peel und anderen nördlich strömenden Flüssen, wo sich die geeigneten Bäume finden. Die Corellas verzehren Grassämereien, wie die meisten Verwandten, können aber das Wasser nicht entbehren und müssen sich deshalb immer in der Nähe der Ströme aufhalten; daher nisten sie auch nur in den Waldungen längs der Flußufer. Sie sind sehr beweglich, laufen geschickt auf dem Boden umher, klettern gut und fliegen zwar gemächlich, aber leicht, oft weithin in einem Zuge. Sie sind durchaus nicht scheu und werden deshalb häufig erlegt und gefangen, ebensowohl ihres schmackhaften Fleisches wegen als ihrer Anmut und Liebenswürdigkeit im Käfig halber. »Unser Vogel«, so schreibt mir Engelhart, »erfreut sich einer ungleich größeren Beachtung als irgendein anderer seiner Ordnung, den Wellensittich nicht ausgeschlossen. Baut er in der Nähe der Landhäuser seine Nester, die er, kunstlos genug, mit seinem Schnabel aus dem mürben Holz herausarbeitet, am liebsten da, wo ein ausgefaultes Astloch ihm einigen Vorsprung gewährte, so wird sein Tun und Treiben von der lieben Jugend sicherlich scharf bewacht, bis endlich der lang ersehnte Tag anbricht, an dem die Nester ausgehoben werden können. Dann ist der Jubel allüberall groß. Jeder Landwirt hat fortan sein Pärchen Kakadupapageien, und jeder bemüht sich nach Kräften, die gelehrigen Vögel abzurichten, sie zahm und zutraulich zu machen, sie das Nachpfeifen eines Liedes zu lehren, was alles nur wenig Anstrengung und Mühewaltung erfordert. Auch bringt man jetzt Hunderte und Tausende von Jungen zur Stadt, um sie hier zu verkaufen. Trotz der eifrigen Nachstellung, die der brütenden Corella droht, gelingt es mancher jungen Brut, allen Verfolgungen zu entgehen, und dann vereinigen sich bald mehrere Familien zu zahlreichen Trupps. Allerliebst sieht eine solche Gesellschaft aus, wenn sie mit hoch aufgerichteter Haube in langen Reihen auf den Ästen der hohen Bäume scheinbar atemlos dasitzt, besorgt auf den nahenden Fußtritt achtend, um dann plötzlich eiligen Fluges das Weite zu suchen. Die erste Brut der Corella fällt wie die so vieler Vögel Südaustraliens in den Oktober, den dortigen Frühling; die zweite findet kurz vor Weihnachten oder noch etwas später statt. Jedes Gelege zählt sechs bis acht weiße Eier, aus denen meist dieselbe Anzahl von Jungen schlüpft, so daß eine Familie aus acht bis zehn Stücken zu bestehen pflegt. Die Jungen werden noch lange nach dem Ausfliegen von den Alten gefüttert, wie ich dies einst beobachten konnte, als sich Corellas dicht vor meinem Fenster angesiedelt hatten. Sie arbeiteten bereits eifrig an dem Nest für die zweite Brut, fütterten jedoch trotzdem die halb erwachsenen der ersten noch fort. Mit Beginn der Regenzeit verläßt auch dieser Papagei den Süden Australiens und bricht in ungeheuren Scharen nach dem Norden des Festlandes auf.«
Von allen australischen Papageien kommt die Corella nächst dem Wellensittich am häufigsten auf unsern Tiermarkt. Sie dauert bei geeigneter Pflege besser aus als jeder andere Papagei, pflanzt sich auch ohne besondere Umstände im Käfig fort. Anspruchslos wie nur irgendeiner ihrer Ordnungsgenossen begnügt sie sich mit Körnerfutter, Hafer, Hirse, Glanz und Hanf, Grünzeug aller Art, geschnittenen und zerriebenen Möhren, gewöhnt sich auch wohl, wenn man sie mehr als üblich gezähmt hat und im Zimmer hält, an die Speisen, die auf den Tisch kommen, und würde jeden Vogelfreund entzücken, könnte sie es über sich gewinnen, mit ihrem durchdringenden, gellenden Geschrei die Ohren weniger zu beleidigen, als sie dies zu tun pflegt.
*
Mit demselben Recht, mit dem man die Eulen von den Falken trennt, darf man den merkwürdigsten aller Papageien, den »Kakapo«, einen Nachtvogel Neuseelands, von den übrigen sondern und als Vertreter einer besonderen Unterfamilie oder meinetwegen Familie betrachten. Der Vogel erinnert so auffallend an die Eulen, daß man ihn dieser Familie zurechnen könnte, widerspräche dem sein Fußbau nicht. Um ihn zu kennzeichnen, genügt es, wenn man das Eulenartige seines Gefieders und den Schleier hervorhebt, der sein Gesicht umgibt. Der Kakapo oder Eulenpapagei ( Stringops habroptilus), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Stringops), gehört zu den größten Papageien überhaupt und kommt wegen seines dichten Federkleides fast einem Uhu an Größe gleich. Beim Männchen ist die ganze Oberseite lebhaft olivengrün, jede Feder auf dem braunschwarzen Wurzelteil durch breite olivengelbliche Querbinden und Schaftflecken gezeichnet, unterseits grünlich olivengelb, jede Feder mit verdeckten, auf der Schaftmitte unterbrochenen, schmalen, dunkelbraunen Querbinden geziert. Der eulenartig ausgebreitete Gesichtsschleier, der die Stirn mit bedeckt und die Ohrgegend in sich einschließt, sowie das Kinn sind lebhaft blaß strohgelb, nur in der Ohrgegend hell olivenbräunlich verwaschen. Der Schnabel ist hell hornweiß, der Fuß hell horngraubraun. Beim Weibchen ist die grüne Färbung der Oberseite dunkler und der Gesichtsschleier olivenbräunlich, indem die Federn nur sehr schmale, helle Schaftstriche besitzen. So beschreibt Finsch ein prachtvolles Pärchen dieser merkwürdigen Vögel. Außer Haast sind es namentlich Lyall und George Grey, die uns über die Lebensweise des Kakapo berichten, und ihre Angaben sind es, die ich hier zusammenstelle. »Obgleich man annimmt«, sagt Lyall, »daß der Kakapo noch gelegentlich in den hohen Gebirgen des Innern der Nordinsel Neuseeland angetroffen wird, war doch die ganze Örtlichkeit, wo wir diesen Vogel während der Umschiffung und Untersuchung der Küsten Neuseelands fanden, das Südwestende der Mittelinsel. Dort an den tiefen Fjorden, die in jenen Teil der Insel einschneiden, begegnet man ihm noch in beträchtlicher Anzahl. Er bewohnt hier die trockenen Abhänge der Hügel oder flache Stellen nahe dem Ufer der Flüsse, wo die Bäume hoch und die Waldungen einigermaßen frei von Farnkraut oder Unterholz sind. Der erste Platz, an dem wir ihn erhielten, war ein etwa zwölfhundert Meter über der Meeresfläche liegender Hügel; doch trafen wir ihn auch, und zwar gemeinschaftlich lebend, auf flachen Stellen in der Nähe der Flußmündungen unfern des Meeres an.
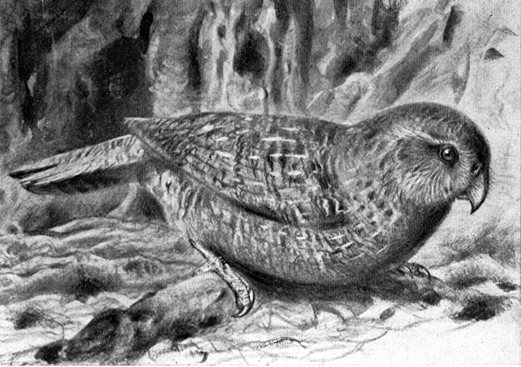
Kakapo ( Stringops habroptilus)
Der Kakapo lebt in Höhlen unter dem Gewurzel der Bäume, wird auch wohl unter der Wölbung überhängender Felsen bemerkt. Da die Wurzeln vieler Baumarten Neuseelands sich teilweise über den Boden erheben, sind Höhlungen unter ihnen sehr gewöhnlich; es schien uns aber, als wären diese da, wo wir den Kakapo trafen, zum Teil erweitert worden, obgleich wir uns vergeblich nach ausgescharrter Erde umsahen. Wir sahen uns nur mit Hilfe von Hunden imstande, ihn aufzufinden. Vor Einführung der Hunde, als der Vogel noch häufig war in den bewohnten Teilen der Inseln, pflegten ihn die Eingeborenen bei Nacht mit Fackeln zu fangen. Gegenwärtig ist eine Rasse halbwilder Hunde, die in den nördlichen Gegenden dieser Insel haust, dem Kakapo beständig auf den Fersen, und er ist dort beinahe ganz ausgerottet. Man sagt, daß die Verbreitung dieser Hunde zunächst noch durch einen Fluß begrenzt sei, und daß die gänzliche Ausrottung des Vogels zu fürchten stehe, wenn es ersteren gelänge, den Fluß zu überschreiten; denn obgleich er Krallen und Schnabel sehr empfindlich zu gebrauchen weiß und erklecklichen Widerstand leistet, muß er seinen viersilbigen Feinden doch erliegen und ihm da, wo diese sich finden, früher oder später das Schicksal der Dronte werden.
»Man war bisher der Ansicht«, so erzählt Haast, »daß der Kakapo eine nächtliche Lebensweise habe; aber ich glaube, diese Ansicht dürfte durch meine Beobachtungen wohl dahin abgeändert werden, daß dies nicht ausschließlich der Fall ist. Denn obwohl man seinen Ruf gewöhnlich eine Stunde nach Sonnenuntergang, wenn die dichte Laubdecke große Dunkelheit schafft, ringsum vernimmt und er alsdann herumzuschweifen beginnt (wobei er, angezogen vom Licht, unserm Zelt nahe kam und von unserm Hund gefangen wurde), so fanden wir ihn doch zweimal auch während des Tages fressend und sehr achtsam auf eine nahende Gefahr. Das erstemal war es eines Nachmittags bei bewölktem Himmel im lichten Wald, als wir von der Westküste zurückkehrten, daß wir einen Kakapo auf einem umgestürzten Baum unweit des Flusses Haast bemerkten. Als wir in die Nähe kamen, verschwand er schnell, wurde jedoch vom Hund gefangen. Das zweitemal sahen wir einen ebenfalls noch am hellen Tag, als wir in einer tiefen Felsenschlucht gingen, auf einem Fuchsienbaum drei Meter über dem Boden sitzend, dessen Beeren fressend. Als er uns bemerkte, stürzte er wie geschossen zu Boden und verschwand unter den umherliegenden großen Felsblöcken. Das Überraschendste für uns war, daß der Vogel keinen Gebrauch von seinen Flügeln machte, ja sie nicht einmal öffnete, um seinen Sturz zu mildern. Um zu erkunden, ob er denn gar nicht fliegen oder doch flattern werde, wenn er verfolgt wird, ließ ich einen ohne Schaden vom Hund gefangenen Kakapo auf einen großen, freien, kiesigen Platz setzen, wo er hinreichend Raum hatte, um sich mittels der Schwingen zu erheben, wenn er überhaupt zu diesem Zweck eines größeren Raumes bedurfte. Ich war jedoch überrascht, daß er nur dem nächsten Dickichte zulief, und zwar schneller, als ich in Anbetracht seiner Zehen und plumpen Gestalt erwartet hatte, und daß er in seinen Bewegungen den Hühnervögeln ähnelte. Ich stand seitlich von ihm, und mir schien, er halte die Flügel vollkommen geschlossen am Leib; allein jene meiner Gefährten, die hinter ihm standen, bemerkten, daß sie etwas geöffnet waren, jedoch nicht bewegt wurden, also wohl ohne Zweifel mehr dazu dienten, das Gleichgewicht zu erhalten, als seinen Lauf zu beschleunigen. Er zieht auch, obwohl sein Bau nicht zum Laufen geeignet erscheint, ziemlich weit, wie wir an den Spuren sehen konnten, die oft über eine halbe Meile über Sand und Geröll bis ans Flußufer führten.« Lyall hat den Vogel jedoch fliegen sehen, wenn auch bloß über unbedeutende Strecken hinweg. »Bei unseren Jagden«, sagt er, »sahen wir den Kakapo nur dann fliegen, wenn er in einem hohlen Baum emporkletterte, um weiter oben einen Ausweg zu suchen. Von hier aus flog er regelmäßig nach tieferstehenden Bäumen herab, arbeitete sich an diesen aber, und zwar kletternd, mit Hilfe des Schwanzes rasch wieder empor. Die Flügelbewegung war sehr unbedeutend, kaum, daß man sie wahrnehmen konnte.
Das Geschrei des Kakapo ist ein heiseres Krächzen, das in ein mißtöniges Kreischen übergeht, wenn der Vogel erregt oder hungrig ist. Die Maoris behaupten, daß der Lärm, den die Vögel verursachen, zuweilen betäubend werden könne, weil sie sich während des Winters in großen Gesellschaften zusammengehalten und bei ihrer ersten Zusammenkunft oder beim Auseinandergehen lebhaft begrüßen sollen.
Die Magen der von uns erlegten Kakapos enthielten eine blaßgrüne, mitunter fast weiße gleichartige Masse ohne Spur von Fasern. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Nahrung zum Teil in Wurzeln, teils aber auch in den Blättern und zarteren Sprößlingen verschiedener Pflanzen besteht.« Haast konnte die Nahrung noch genauer bestimmen. »Der Kakapo,« berichtet er, »scheint Flußwasser sehr zu benötigen, um die breiigen Pflanzenmassen in seinem Kropfe damit zu mischen. Wir fanden den Kropf, mit Ausnahme von zwei Stücken, die Beeren gefressen hatten, stets mit fein zerteiltem Moos gefüllt, und davon so ausgedehnt und schwer, daß er viele Unzen wog. Der Vogel erscheint auch viel kleiner, wenn der Kropf ausgeleert wird. Die Menge dieses wenig nahrhaften Futters, mit dem er sich vollstopfen muß, dürfte seine Bestimmung, auf der Erde zu leben, erklären und ihn befähigen, in jenen Wildnissen fortzukommen, wo keine andere Art seiner Familie lebt. Eine andere Eigentümlichkeit, vielleicht ebenfalls Folge dieser Pflanzenkost, ist, daß er statt des öligen, weichen Fettes, wie es andere Vögel unter der Haut haben, viel festes, weißes Fett besitzt und auch sein Fleisch weit derber und besser ist als das der andern Papageienarten und einen ausgezeichneten Geschmack hat. Man wird mir wohl vergeben, wenn ich bemerke, daß dieser Vogel eine köstliche Speise ist für die in diesen Wildnissen herumstreifenden Leute, und ich kann es sehr wohl begreifen, daß der alte Maori von der Westküste schon mit den Lippen schmatzt, wenn man nur vom Kakapo spricht.«
Über die Fortpflanzung gibt Lyall folgendes an: »Während der letzten Hälfte des Februar und der ersten des März, welche Zeit wir inmitten der Wohnplätze des Kakapo verweilten, fand ich in vielen seiner Höhlen Junge, oft nur eins und nie mehr als deren zwei. In einem Falle fand ich neben dem Jungen auch ein faules Ei. Gewöhnlich, jedoch nicht immer, wurde ein alter Vogel zugleich mit den Jungen in der Höhle angetroffen. Ein eigentliches Nest ist nicht vorhanden; der Kakapo scharrt sich nur eine seichte Höhlung in der trockenen Masse des vermoderten Holzes. Das Ei ist reinweiß, einem Taubenei an Größe ungefähr gleichkommend. Die Jungen, die wir fanden, waren sehr verschiedenen Alters, einige fast ganz ausgefiedert, andere noch mit Dunen bedeckt.«
Über das Gefangenenleben des Eulenpapageis hat neuerdings Sale berichtet, der im Jahre 1870 den ersten lebenden Kakapo nach England brachte. »Während der ganzen Zeit, in der ich den Vogel besaß«, sagt er, »ließ er nicht das geringste Zeichen von Unmut bemerken, war vielmehr unverändert heiter oder gut aufgelegt und geneigt, jede ihm gespendete Aufmerksamkeit dankbar entgegenzunehmen. Bemerkenswert ist seine Spiellust. Er kommt aus einer Ecke des Zimmers herbei, ergreift meine Hand mit Klauen und Schnabel, wälzt sich, die Hand festhaltend, wie ein Kätzchen auf dem Boden und eilt zurück, um sich zu einem neuen Angriff einladen zu lassen. Sein Spiel wird zuweilen ein wenig derb; aber die geringste Zurechtweisung besänftigt ihn wieder. Er ist ein entschieden launiger Gesell. Zuweilen habe ich mich damit ergötzt, einen Hund oder eine Katze dicht vor seinen Käfig zu bringen; er tanzte mit ausgebreiteten Flügeln vor- und rückwärts, als ob er zornig scheinen wolle, und bezeigte, wenn sein ungewohnter Anblick die Tiere einschüchterte, durch ausgelassene Bewegungen und Stellungen Freude über den erzielten Erfolg. Eine seiner Eigenheiten besteht darin, daß er beim Umhergehen den Kopf umdreht und den Schnabel in die Höhe hält, als beabsichtige er, sich zu überzeugen, wie die Dinge umgekehrt aussähen. Die höchste Gunst, die er mir erweisen kann, ist die, sich in meine Hand zu kauern, seine Federn aufzublähen und mit den herabhängenden Flügeln die Hand abwechselnd zu schlagen. Schüttelt er dann noch seinen Kopf, so befindet er sich im höchsten Zustande der Wonne. Ich glaube nicht, daß man recht hat, ihn zu zeihen, daß er viel Schmutz verursache, denn er ist in dieser Beziehung gewiß nicht schlimmer als irgendein anderer Papagei, überrascht war ich zu hören, daß er während der Zeit, die er im Tiergarten zu Regents-Park verbrachte, sich selten am Tage zeigte. Nach meinen Erfahrungen war das Gegenteil der Fall. Er war für gewöhnlich zwar nicht so laut und lebhaft wie des Nachts, aber doch munter genug.«
*
Eine andere Unterfamilie umfaßt die Sittiche im engeren Sinne oder die Langschwanzpapageien ( Sittacinae), kenntlich an ihrem langen, keilförmigen oder abgestuften Schwanze. Fast die Hälfte aller bekannten Papageien gehört dieser Gruppe an. Sie verbreitet sich über alle Erdteile und tritt in Südamerika, Australien und auf den Inseln des Stillen Weltmeeres besonders zahlreich, jedoch auch auf dem südasiatischen Festlande in einer erheblichen Anzahl von Arten auf.
Unter den Langschwanzpapageien stellen wir wie billig die größten obenan. Es sind dies die Araras ( Ara), Papageien von Raben- bis Dohlengröße, die durch den sehr kräftigen und außerordentlich großen, seitlich zusammengedrückten, auf der Firste stark gekrümmten und in eine weit überhängende Spitze ausgezogenen Schnabel sowie die nackte Stelle am Vorderkopf, die Zügel, Augenkreis und den vorderen Teil der Wange in sich begreift, in selteneren Fällen auf eine faltige Haut um den Unterschnabel sich beschränkt, endlich auch durch den sehr langen Schwanz sich von allen übrigen Papageien unterscheiden. Zur Kennzeichnung möge außerdem noch dienen, daß der Oberschnabel vor der Spitze einen deutlichen Zahnausschnitt besitzt, der Unterschnabel höher als der obere und seitlich abgeflacht ist, eine breite Dillenkante und vor der abgestutzten Spitze jederseits eine gerundete Bucht zeigt, daß die nackten Kopfseiten oft mit kurzen, in weit voneinander getrennten Reihen geordneten Federn bekleidet sind, daß in dem langen und spitzen Fittich die dritte Schwinge alle andern überragt, die Flügelspitze sehr lang vorgezogen ist, und daß in dem langen, keilförmigen Schwanze die äußerste Feder ungefähr ein Drittel der Länge der mittelsten besitzt. Das derbe, harte Gefieder prangt in lebhafter grüner, roter oder blauer Färbung. Beide Geschlechter unterscheiden sich nicht und die Jungen unerheblich von den Alten. Die Araras, fälschlich auch wohl » Aras« genannt, verbreiten sich vom nördlichen Mexiko bis ins südliche Brasilien und Paraguay, reichen aber nicht bis Chile herüber. In den Anden steigen einzelne Arten bis zu dreitausendfünfhundert Meter unbedingter Höhe empor. Die meisten Arten bewohnen den Urwald fern von dem Menschen und seinem Treiben, ziehen sich vor dem Pflanzer auch weiter und weiter zurück und werden mit der zunehmenden Bevölkerung überall seltener.

Grünflügelara ( Ara chloroptera)
Größe und eigentümliche Schönheit würdigen die Hyacintharara ( Arara hyacinthina) obenangestellt zu werden. Dieser herrliche Vogel, schon an seinem riesenhaften Schnabel kenntlich, ist einfarbig dunkel kobaltblau, auf Kopf und Hals etwas lichter, die Wurzel der Federn grau, die Innenfahne der Schwingen schwärzlich gerandet. Schwingen, Steuerfedern und größte Unterflügeldeckfedern sind glänzend schwarz, wie deren Schäfte. Das Auge ist tiefbraun, der große nackte Augenkreis und die sehr ausdehnbare nackte Haut um den Unterschnabel hochorange, der Schnabel schwarz, der Fuß schwärzlichbraun. Die Länge wird von Burmeister zu einem Meter, die Fittichlänge zu zweiundvierzig, die Schwanzlänge zu achtundfünfzig Zentimeter angegeben.
Das Verbreitungsgebiet der Hyacintharara beschränkt sich auf den nördlichen Teil des mittleren Brasiliens, ungefähr vom sechzehnten Grad südlicher Breite an bis zum Amazonenstrom. Innerhalb dieses Wohnkreises tritt sie jedoch überall nur einzeln auf, gehört deshalb auch zu den selteneren Erscheinungen unseres Vogelmarktes.
Viel häufiger und weiter verbreitet ist die Arakanga ( Ara macao) ein ebenfalls sehr stattlicher Vogel von 86 Zentimeter Länge, 15 Zentimeter Breite, 40 Zentimeter Fittich- und 32 Zentimeter Schwanzlänge. Das Kleingefieder ist scharlachrot, auf Stirn- und Ohrgegend etwas heller, auf Hinterrücken und Bürzel, sowie die oberen und unteren Schwanzdecken schön himmelblau; die Hand- und Armschwingen nebst ihren Deckfedern und dem Eckflügel sind berlinerblau, erstere an der Innenfahne breit schwärzlich gerandet, die größten Oberflügeldecken nebst den langen Schulterfedern orangegelb, mit grünem Endfleck geziert, die Steuerfedern scharlachrot, am Ende himmelblau, die beiden äußersten Paare dunkelblau, die unteren Flügeldecken, wie die Schwingen und Steuerfedern unterseits, glänzend scharlachrot. Das Auge ist gelblichweiß, die nackte Wange bräunlich fleischfarben, der Oberschnabel hornweiß, unten am Wurzelrand mit schwarzem, dreieckigem Fleck geziert, der Unterschnabel schwarz, der Fuß graulichschwarz.
Die Arakanga lebt in den nördlichen Ländern Südamerikas, von Bolivia und dem nördlichen Brasilien bis Guatemala und Honduras hinauf, kommt jedoch auch in Peru und ebenso wahrscheinlich in Mexiko vor.
Sehr häufig wird mit der vorher beschriebenen Art die Grünflügelara ( Ara chloroptera) verwechselt, obwohl sie an ihrem dunkel scharlachroten Gefieder und den grünen Oberflügel- und Schulterdecken ersichtlich sich unterscheidet. Sie vertritt die Arakanga in Mittel- und Südbrasilien, verbreitet sich aber auch weit nach Norden, Süden und Westen hin.
Die letzte Art, die ich erwähnen will, ist die Ararauna ( Ara ararauna). Alle oberen Teile nebst den Schwanzdecken sind dunkel himmelblau, die Halsseiten und alle Unterteile hoch orangefarben, ein Randstreifen, der Backen und Kinn einfaßt, endlich schwarz. Das Auge ist grünlich perlgrau, die nackte Kopfseitenstelle bräunlich fleischfarben, der Schnabel schwarz, der Fuß bräunlich schwarz. Die Länge beträgt 97, die Fittichlänge 40, die Schwanzlänge 52 Zentimeter. Das Verbreitungsgebiet stimmt mit dem der Arakanga überein.
Die Araras zählen zu den Charaktervögeln der Urwaldungen. Ebene, von Flüssen durchzogene Wälder bilden ihren bevorzugten Aufenthalt. Früher lebten sie in unmittelbarer Nähe auch der großen Städte; gegenwärtig haben sie sich vor der andringenden Bevölkerung längst zurückgezogen und verschwinden da, wo Pflanzer den Urwald lichten, früher oder später. Einzelne Arten beschränken sich nicht auf den Wald, sondern finden sich ebenso in jenen trockenen, höheren Gegenden, die von der Hitze des Sommers verbrannt sind, und auch in den wilden, felsigen Gebirgen der Provinz Bahia bildet ihr Geschrei die Unterhaltung der Reisenden. »Während man auf den Flüssen der Küstenwälder schifft«, sagt der Prinz, »erblickt man die stolzen Vögel und erkennt sie an ihrer Stimme, Größe und dem langen Schweif sogleich, wenn sie mit ihren großen, langen Flügeln schlagend langsam durch die hohe dunkelblaue Luft dahinrudern. Die Lebensweise dieser schönen Vögel ist im allgemeinen nicht verschieden von der anderer Papageien. Am Mittag während der größten Hitze sieht man sie auf den unteren starken Ästen eines schattenreichen Baumes ausruhend sitzen. Der Hals ist eingezogen, und der lange Schweif hängt gerade herab. Jedoch wird ihre Tätigkeit schon nach ein Paar Stunden der Ruhe wieder rege. Sie ziehen außer der Paarzeit in Gesellschaften nach verschiedenen Früchten umher, die mehrerer Palmenarten, des Sapucajabaumes und anderer aufsuchend, an deren steinharten Schalen sie die Kraft ihrer gewaltigen Schnäbel zu versuchen pflegen. So laut sie sich gewöhnlich hören lassen, so verhalten sie sich doch nach Art aller Papageien still, sobald sie einen Baum mit ihnen angenehmen Früchten entdeckt und sich hierauf niedergelassen haben. Hier erkennt man alsdann ihr Dasein besonders durch das Herabfallen der zerbissenen Fruchthülsen. In vielen Gegenden fanden wir sie namentlich in der kalten Jahreszeit mit der Aufsuchung der Frucht einer gewissen rankenden Pflanze beschäftigt, die man dort Spinha nennt. Sie kletterten sehr geschickt an den verworrenen Ranken dieser Gewächse herum und waren alsdann dort leichter zu schießen als gewöhnlich. Die weißen Samenkörner dieser Frucht füllten ihren ganzen Kropf an, und zu andern Zeiten fanden wir ihren Schnabel von gewissen Früchten blau gefärbt.« Im Vergleich zu andern Sittichen erscheinen die Araras als ruhige, bedächtige und ernste Vögel. Entwicklung der Sinne und Verstand aber kann ihnen nur derjenige absprechen, der sie nicht beobachtet hat. Auch sie gewöhnen sich leicht, leichter vielleicht als viele andere Papageien, an veränderte Umstände, gehen, ich will mich so ausdrücken, auf die Wünsche und Eigenheiten des Menschen ein, fügen sich zwar nicht jeder, aber doch einer sanften und verständigen Behandlung und machen nur dann von ihrer bedeutenden Kraft Gebrauch, wenn man sie reizt. Mit ihresgleichen leben sie in innigstem Verbände, mit andern Vögeln oder Tieren in tiefstem Frieden. Ihr Wesen macht sie, wie ich schon an andern Orten gesagt habe, angenehm und liebenswert. Sie sind nicht allein gutmütige und anhängliche, sondern auch gegen den Gatten und ihre Brut und ebenso dem geliebten Pfleger gegenüber hingebend zärtliche Vögel.
Wenn Araras auf einem Baum sitzen und fressen, schweigt gewöhnlich die ganze Gesellschaft; höchstens lassen sie leise Laute vernehmen, die einer menschlichen Unterhaltung nicht unähnlich sind. Ihre kreischende Stimme hört man immer dann, wenn sie beunruhigt sind oder wenn sie fliegen; am lautesten schreien sie, wenn der Jäger sich leise herangeschlichen und durch einen Schuß die sorglos fressende Bande erschreckt hat. Dann erheben sie ein Geschrei, das geradezu betäubend werden kann. Sie sind es, auf die Humboldt die oben mitgeteilten Worte bezieht: ihr Geschrei ist es, das das Brausen der Bergströme übertönt. Die laute Stimme selbst ist ein sehr rauher, ziemlich einsilbiger Laut, der mit der Stimme unserer Rabenkrähe Ähnlichkeit hat. Burmeister versichert, »Arara« oder »Aras« aus dem Geschrei der Freilebenden herausgehört zu haben, und ich meinesteils kann ihm, soweit es sich um Gefangene handelt, nur zustimmen.
Ursprünglich auf die Früchte, Nüsse und Sämereien der Bäume des Urwaldes angewiesen und auch wohlbefähigt, mit ihrem gewaltigen Schnabel selbst die steinharten Schalen verschiedener Palmennüsse zu zertrümmern, erscheinen doch auch die Araras dann und wann als unliebsame Gäste in den Pflanzungen des Menschen. Schomburgk schildert ihre Raubzüge in sehr anschaulicher Weise. »Finden sie ein reifes Feld, so werden rundherum auf den nächsten Bäumen Wachen ausgestellt. Das sonst immerwährende Lärmen und Gekreisch der rauhen Stimmen ist verstummt; nur hin und wieder hört man einen halb unterdrückten knurrenden oder murrenden Laut. Nähert sich der plündernden Gesellschaft ein verdächtiger Gegenstand, so läßt augenblicklich die Wache, die diesen zuerst bemerkt hat, einen leisen Warnungsruf erschallen, den die Räuber, um jener anzuzeigen, daß er gehört worden ist, mit halb unterdrücktem Krächzen beantworten. Sowie die Gefahr dringender wird, fliegt die Wache unter lautem Aufkrächzen von ihrem Posten auf, und mit ihr zugleich erhebt sich die plündernde Herde unter wildem Geschrei, um ihr Heil in beschleunigter Flucht zu suchen.«
Wie alle Papageien, sind auch die Araras sehr treue Gatten. Die Gattenliebe ist bei ihnen so ausgeprägt, daß man sagen darf, zwei gepaarte Araras leben nur sich und ihrer Brut. Die gerühmten Zwergpapageien können gegeneinander nicht zärtlicher sein als diese großen Vögel. Immer sieht man Männchen und Weibchen zusammen, und selbst wenn ihrer mehrere fliegen, kann man, wie bei andern Papageien auch, die einmal verbundenen Paare unterscheiden. Diese gegenseitige Anhänglichkeit ist eine den Brasilianern so wohlbekannte Tatsache, daß sie der Jäger benutzt, um mehrere aus einem Flug zu erlegen. Denn wenn einer herabgeschossen wurde, erscheint sofort der überlebende Gatte bei ihm, um sich über die Ursache des Trauerfalles aufzuklären, und sein Geschrei lockt dann auch wohl andere desselben Fluges herbei.
»In der Paarungszeit«, erzählt Prinz von Wied weiter, »pflegen die Araras den Brutort oder Stand wieder aufzusuchen, den sie sich einmal erwählt haben, wenigstens dann, wenn sie daselbst nicht beunruhigt worden sind. Man sieht sie somit lange Jahre hindurch an einer und derselben Stelle. Sie wählen, um ihr Nest anzulegen, immer einen hohen Waldbaum von gewaltigem Umfang, an dem ein hohler Ast oder eine eingefaulte Öffnung sich befindet, die sie dann mit ihrem starken Schnabel bis zu der gehörigen Weite öffnen. Hier legt das Weibchen zwei weiße Eier, wie die meisten Arten der Papageien.« Die Eier stehen einem Hühnerei an Größe wenig nach, sind ungleichhälftig, stumpf zugespitzt, nach dem dicken Ende sanft zugerundet und zeigen ein zartes Korn mit dichten, runden, mäßig tiefen Poren. Ob nur das Weibchen brütet oder dann und wann auch vom Männchen abgelöst wird, konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Letzteres scheint mir glaublich, mindestens nicht unwahrscheinlich zu sein. Der lange Schwanz wird, wie Schomburgk angibt, beim Brüten zum Verräter, indem er weit aus der Öffnung hervorragt. Nach Azaras Versicherung verliert das Paar sein Nest nicht aus dem Auge und trägt deshalb abwechselnd Atzung zu. Wenn sich jemand naht, verrät es große Unruhe. Die Jungen schreien nicht nach Futter, sondern drücken ihr Begehren dadurch aus, daß sie mit dem Schnabel gegen die Wandung ihrer Nesthöhle klopfen. In ihrer ersten Jugend sind sie, wie alle Papageien, überaus häßlich und unbeholfen; aber auch nach dem Ausfliegen verlangen sie noch lange Zeit die Obhut und Pflege der Eltern. Die Eingeborenen pflegen sie auszunehmen, bevor sie ihr volles Gefieder erhalten haben; dann werden sie sehr zahm.
Gefangene Araras scheinen von jeher Lieblingstiere der Indianer gewesen zu sein. »Mit reger Teilnahme«, sagt Humboldt, »sahen wir um die Hütten der Indianer zahme Araras, die auf den Feldern umherflogen wie bei uns die Tauben. Diese Vögel sind eine große Zierde der indianischen Hühnerhöfe; sie stehen an Pracht den Pfauen, Goldfasanen, Baumhühnern und Hockos nicht nach. Schon Columbus war die Sitte aufgefallen, Papageien, Vögel aus einer dem Hühnergeschlecht so fernstehenden Familie, aufzuziehen; und gleich bei der Entdeckung Amerikas hatte er beobachtet, daß die Eingeborenen auf den Antillen statt Hühner Araras oder große Papageien essen.«
Etwas Gefährliches bleibt es immer, Araras um sich zu haben; denn nur zu oft gebrauchen sie ihren furchtbaren Schnabel in unerwünschter Weise. Doch gibt es einzelne, die sehr zahm werden. Mein Vater sah einen dieser Vögel in dem Arbeitszimmer des Prinzen von Wied. Die Arara hatte volle Freiheit, in den Gemächern umherzufliegen, hielt sich aber gern in der Nähe ihres Gebieters auf, ließ sich von diesem ruhig ergreifen, auf der Hand im Zimmer umhertragen und streichelte ihm mit ihrem gefährlichen Schnabel die Wangen in zärtlicher Weise. Ich habe mehrere gepflegt, die kaum weniger zahm wurden, jedoch keinen einzigen kennengelernt, der, wie Kakadus, gegen alle gleich freundlich sich bezeigte. Araras unterscheiden scharf zwischen Bekannten und Fremden, beweisen ihrem Pfleger Anhänglichkeit, zeigen sich Fremden gegenüber jedoch oft launisch und selbst tückisch, verlangen daher immer eine vorsichtige Behandlung. Der Wärter wird freudig begrüßt und darf sich alles mit ihnen erlauben; andern gegenüber nehmen sie gewöhnlich eine zornige Miene an, indem sie die Kopffedern sträuben und den Schnabel in verdächtiger Weise bewegen.
»Was aus einer Arara werden kann«, schreibt mir Linden, »beweist mir eine Ararauna, die jetzt zu meinen Lieblingsvögeln zählt. Ich bekam sie als einen scheuen, betäubend schreienden, bissigen Vogel, dem ich selbst das nötige Futter nur mit List beibringen konnte, um nicht währenddem von ihm gebissen zu werden. Eine Hungerkur, wie unverständige Pfleger wohl anraten, nahm ich selbstverständlich nicht vor, weil ich erfahrungsmäßig wußte, daß Güte viel eher zum Ziele führt als derartige Maßregeln. Und in der Tat haben gute Worte und liebevolle Behandlung meiner Arara bald alle früheren Unarten abgewöhnt. Berühren der Schwanzfedern kann sie zwar auch jetzt noch nicht leiden; dagegen läßt sie sich gern Streicheln ihres Kopfes gefallen und streckt dabei nicht selten ihre große fleischige Zunge seitwärts zum Schnabel heraus, gleichsam als wolle sie damit die ihr gespendete Liebkosung erwidern. Einmal hatte sie einen tüchtigen Schnupfen und infolgedessen verstopfte Nasenlöcher, die ich ihr mit einer Feder reinigte; diese Maßnahme schien ihr offenbar Erleichterung zu verschaffen; denn sie verfehlte nicht, in der unter Papageien üblichen Weise ihre Zufriedenheit zu äußern. Mutwillige Streiche mancher Art läßt sie sich freilich fortwährend zuschulden kommen. An der Tür ihrer Behausung war die Schließfeder zu schwach. Sie erkannte dies bald, untersuchte und fand, daß das Schloß aufsprang, wenn sie hinten die Tür in die Höhe drückte. Nunmehr verließ sie sofort ihren Bauer, flog im Vogelhause umher und spielte den Holzkäfigen übel mit. Endlich kam ich der Sache auf den Grund und änderte den Verschluß. Hierüber war sie anfänglich höchst verdrießlich, vergaß aber nach und nach die Angelegenheit und wurde im Verlaufe der Zeit so artig, daß ich sie jetzt herauslassen darf, ohne Mutwillen befürchten zu müssen. Sie bleibt einfach auf der Tür sitzen, und wenn ich ihr sage: ›Geh wieder in dein Haus!‹, gehorcht sie sogleich. Von einem großen Wassertopf macht sie fleißig Gebrauch, um sich zu baden. Hatte ich ihr denselben früher leer in den Käfig gestellt und nicht sogleich gefüllt, so wurde der Topf sofort entzweigeschlagen, wogegen dies andernfalls niemals geschah. Beim Schlafen saß sie selten auf der Stange, sondern hielt sich mit Schnabel und Füßen am Gitter fest; oft auch scharrte sie sich den Sand zusammen und legte sich platt auf den Boden nieder. Anfänglich glaubte ich, daß ihr etwas fehle. Sie wurde aber sehr aufgebracht, wenn ich versuchte, sie vom Boden wegzujagen, und bewies mir dadurch, daß sie jede Störung übel vermerkte. Seitdem ließ ich sie gewähren. Ihre Behausung ist so gestellt, daß sie den ganzen Garten vor sich hat und alle Wege übersehen kann. Infolgedessen hat sie sich zum Wächter und Warner meiner ganzen Papageiengesellschaft aufgeschwungen. Wenn ein Hund oder eine Katze des Weges kommt, verfehlt sie nie, dies mit einem eigentümlichen Aufschrei anzuzeigen. Ihre Nachbarn, Kakadus und Amazonen, wiederholen den Warnungsruf, und es tritt dann plötzlich eine so tiefe, minutenlange Stille ein, daß man nicht zweifeln kann, die Warnung sei von jedem andern Vogel vollkommen verstanden worden.«
Araras lernen selten so gut sprechen wie andere Papageien, entbehren jedoch durchaus nicht aller Begabung hierzu. »Meine Arara«, schreibt Siedhof meinem Vater, »hat eine große Befähigung zum Sprechen entwickelt, und zwar unter der alleinigen Leitung meiner zahmen Elster, die sehr gut spricht. Mehr als vier Monate nach dem Empfang war die Arara bis auf das entsetzliche Schreien vollständig stumm. Da mußte ich sie einst an eine andere Stelle bringen, wo sie meiner unaufhörlich schwatzenden Elster gegenüberhing. Sie hatte dort gerade zehn Tage gehangen, als sie begann, der Elster alles nachzusprechen. Jetzt ruft sie meine Kinder mit Namen und lernt sogleich, was man ihr noch vorsagt; nur hat sie das Eigene, daß sie regelmäßig bloß dann spricht, wenn sie allein ist.« Auch die vorstehend geschilderte Ararauna hat sprechen gelernt, ohne von ihrem Pfleger unterrichtet worden zu sein. Hierüber berichtet mir Linden: »›Guten Tag, Aras‹, ist jetzt das erste des Morgens, wenn der Vogel mich sieht. Früher kam es ihm nicht darauf an, zu jeder Tagesstunde so zu grüßen; gegenwärtig bringt er seinen Gruß mit der Zeit vollständig in Einklang. ›Jakob ist ein Kakadu, nein, ein Papagei, ein Spitzbub. Polly, guter Polly, komm zu mir.‹ Gebe ich ihm eine Feige, ein Stückchen Apfel, so verzehrt er es mit dem Ausspruch: ›Das ist gut, gelt Jakob‹. Bei einem Stückchen Zucker dagegen sagt er: ›Das ist ganz gut‹ und bekräftigt den Ausspruch noch außerdem mit verschiedenen Kopfbewegungen. Für Darreichen seines gewöhnlichen Futters gibt es keinen Dank, im Gegenteil oft einen Hieb, wogegen er bei Leckereien solchen niemals austeilt. Das auf dem Boden seines großen Kastenkäfigs stehende Futtergeschirr wurde von ihm oft umgeworfen und hin und her geschleppt, was ich ihm mit den Worten: ›Keine solche Dummheiten machen‹ verwies. Jetzt sagt er, wenn er in die alte Gewohnheit verfällt, selbst: ›Das sind Dummheiten‹, und wenn ich ihm das Geschirr wegnehme, tröstet er sich, indem er mit dem Schnabel im Sande hin und her streicht, und sagt dazu mitunter: ›Gelt, Dummheiten‹. Dem obenerwähnten Amazonenpapagei, der sehr deutlich und mit vielem Ausdruck spricht: ›Laura, du hast ja Augen wie Perlen; mein Schätzchen, was willst du noch mehr‹, hat er dieses abgelauscht, verwechselt jedoch noch oft Worte und Satzstellung.«
Zweckmäßig gepflegte Araras erreichen in Gefangenschaft ein hohes Alter. Azara verbürgt ein Beispiel, daß eine vierundvierzig Jahre in einer und derselben Familie lebte, zuletzt aber altersschwach wurde und schließlich nur gekochten Mais zu verdauen vermochte. Einer Angabe Bourjots zufolge soll im Jahre 1818 ein Pärchen Araraunas, das in Caen gefangen gehalten wurde, auch genistet haben.
Die Jagd der Araras wird von Eingeborenen und Weißen mit gleichem Eifer betrieben; auch der europäische Jäger schätzt sich glücklich, wenn ein wohlgezielter Schuß ihm den herrlichen roten Vogel in die Hände liefert. »Vorsichtig«, sagt der Prinz, »und von dem dichten Gebüsch oder den Stämmen gedeckt, schleicht sich der Jäger an ihre Gesellschaften heran und erlegt dann zuweilen mehrere von ihnen auf einen Schuß. Ihre laute Stimme, die, wie bemerkt, immer gehört wird, wenn sie fliegen oder beunruhigt sind, macht gewöhnlich den Jäger aufmerksam. Man erlegt sie mit schwerem Blei, da man meistens in die Wipfel der höchsten Waldbäume nach ihnen schießen muß. Verwundet klammert sich der Vogel mit seinem starken Schnabel und seinen Klauen oft fest an die Zweige an und bleibt noch eine Zeitlang in dieser Stellung. Erhält der Jäger aber die ersehnte Beute, so gibt sie ihm eine erwünschte Speise. Das Fleisch kocht gleich dem Rindfleisch und ist an alten Vögeln hart, in der kalten Jahreszeit oft sehr fett, gibt aber, gekocht, eine kräftige Brühe. Die schönen Federn werden vielfältig benutzt; jeder Jäger, der eine Arara erlegte, wird seinen Hut mit schönen roten und blauen Schwung- und Steuerfedern zieren.«
*
Was der Nasenkakadu unter seinesgleichen, ist der Langschnabelsittich oder »Choroy« der Chilenen ( Henicognathus leptorrhynchus) in seiner Familie: ein Erdvogel mit auffallend gestrecktem, langspitzigem Schnabel, der deshalb mit Fug und Recht zum Vertreter einer besonderen Sippe ( Henicognathus) erhoben worden ist. Im Bau seiner Fittiche und des Schwanzes stimmt besagter Vogel fast vollständig mit den ihm am nächsten stehenden Keilschwanzsittichen überein, durch den Schnabel unterscheidet er sich von diesen und allen Papageien überhaupt. Dieser Schnabel ist mittelstark, schlank und viel länger, der Oberschnabel zweimal so lang als hoch, sehr wenig gebogen, seitlich abgeflacht, auf der Firste breit abgerundet und in eine lange, verschmälerte, fast wagerecht vorragende Spitze ausgezogen, an deren Grunde ein deutlicher Zahnausschnitt sich befindet, der Unterschnabel so hoch als der obere, seitlich abgeflacht, an der Dillenkante abgerundet, mit den Schneiderändern sanft in die Höhe gebogen. In dem harten Gefieder herrscht Dunkelolivengrasgrün, auf der Unterseite Olivengrün vor; der Stirnrand, die Befiederung der Wachshaut, die Zügel und ein schmaler Augenrand sind düster kupferpurpurrot, die mittleren Bauchfedern mit dieser Farbe überhaucht, wodurch ein undeutlicher roter Bauchfleck entsteht, die Federn des Oberkopfes durch breite, schwarze Endsäume gezeichnet, die Handschwingen und ihre Deckfedern außen bläulichgrün, schwarz gerandet, am Ende schwärzlich umsäumt, die größten unteren Flügeldecken wie die Schwingen unterseits grauschwärzlich, am Rande der Innenfahne blaß olivengelblich verwaschen, die Steuerfedern oben und unten düster kupferpurpurrot. Das Auge hat goldgelbe Iris, Schnabel und Füße sind blaugrau. Beim Weibchen ist das Gefieder trüber und der rötliche Bauchfleck kleiner und blasser. Eine gelbe Spielart, von den Chilenen »Rey de Choroy« oder Choroykönig genannt, ist nicht selten. Die Länge beträgt achtunddreißig, die Fittichlänge zwanzig, die Schwanzlänge siebzehn Zentimeter; der Vogel erreicht also ungefähr die Größe unserer Elster.
Der Langschnabelsittich, einer der drei Papageien, die Chile bewohnen, verbreitet sich über das ganze Land und von hier aus nach Süden hin bis zur Magelhaensstraße hinauf, kommt auch auf Chiloe vor. Über sein Freileben ist noch wenig bekannt, genug jedoch, um zu erkennen, daß der Vogel seinen absonderlichen Schnabel entsprechend zu benutzen versteht. Hierüber danken wir Boeck, Gay und neuerdings Landbeck einige kurze Mitteilungen. Der Vogel ist sehr gemein und vereinigt sich oft zu Scharen von mehreren Hunderten und Tausenden, deren Geschrei betäubend wirkt und Gay, wie er versichert, oft am Schlafen verhinderte, wenn er gezwungen war, im Freien zu nächtigen. Seine eigentlichen Wohnsitze sind die Buchenwälder. Von ihnen aus unternimmt er jedoch der Nahrung halber regelmäßige Streifzüge. In Valdivia trifft er anfangs Oktober ein und verweilt bis zum April in der Gegend. Während dieser Zeit erscheint er täglich morgens flugweise, von Norden herkommend, und begibt sich abends wieder dorthin zurück. Die Züge folgen, wie bei den meisten Papageien, einer bestimmten Straße, und jeder einzelne Trupp zieht genau in der Richtung der vorangegangenen dahin. Da der Choroy mehr Erd- als Baumvogel ist, sieht man ihn oft weite Strecken der Pampas, leider aber auch der Felder bedecken. Denn er ist der gefährlichste Feind der Weizen- oder Maissaaten, indem er mit seinem fast geraden Schnabel ebensogut keimenden Weizen oder Mais wie Wurzeln von Gräsern, die sein ursprüngliches Futter bilden, aus der Erde zieht. Zum Kummer des Landwirtes läßt er es nicht einmal bei solchen Räubereien bewenden, sondern fällt plündernd auch in den Obstgärten ein und zerstört hier, ausschließlich der Kerne halber, die Äpfel. Kein Wunder daher, daß er von den Bauern Chiles gehaßt und aufs eifrigste verfolgt wird. Durch Landbeck erfahren wir, daß er abweichend von einem andern chilenischen Papagei, der sich bis drei Meter tiefe Nisthöhlen in die Erde gräbt, in hohen Pellinbäumen brütet, durch Boeck, daß die Jungen, die man ohne besondere Mühe großziehen kann, vom Landvolk oft nach der Stadt gebracht werden. Das Fleisch ist hart und zähe. Neuerdings gelangt auch dieser Sittich nicht allzu selten lebend auf den europäischen Tiermarkt.
*
Die Keilschwanzsittiche ( Conurus) kennzeichnen sich durch starkgekrümmten, seitlich zusammengedrückten Schnabel, dessen Länge der Höhe ungefähr gleichkommt und dessen stumpf abgesetzte, schmale Firste eine seichte Rinne zeigt, kräftige Füße mit kurzen Läufen und mittellangen, durch derbe Nägel bewehrten Zehen, lange, spitze Fittiche, unter deren Schwingen die zweite und dritte die längsten sind, langen, keilförmigen, abgestuften, im wesentlichen wie bei dem Langschnabelsittich gebildeten Schwanz, sowie endlich hartes Gefieder, von dessen vorwiegend grünem Grunde sich mannigfach verschiedene Zeichnungen und Farbenfelder abheben. Die Sippe, an Arten reicher als jede andere, hat in Amerika ihre Heimat, verbreitet sich aber von der Magelhaensstraße bis zum zweiundvierzigsten Grade nördlicher Breite, obschon sie im Norden des Erdteils nur durch eine einzige Art vertreten wird. Die meisten Keilschwanzsittiche finden sich im mittleren Teil Südamerikas, insbesondere den feuchten Niederungen des Amazonenstromes und seiner Zuflüsse. Einzelne Arten verbreiten sich über weite Flächen, andere wiederum scheinen auf weniger ausgedehnte Landstrecken beschränkt zu sein.
Zu den Keilschwanzsittichen gehört der einzige Papagei, der in Nordamerika vorkommt und deswegen nach einem Teil seiner Heimat Karolinasittich genannt wurde ( Conurus carolinensis). Seine Länge beträgt zweiunddreißig, die Breite fünfundfünfzig, die Fittichlänge achtzehn, die Schwanzlänge fünfzehn Zentimeter. Hauptfärbung ist ein angenehmes dunkles Grasgrün, das wie gewöhnlich auf dem Rücken dunkler, auf der Unterseite gelblicher ist; Stirn und Wangen sind rötlichorange, und dieselbe Farbe zeigt sich auch auf dem Hinterkopf, den Schultern und Schwingen, wogegen der Nacken rein goldgelb ist. Die großen Flügeldeckfedern sind olivengrün mit gelblicher Spitze, die Schwingen dunkelgrasgrün, innen tiefpurpurschwarz, die letzten Armschwingen und die Schulterfedern in der Endhälfte olivenbräunlichgrün, die Schwanzfedern dunkelgrün, in der Nähe des Schaftes blau, innen schwärzlich graugelb gesäumt, unterseits dunkelgraugelb, außen schwärzlich. Der Augenstern ist graubraun, der Schnabel hornweißlich fahl, der Fuß gelblich fleischfarben. Der weibliche Vogel ist blasser gefärbt und der junge bis auf den orangenen Vorderkopf einfarbig grün.
Der Karolinasittich kam vormals in Nordamerika bis zum zweiundvierzigsten Grade nördlicher Breite vor und schien das dort oft recht rauhe Wetter wohl zu vertragen. Wilson versichert, höchst überrascht gewesen zu sein, während eines Schneesturmes im Februar einen Flug dieser Vögel laut schreiend längs der Ufer des Ohio dahinfliegen zu sehen. Dann und wann begegnet man einzelnen auch noch nördlicher, selbst in der Nähe Albanys. Diese Verhältnisse haben sich inzwischen sehr geändert. Schon Audubon bemerkt in seinem trefflichen Werke, das im Jahre 1831 erschien, daß der Karolinasittich ungemein rasch abnehme und in einigen Gegenden, die er fünfundzwanzig Jahre früher massenhaft bewohnte, kaum noch gefunden werde, ja daß man längs des Mississippi zur angegebenen Zeit kaum noch die Hälfte von denen beobachte, die fünfzehn Jahre früher dort gelebt hätten. Die Verminderung ist stetig weitergeschritten. »Hunderte dieser Prachtvögel«, klagt Allen, »werden in jedem Winter am oberen St. Johnsflusse von handwerksmäßigen Vogelstellern gefangen und nach den nördlichen Städten gesandt, Tausende von andern unnützerweise von Jägern getötet.« In Anbetracht dieser unnützen Schlächtereien fürchtet Boardman mit Recht, daß der Karolinasittich in kurzer Zeit gänzlich ausgerottet werden möge. Manche Jäger erlegen vierzig bis fünfzig Stück mit wenigen Schüssen, einzig und allein zu ihrem Vergnügen, indem sie die treue Anhänglichkeit der Vögel mit ihrem Tode lohnen und einen nach dem andern von denen, die zu den gefallenen herbeifliegen, herabschießen, bis der ganze Flug vernichtet ist. Ihre räuberischen Einfälle in den Feldern ziehen ihnen außerdem die Verfolgung der Landwirte zu. So kann es niemand wundernehmen, daß der Karolinasittich aus weiten Strecken der Vereinigten Staaten verschwunden ist. Glücklicherweise gibt es jedoch innerhalb des ausgedehnten Heimatgebietes unseres Sittichs immer noch Örtlichkeiten, wo er sich eines verhältnismäßig wenig angefochtenen Daseins erfreut. Noch lebt er in Florida, Illinois, Arkansas, Kansas, Nebraska, Michigan und Missouri, und noch kommt er, wie die Forschungen Haydens ergeben haben, in den dichtbewaldeten Tälern des Missourigebietes, nach Norden hin bis zum Fort Leavenworth, möglicherweise bis zur Mündung des Platte unter dem einundvierzigsten Grade im Norden vor. In den Waldungen um die großen Ströme Indianas und des östlichen Texas begegnet man ihm noch häufig; im östlichen Kansas aber ist er neuerdings nicht mehr beobachtet worden. Bevorzugte Wohnplätze von ihm sind alle Gegenden, deren reicher Boden mit einem Unkraut, Runzelklette genannt, bewachsen ist, weil dessen Kapseln ihm ungeachtet der dichten Bewaffnung mit langen Stacheln nicht unangreifbar sind und eine gesuchte Nahrung liefern. Nebenbei fällt er freilich auch massenhaft in die Pflanzungen ein und tut hier oft großen Schaden, weil er weit mehr verwüstet, als er frißt.
»Der Karolinapapagei«, erzählt Wilson, »ist ein sehr geselliger Vogel, der seinesgleichen die treueste Anhänglichkeit in Freud und Leid beweist. Wenn man unter einen Flug von ihnen schießt und einen verwundet, kehrt die Gesellschaft augenblicklich zu diesem zurück, umschwärmt ihn unter lautem, ängstlichem Geschrei, in der Absicht, ihm Hilfe zu leisten, und läßt sich auch wohl auf dem nächsten Baume davon nieder. Auch die nachfolgenden Schüsse verändern dann ihr Betragen nicht; sie scheinen vielmehr die Aufopferung der andern zu erhöhen, die immer näher und rücksichtsloser die gefallenen klagend umfliegen. Ihre Geselligkeit und gegenseitige Freundschaft zeigt sich auch oft wie bei den Unzertrennlichen: der eine putzt und kratzt den andern, und dieser erwidert dieselben Liebkosungen; das Pärchen sitzt immer dicht nebeneinander usw.
Schwerlich kann es einen auffallenderen Gegensatz geben, als den raschen Flug der Karolinapapageien, verglichen mit ihrem lahmen, unbehilflichen Gange zwischen den Zweigen und noch mehr auf dem Boden. Im Fluge ähneln sie sehr den Tauben. Sie halten sich in geschlossenen Schwärmen und stürmen mit großer Schnelligkeit unter lautem und weitschallendem, spechtartigem Geschrei dahin, gewöhnlich in einer geraden Linie, gelegentlich aber auch in sehr anmutig gewundenen Schlangenlinien, die sie, wie es scheint, zu ihrem Vergnügen plötzlich und wiederholt verändern.
Ihre Lieblingsbäume sind die großen Sykomoren und Platanen, in deren Höhlungen sie Herberge finden. Ihrer dreißig und vierzig und zuweilen, namentlich bei strenger Kälte, noch mehr, schlüpfen oft in dieselbe Höhle. Hier hängen sie sich an den Seitenwänden wie die Spechte an, indem sie sich mit den Klauen und dem Schnabel anklammern. Es scheint, daß sie viel schlafen; wenigstens ziehen sie sich oft bei Tage in ihre Höhlen zurück, um einen kurzen Mittagsschlummer zu halten.
Eigentümlich ist, daß sie gern Salz fressen. In der Nähe von Salinen sieht man sie immer in großer Anzahl, und hier bedecken sie ebensowohl den ganzen Grund wie die benachbarten Bäume manchmal in solcher Menge, daß man nichts anderes sieht als ihr glänzendes und schimmerndes Gefieder.«
In Anbetracht des regen Forschungseifers, den die nordamerikanischen Vogelkundigen betätigen, erscheint es verwunderlich, daß wir über die Fortpflanzung des Karolinasittichs noch keineswegs genügend unterrichtet sind. Nach Wilsons Erkundigungen brütet der Vogel, wie andere seinesgleichen, in Baumhöhlungen, und zwar, wie unter Papageien üblich, ohne hier ein Nest zu errichten. Aus den über das Brutgeschäft unseres Vogels im Tiergarten zu Hannover veröffentlichten Mitteilungen geht hervor, daß der Karolinasittich in einem passenden Nistkasten auf einer Unterlage von abgeklaubten Holzspänen im Juni zwei Eier legte. Der größte Durchmesser derselben beträgt zweiunddreißig, der kleinste dreißig Millimeter. Sie sind demgemäß fast kugelig, schneeweiß und ungemein stark glänzend, nach Versicherung kundiger Sammler wesentlich von denen anderer Papageien abweichend.
In den letzten Jahren wurden so viele Karolinasittiche lebend auf unsern Tiermarkt gebracht, daß ihr Preis in kurzer Zeit bis auf wenige Mark unseres Geldes herabsank. Seitdem sieht man gefangene Vögel dieser Art in allen Tiergärten und in den Käfigen vieler Liebhaber. Rey berichtet ausführlich über das Gefangenleben unsers Vogels. »Schon seit längeren Jahren«, sagt er, »halte ich neben andern Papageien auch Karolinasittiche, die sich trotz ihres allerdings nicht gerade angenehmen Geschreis und trotz ihres unersättlichen Appetits auf Fensterkreuze meine Zuneigung durch andere, höchst liebenswürdige Eigenschaften in dem Grade erworben haben, daß ich mich niemals entschließen konnte, sie abzuschaffen. Schon nach kurzer Zeit hatten sich diese Vögel so an mich gewöhnt, daß sie mir beispielsweise ohne weiteres auf die Hand oder den Kopf flogen, wenn ich ihnen eine Walnuß, die sie besonders gern fressen, vorhielt. Nahm ich dabei die Nuß so, daß sie von der Hand völlig bedeckt wurde, so blieben die Vögel ruhig auf ihrem Beobachtungsposten. Zerbrach ich aber die Nuß in der Hand, ohne sie dabei sehen zu lassen, so rief sie das dadurch entstandene Knacken sofort herbei. Später, als ich diese Papageien in einen Bauer brachte, gaben sie mir noch mehr Gelegenheit, ihre hohe geistige Begabung näher kennenzulernen. Eine ihrer gewöhnlichsten Untugenden bestand darin, das Wassergefäß, nachdem ihr Durst gestillt war, sofort um- oder zur Tür des Bauers hinaus auf die Erde zu werfen, wobei sie auf die unzweideutigste Weise ihre Freude an den Tag legten, wenn ihre Schelmerei den gewünschten Erfolg hatte, d. h. wenn das Wassergefäß dabei zerbrach. Alle Versuche, letzteres zu befestigen oder die Tür des Käfigs zuzuhalten, scheiterten an dem Scharfsinn der Vögel, so daß jede darauf bezügliche Vorrichtung sehr kurze Zeit ihrem Zwecke entsprach, weil die Papageien nur zu bald begriffen, wie der Widerstand zu beseitigen sei, und so, dank der unverdrossenen Bemühung, immer sehr schnell imstande waren, ihr Vorhaben auszuführen. Da ich auf diese Weise nichts erreichte, schlug ich einen andern Weg ein, indem ich die Vögel jedesmal, wenn ich sie bei solcher Ungezogenheit erwischte, mit Wasser bespritzte. Es gewährte einen unbeschreiblich komischen Anblick, wenn sie sich verstohlenerweise über die vorzunehmende Untat zu verständigen suchten und gemeinschaftlich vorsichtig die Schiebetür des Käfigs öffneten, indem der eine unten den Schnabel als Hebebaum einsetzt und der andere an der Decke des Käfigs hängt und die Tür mit aller Anstrengung festhält, bis sein Gefährte dieselbe von unten wiederum ein neues Stück gehoben hat. Ist dann nach kurzer Zeit die entstandene Öffnung groß genug, um den unten Beschäftigten herauszulassen, so lugt er erst mit weit vorgestrecktem Halse hervor, bis er mich an meinem Schreibtisch sitzen sieht. Hat er sich nun überzeugt, daß ich nichts bemerkte, so holt er ganz vorsichtig den Wassernapf herbei, und dieser geht dann, wenn ich nicht schnell einschreite, demselben Schicksal entgegen wie so mancher seiner Vorgänger. Habe ich sie ruhig gewähren lassen oder war ich während der Ausführung nicht zugegen, so bekunden sie durch ihr ganzes Wesen das deutliche Bewußtsein ihres begangenen Unrechts, sobald ich mich zeige.
Was mir jedoch vor allem andern diese Papageien lieb und wert macht, ist der Umstand, daß es mir geglückt ist, sie ohne Schwierigkeit an Aus- und Einfliegen zu gewöhnen. Sie treiben sich manchmal von morgens neun Uhr bis gegen Abend, wenn es anfängt zu dunkeln, im Freien umher und kommen nur dann und wann, um auszuruhen oder um Nahrung zu sich zu nehmen, in ein Fenster meines Arbeitszimmers, in dem ich ihnen eine Sitzstange angebracht habe. An einzelnen Tagen fliegen sie wenig und halten besonders um die Mittagszeit einige Stunden Ruhe. Frühmorgens unternehmen sie die weitesten Ausflüge, und des Abends, wenn sie schlafen wollen, kommen sie an ein anderes Fenster am entgegengesetzten Ende meiner Wohnung, in dessen Nähe ihr Käfig seit längerer Zeit steht. Finden sie dieses Fenster verschlossen, so erheben sie ein wahrhaft fürchterliches Geschrei oder suchen sich durch Klopfen an die Scheiben Einlaß zu verschaffen. Ist jedoch zufällig niemand in jenem Zimmer anwesend, so nehmen sie auch wohl ihren Weg durch das ersterwähnte Zimmer und durch mehrere andere, um an ihren Schlafplatz zu gelangen.
Der Flug selbst ist leicht und schön. Oft stürzen sie sich fast senkrecht von ihrem Sitz im Fenster auf die Straße hinab und fliegen dicht über dem Fenster einher, oder sie erheben sich auch wohl über die höchsten Häuser, weite Kreise beschreibend. Fliegen sie nur kurze Strecken, so ist der Flug meist flatternd, bei größeren Ausflügen, die oft zwanzig bis fünfundzwanzig Minuten dauern, mehr schwebend und pfeilschnell. Wenn sie so mit rasender Schnelligkeit am Fenster vorbeifahren und blitzschnell hart um eine Hausecke biegen oder senkrecht an einer Wand herauf- und herabfliegen, wird man sehr deutlich an den Flug unserer Edelfalken erinnert. Werden sie von andern Vögeln verfolgt, so wissen sie diese gewöhnlich durch raubvogelartige Stöße zu verscheuchen. Besonders mit den Turmseglern waren sie fast immer in Neckereien verwickelt. Ein Sperling war einmal so verblüfft über die bunten Fremdlinge, daß er längere Zeit wie gebannt den einen Papagei verfolgte, sich neben ihn setzte und die seltene Erscheinung anstarrte, als dieser zum Fenster zurückgekehrt war, auch solches Spiel mehrmals wiederholte, ohne mich zu bemerken, der ich noch mit einem andern Herrn am geöffneten Fenster stand. Unter allen langschwänzigen Papageien, die ich selbst gefangenhielt oder anderweitig in der Gefangenschaft beobachten konnte, stelle ich den Karolinasittich hinsichtlich seiner geistigen Fähigkeit obenan. Meiner Ansicht nach übertrifft er hierin sogar viele der sonst hochbegabten Kurzschwänze. Zutraulich in der Weise wie die andern Papageien, die Loris und Kakadus, wird er allerdings nie. Denn er bleibt immer ein mißtrauischer und vor allen Dingen ein sehr vorsichtiger Vogel.« Ich stimme hinsichtlich der Würdigung der geistigen Anlagen des Karolinasittichs mit Rey ziemlich überein. Daß solche Vögel mit der Zeit ebenso zahm werden wie andere ihrer Ordnung, kann für mich keinem Zweifel unterliegen. Es kommt in solchem Falle immer auf die rechte Behandlung an.
*
Zu den schönsten, anmutigsten und zierlichsten aller Papageien zählen die Edelsittiche ( Palaeornis), eine aus drossel- bis dohlengroßen Arten bestehende, der Mehrzahl nach in Südasien und sonst noch in Afrika heimische Sippe. In ihrem ziemlich harten Gefieder ist ein schönes Blattgrün die vorherrschende Färbung; von ihm aber hebt sich der lebhaft gefärbte Kopf, ein schwarzer Bartfleck und ein bunter Halsring meist ansprechend ab. Die Geschlechter unterscheiden sich nicht; die Jungen dagegen weichen stets von den Alten ab.
Wenig andere Papageisippen sind so übereinstimmend gebaut und gezeichnet wie die Edelsittiche. Sie erscheinen, um mich so auszudrücken, wie aus einem Gusse gestaltet, und die Verteilung ihrer Farben, so verschieden dieselben auch sein mögen, steht hiermit vollständig im Einklang. Aber auch die Lebensweise entspricht dieser Einhelligkeit in so hohem Grade, daß man schwerlich zuviel behauptet, wenn man sagt, daß das Tun und Treiben des einzelnen in allen wesentlichen Stücken ein Bild der Sitten und Gewohnheiten der ganzen Sippe ist. Der bekannteste Edelsittich ist der Halsband- oder Alexandersittich ( Palaeornis torquatus). Ihn brachte Onesikrit, Feldherr Alexanders des Großen, von seinem Kriegszuge nach Indien mit nach Griechenland. Der Halsbandsittich ist ein ebenso anmutig gebauter, als zarter und ansprechend gefärbter Vogel. Er gehört zu den mittelgroßen Arten seiner Abteilung; die Gesamtlänge des Männchens beträgt 35 bis 40 Zentimeter, wovon mehr als 25 Zentimeter auf den Schwanz kommen, die Länge des Fittichs vom Bug bis zur Spitze dagegen nur 15 Zentimeter. Die Färbung des Gefieders ist im allgemeinen ein sehr lebhaftes, leicht ins Gelbliche ziehendes Grasgrün, das auf dem Scheitel am frischesten, auf der Unterseite am blassesten, auf den Schwingen aber am dunkelsten ist. Zu beiden Seiten des Halses und der Wangengegend geht diese Färbung in zartes Lila- oder Himmelblau über, das durch einen dunklen, schwarzen Kehlstreifen und durch ein prächtiges rosenrotes Band von dem Grün des Halses getrennt wird. Der Augenstern ist gelblichweiß, der schmale Augenring rot, der Schnabel mit Ausnahme der dunkleren Spitze des Oberschnabels lebhaft rot, der Fuß grau. Die jungen Vögel unterscheiden sich vor der Mauser durch ihre blassere und gleichmäßigere lichtgrüne Färbung von den alten.
Unter allen Sippschaftsgenossen hat der Halsbandsittich das größte Verbreitungsgebiet; denn er kommt ebensowohl in Südasien wie in Afrika vor. Allerdings unterscheiden sich die afrikanischen Halsbandsittiche von den indischen durch etwas geringere Größe, eine mehr ins Gelbgrüne ziehende Färbung, merklich breiteren Bartstreifen, das in der Mitte unterbrochene Nackenhalsband und den deutlicher blau angeflogenen Hinterkopf; alle diese Unterschiede scheinen jedoch zur Trennung in zwei verschiedene Arten nicht auszureichen, und die Vogelkundigen stimmen darin überein, daß indische und afrikanische Vögel als gleichartig betrachtet werden müssen. Wenn man letzteres auch zugesteht, darf man doch nicht unterlassen, hervorzuheben, daß die Lebensweise des Halsbandsittichs in Indien und Afrika eine so verschiedene ist, als sie unter Edelsittichen überhaupt sein kann. Die eigentümlichen Verhältnisse beider Heimatgebiete mögen diese Abweichungen begründen und geben uns vielleicht ein lehrreiches Beispiel für die Annahme, daß ein und derselbe Vogel unter veränderten Umständen auch eine andere Lebensweise führen kann.
Innerhalb des indischen Verbreitungsgebietes gehört unser Sittich zu den häufigsten Vögeln des Landes, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, der Ebenen. Hier bevorzugt er, laut Blyth, bebaute Gegenden vor allen übrigen und ist dementsprechend der einzige indische Papagei, der die Nachbarschaft des Menschen geradezu aufsucht. Denn nicht allein in Gärten und Baumpflanzungen oder auf den die Straßen und Wege beschattenden Bäumen, sondern auch in passenden Höhlungen größerer Gebäude, in Mauerlöchern und Ritzen, siedelt er sich an, um seine Jungen zu erziehen. Hier und da lebt er fern von allen Waldungen und begnügt sich dann mit den wenigen Bäumen, die der Städter oder Dörfler der Früchte oder des Schattens halber anpflanzte. In vielen indischen Städten sieht man ihn, wie bei uns die Dohlen, auf den Dachfirsten sitzen; in andern beobachtet man, daß er einzelne Bäume, unbekümmert um das unter ihm wogende Marktgewühl, zu seinen Versammlungsorten erwählt und allabendlich zu ihnen zurückkehrt. Unter solchen Umständen kann es nicht fehlen, daß er allerorten das Besitztum des Menschen in empfindlichster Weise schädigt, und nur der Gutmütigkeit und Tierfreundlichkeit der Indier insgemein dankt er, nicht ebenso rücksichtslos verfolgt zu werden wie der Karolinasittich. Plündernd fällt er in die Fruchtgärten, zerstörend in die Getreidefelder ein. Noch ehe die Frucht gereift, klammert er sich an die Äste, um sie zu pflücken; noch ehe das Korn sich gehärtet, klaubt er es aus der Ähre; und wenn das Getreide eingeheimst ist, sucht er nach Art unserer Tauben auf dem Stoppelacker noch nach Körnern umher oder erscheint, wie der Karolinasittich, an den Feimen, um sich hier der ihm etwa noch erreichbaren Ähren zu bemächtigen. Zuweilen unternimmt er, zu großen Gesellschaften geschart, weite Raubzüge, und wenn ein solcher Schwarm einen in Frucht stehenden Baum entdeckt hat, zieht er gewiß nicht an ihm vorüber, sondern umfliegt ihn in weiten Kreisen und schwebt dann mit ausgebreiteten Schwingen und Steuerfedern auf ihn herab, und seine Früchte fallen in kürzester Frist der Vernichtung anheim. Hier und da vereinigt er sich wohl auch mit einem andern Verwandten und streift in dessen Gesellschaft im Land umher.
Anders verläuft, wie schon bemerkt, sein Leben in Afrika. Hier verbreitet er sich vom siebzehnten bis zum achten Grad nördlicher Breite über alle Länder des Innern und bewohnt daher von der Westküste an bis zum Ostrande des abessinischen Gebirges jede günstig gelegene, ihm und seinem Treiben entsprechende Waldung. Er verlangt nicht immer den ausgedehnten, ununterbrochenen Urwald, der im Inneren Afrikas alle Niederungen bedeckt, sondern findet sich oft auch in beschränkteren Waldesteilen, vorausgesetzt, daß es hier einige immergrüne Bäume gibt, deren dicklaubige Kronen ihm zu jeder Jahreszeit gesicherte Ruheorte bieten. Auffallend war mir, daß er immer nur da auftritt, wo auch Affen leben. Nach wiederholten Beobachtungen rechneten wir zuletzt mit aller Sicherheit darauf, in demselben Gebiet, in dem wir Affen getroffen hatten, Papageien zu bemerken, und umgekehrt diesen da zu begegnen, wo jene beobachtet worden waren. Große zusammenhängende Waldungen in wasserreichen Tälern bieten freilich beiden Tierarten alle Erfordernisse zu behaglichem Leben und erwünschtem Gedeihen.
Es dürfte dem Reisenden in jenen Gegenden schwer werden, die Halsbandsittiche zu übersehen. Sie verkünden sich auch dem Naturunkundigen vernehmlich genug durch ihr kreischendes Geschrei, das das Stimmengewirr der Wälder immer übertönt und um so bemerklicher wird, als auch die Sittiche regelmäßig in mehr oder minder zahlreichen Trupps leben. Eine solche Gesellschaft, die oft mit andern sich verbindet und dann zum Schwarm anwächst, hat sich einige Tamarinden oder andere dicht belaubte Bäume zum Wohnsitz auserkoren und durchstreift von hier aus tagtäglich ein größeres oder kleineres Gebiet. In den Morgenstunden sind die Vögel noch ziemlich ruhig; bald nach Sonnenaufgang aber ziehen sie schreiend und kreischend nach Nahrung aus, und man sieht dann die Schwärme eiligen Flugs über den Wald dahinstreichen. Afrikas Wälder sind verhältnismäßig noch immer arm an Baumfrüchten; aber die unter dem Schatten der Bäume wuchernde Pflanzenwelt ist reich an Sämereien aller Art, und diese locken auch die Papageien auf den Boden herab. Nur wenn die kleinen, rundlichen Früchte des Christusdorn reif oder wenn die zarten Schoten der Tamarinde genießbar geworden sind, kommen die Papageien wenig oder nicht zur Erde hernieder. Nicht unwahrscheinlich ist, daß sie auch tierische Nahrung zu sich nehmen; wenigstens habe ich sie oft in der Nähe von Ameisenhaufen oder Termitengebäuden sich beschäftigen sehen und an gefangenen eigentümliche Gelüste nach Fleischnahrung beobachtet. In den Feldern, die die Innerafrikaner am Waldesrande anlegen, sieht man sie selten, obgleich die gefangenen mit den hauptsächlichsten Getreidearten jener Gegenden, mit Kafferhirse und Durrah leicht erhalten werden können. Es scheint, daß ihnen die Früchte und Sämereien des Waldes besser munden als das Getreide. Bis gegen den Mittag hin beschäftigt sich der Schwarm mit Aufsuchen seiner Nahrung; dann fliegt er zur Tränke, und hierauf begibt er sich nach einer jener dichten Baumkronen, um hier einige Stunden zu vertreiben. Dabei wird viel geschwatzt und auch gekreischt; die Gesellschaft macht sich also bemerklich genug, ist aber demungeachtet schwer zu entdecken. Man muß sich sehr anstrengen, wenn man die grünen Vögel in dem gleichfarbigen Gelaube wahrnehmen will. Dazu kommt, daß sie augenblicklich stillschweigen, wenn sie eine ihnen auffallende Erscheinung bemerken, oder sich leise und vorsichtig davonstehlen, wenn sie Verfolgung fürchten. Nach einigen Stunden der Ruhe fliegen die Sittiche zum zweiten Male nach Speise und Trank aus; dann sammeln sie sich gegen Abend wieder auf ihren Lieblingsbäumen und erheben womöglich ein noch lebhafteres Geschrei als vorher; denn jetzt handelt es sich nicht bloß um den besten Zweig zum Ausruhen, sondern vielmehr um den sichersten Schlafplatz.
So geschickt und rasch die Papageien fliegen, so täppisch, langsam und unbeholfen bewegen sie sich auf dem flachen Boden, und auch ihr Klettern im Gezweig der Bäume ist sehr stümperhaft. Der Flug ist reißend schnell, scheint aber zu ermüden; wenigstens erfordert er viele schwirrende Flügelschläge und geht nur dann in ein leichtes Schweben über, wenn sich der Papagei eben niederlassen will. Aus reiner Lust zum Fliegen treibt sich der Halsbandsittich niemals in der Luft umher; er verbindet mit seinem Dahineilen immer einen ganz bestimmten Zweck und endet seinen Flug, sobald er glaubt, diesen erreichen zu können. Der Gang auf dem Boden ist kaum noch Gang zu nennen, sondern eher als ein Dahinwackeln zu bezeichnen; die Kletterfüße wollen zum Laufen keine rechten Dienste tun. Der Leib wird gleichsam fortgeschleppt, und der lange Schwanz muß beträchtlich erhoben werden, damit er nicht auf dem Boden nachschleift.
In Indien brütet, wie wir durch Jerdon erfahren, der Halsbandsittich in den Monaten Januar bis März; im Innern Afrikas sind die Regenmonate, die den Frühling über jene Länderstriche bringen, die Zeit der Fortpflanzung. Dort dienen, wie bemerkt, nicht allein Bäume, sondern auch allerlei Höhlungen, zumal solche in den verschiedensten Gebäuden, zur Brutstätte; hier werden ausschließlich jene benutzt. Nach dem ersten Regen hat auch die riesenhafte Adansonie ihre gewaltige Krone in den dichtesten Blätterschmuck gehüllt, und alle die zahlreichen Höhlen in den Ästen sind in wünschenswertester Weise verdeckt worden. Hier siedeln sich nun die Brutvögel an, nach den Mitteilungen, die mir gemacht wurden, ebenfalls in Gesellschaften, deren Paare nach einigem Streite um die besten Höhlungen friedlich zusammenleben. Das Gelege besteht aus drei bis vier rein weißen, etwas glänzenden Eiern, deren größter Durchmesser 28 und deren kleinster 22 Millimeter beträgt. In Afrika sieht man schon gegen Ende der Regenzeit die Alten mit ihren leicht kenntlichen Jungen, und diese Familien vereinigen sich nun wiederum bald zu größeren Schwärmen. Nach meinen an gefangenen gesammelten Beobachtungen brauchen die Jungen mindestens drei Jahre, bevor sie das Kleid, namentlich das bezeichnende rote Halsband, ihrer Eltern erhalten.
In den von mir bereisten Gegenden Mittelafrikas jagt nur der sammelnde Europäer die Halsbandsittiche mit dem Feuergewehr; der Eingeborene behelligt sie nicht mit der Waffe und fängt sie höchstens, wenn er Aussicht hat, die lebenden Papageien gut zu verwerten. Ungeachtet der Häufigkeit dieser Vögel ist es nicht gerade leicht, sie zu erlegen; ihre Schlauheit täuscht auch den geübten Jäger und vereitelt dessen Anstrengungen. Ich habe ihr listiges Gebaren später mit großem Vorteil benutzt, um sie leicht und sicher zu erlegen. Wenn ich eine Gesellschaft im Wald aufgefunden hatte, spähte ich einfach nach dem nächsten dichten, grünen Baum, stellte mich in dessen Nähe an und ließ nun durch meine Jagdgehilfen den andern Baum bedrohen. Die Folge davon war, daß die Papageien sich zurückzogen und dabei gewöhnlich mir zum Schuß kamen.
Ich habe während meines Aufenthalts in Afrika wiederholt Halsbandsittiche gefangengehalten.
Auch sie entwöhnen sich ihres gellenden, durchdringenden Geschreies und lernen ohne besondere Schwierigkeiten sprechen, erfüllen somit alle Anforderungen, die man an einen gefangenen Sittich stellen kann. Weit schöner als in Einzelhaft nehmen sie sich unter einer größeren Papageiengesellschaft aus. Hier paaren sich bald die Männchen den Weibchen an, und wenn solcher Liebesbund geschlossen ist, erwirbt sich das Pärchen jedwedes Zuneigung. Das Männchen überhäuft die Gattin mit allen Zärtlichkeiten, die Papageien gegenseitig sich erweisen, schnäbelt und atzt sie, nestelt in ihrem Gefieder, umhalst sie förmlich, biegt sich darauf zurück, lüftet die Flügel und breitet den Schwanz, das Bild des Adlers im Wappen darstellend, weist eifersüchtig jede Annäherung eines andern seines Geschlechtes oder eines Papageien zurück und hält scharfe Wacht, namentlich vor dem Eingang zu dem Nistkasten, der bald erwählt und entsprechend hergerichtet wird. Allerliebst sieht es aus, wenn die Gattin in diesem arbeitend verweilt und das Männchen durch Anklopfen mit dem Schnabel sie hervorruft, während sie mit dem Kopf zum Schlupfloch herausschaut, einen Augenblick mit ihr kost und dann, nachdem sie sich von neuem zurückgezogen, wiederum seinen Wachtposten vor dem Käfig einnimmt. Soviel mir bekannt, haben gefangene Halsbandsittiche nirgends genistet; es will dies jedoch wenig besagen, da es keinem Zweifel unterliegen kann, daß sie, wenn sie alle Bedingungen erfüllt sehen, zum Nisten schreiten werden.
Durch den sehr kräftigen, dicken, kurzen, stark abgerundeten, auch seitlich erweiterten Oberschnabel, vor dessen kurzer, breiter und stumpfer Spitze ein seichter Zahnausschnitt bemerklich ist, den hohen, auf der Dillenkante breiten und abgerundeten, vor der abgestutzten Spitze sanft ausgebuchteten Unterschnabel, die kurzen, kräftigen Füße, die langen Fittiche und den keilförmig abgestutzten Schwanz, sowie das weiche, wenig lebhaft gefärbte Gefieder kennzeichnen sich die Dickschnabelsittiche ( Bolborhynchus), kleine Arten von Star- bis Drosselgröße, die sich vorzugsweise über die Länder des westlichen, südlichen und mittleren Teiles von Südamerika verbreiten und namentlich durch ihren eigentümlichen Nestbau von allen übrigen bekannten Papageien erheblich abweichen.
Die bekannteste Art der Sippe ist der Mönchsittich ( Bolborhynchus monachus), ein Vogel von 27 Zentimeter Länge, dessen Flügel 15 und dessen Schwanz 12 Zentimeter mißt. Das Gefieder ist grasgrün, in der Mantelgegend blaß olivenbräunlich, grau verwaschen; Stirn, Vorderkopf, Zügel, Backen, Hals und Brust sind hellgrau, die Federn des Kropfes bräunlich, durch schmale, graulich fahle Endsäume, die sich zu Wellenlinien ordnen, gezeichnet, Unterbrust und Bauch einfarbig hellgrau, Unterbauch, Schenkel, Aftergegend und untere Schwanzdecken gelbgrün, die Handschwingen wie der Eckflügel indigoblau, außen grün, innen breit schwärzlich gerandet, die Deckfedern der Handschwingen und die Armschwingen, mit Ausnahme der letzten grünen, dunkler indigoblau, alle Schwingen unterseits dunkel meerblau, grünlich verwaschen, die großen Unterflügeldecken gleich gefärbt, die kleinen aber grün, die Schwanzfedern endlich innen hellgrünlich, unterseits grünlich meerblau, innen gelbgrün gerandet. Die Iris ist braun, der Schnabel gelblich-, der Fuß bräunlichgrau. Männchen und Weibchen unterscheiden sich nicht voneinander, und auch die jungen Vögel tragen nach dem Ausschlüpfen im wesentlichen das Kleid der alten.
Das Verbreitungsgebiet des Mönchsittichs scheint in den Platastaaten seinen Brennpunkt zu haben und erstreckt sich über Paraguay, Uruguay, den Argentinischen Freistaat und Bolivia, vielleicht auch über den südwestlichen Teil Brasiliens, nach Westen hin bis Matto Grosso. Über das Freileben sind eingehende Berichte noch nicht veröffentlicht worden; nur über das Brutgeschäft wissen wir mehr als von vielen andern Papageien der am besten durchforschten Gegenden Südamerikas. Aus den wenigen Angaben der Reisenden, insbesondere Renggers und Darwins, geht hervor, daß der Mönchsittich in Paraguay wie in der Banda Oriental zu den gemeinsten Vögeln zählt, außer der Brutzeit in Flügen von fünfzig bis zweihundert Stück im Land umherstreift und dann den Getreide-, zumal den Maisfeldern äußerst nachteilig wird, daher auch die rücksichtsloseste Verfolgung herausfordert. Rengger schildert diese Papageien als so zahlreich und zudringlich, daß es trotz eigener seinetwegen angestellter Wächter, die während des ganzen Tages in den Feldern auf und ab gehen müssen, nicht möglich sei, sie gänzlich zu verscheuchen. Man gebraucht daher alle Mittel, um sich der gefräßigen Diebe zu erwehren, fängt sie in erstaunlicher Anzahl und zahlt dem Fänger für jedes Dutzend Köpfe eine gewisse Summe. Wie man Darwin erzählte, wurden in einem Jahre bei Colonia del Sacramiento am La Plata nicht weniger als 2500 Stück erbeutet.
Das Fortpflanzungsgeschäft des Mönchsittichs erscheint aus dem Grund besonders beachtenswert, weil er, soviel bis jetzt bekannt, der einzige Papagei ist, der große, freistehende Nester auf Bäumen errichtet. Die erste Mitteilung hierüber rührt von Azara her, der die Nester als sehr groß, oft über einen Meter im Durchmesser haltend, oben bedeckt, innen mit Gräsern ausgepolstert beschreibt und bemerkt, daß sich oft einige auf einem Baum befinden und eines von mehreren Weibchen gemeinsam benutzt wird. Die Angabe des gewissenhaften Reisenden war für einzelne Forscher so überraschend, daß diese sich für berechtigt hielten, sie zu bezweifeln. Andere Reisende bestätigen jedoch Azaras Bericht vollständig. Darwin fand auf einer Insel des Paraná viele Nester des Mönchsittichs und eine Anzahl von ihnen so dicht zusammen, daß sie eine große Masse von Reisern bildeten. Castelnau beobachtete wie Azara, daß mehrere Weibchen in einem und demselben Nest brüten, da er in den Sümpfen von Jarayas auf ein außerordentlich großes, aus kleinen Holzstücken erbautes und mit vier bis fünf Öffnungen versehenes Nest stieß, das von einem zahlreichen Flug des in den Sümpfen häufigen und von den Bewohnern »Sumpfpapagei« genannten Sittichs bewohnt war. Auch Burmeister sah solche Nester. »In Ermangelung anderer nützlicher Beschäftigung«, sagt er in seiner Reise durch die La-Plata-Staaten, »betrachtete ich einzelne hohe, blattleere Bäume, die ich für abgestorben halten mußte, an denen große Ballen ineinander gefilzten Strauchwerkes, Stroh und Reiser hingen, und deren Ursprung und Bedeutung ich mir nicht recht erklären konnte. Denn für Vogelnester waren sie offenbar zu groß, auch zu freihängend angebracht. Aber meine Begleiter behaupteten, daß es dennoch Vogelnester seien, und zwar die Bauten des grünen Papageis mit grauer Kehle, den man im Lande ›Calita‹ nennt. Der Vogel habe die Gewohnheit, sein Nest gesellig anzulegen, und darum erschienen die Gebäude so umfangreich. Bald sah ich auch die Vögel paarweise ab- und zufliegen.«
Wir haben in der neuesten Zeit Gelegenheit gehabt, in unsern Käfigen den eigentümlichen Nestbau des Mönchsittichs zu beobachten. Schon Azara bemerkt, daß man letzteren in Südamerika gern im Gebauer halte und als einen sehr empfehlenswerten Vogel bezeichnen müsse, der seines zierlichen und gefallsüchtigen Betragens halber den ihm beigelegten Namen »Junge Witwe« verdiene, mit seinem angepaarten Genossen fortwährend in anmutigster Weise kose und sich auch leicht zur Fortpflanzung im Gebauer entschließe. Alle diese Angaben sind richtig. Schmidt war der erste, der über seine Fortpflanzung im Käfige berichten konnte. Der Mönchsittich gehörte zu denjenigen, die von dem genannten Forscher zu seinen Versuchen, Papageien im Freien zu überwintern, erwählt wurden. Das Ergebnis dieser Versuche war im allgemeinen ein befriedigendes, beziehentlich des Mönchsittichs sogar ein außerordentlich günstiges. Als die wirkliche Winterkälte begann, sah Schmidt, daß die Mönchsittiche sich trefflich gegen dieselbe zu schützen verstanden, indem sie jedesmal gegen Abend denjenigen Nistkasten des freistehenden Flugbauers zur Nachtruhe aufsuchten, dessen Flugloch von dem Wind abgewendet war, bei sehr kalten Tagen solchen Nistkasten auch nur auf kurze Zeit verließen, um die nötige Nahrung einzunehmen. Beim Eintritt des Frühjahrs prangten sie in überraschend schönem und vollständigem Gefieder, zum Beweise, daß ihnen das freie Leben in der frischen Luft trefflich bekommen war. Im April begannen sie hier und da Zweige von den im Fluggebauer freistehenden Gebüschen abzupflücken und gegen Erwartung des Beobachters in das Innere des Nistkastens zu tragen. Letzteren bauten sie innen vollständig aus und in ihm erzogen sie ihre Brut, auf die ich zurückkommen werde. Bei andern Liebhabern verfuhren sie in gleicher Weise, und fast wollte es den Anschein gewinnen, als ob auch sie Höhlungen mit Vorliebe benutzten. Da erfuhr ich durch Paare, die ich selbst pflegte, das Gegenteil, und neuerdings brütete ein anderes Pärchen im zoologischen Garten zu Berlin. Es ist dasselbe, das Mützel genau beobachtet hat. Hierüber berichtet er mir das Nachstehende.
»Das Mönchsittichpaar bewohnt einen Gesellschaftskäfig zugleich mit afrikanischen und australischen Papageien, Steindrosseln und zwei jungen Schwarzspechten. In der frei in das Zimmer ragenden Ecke des Käfigs, offenbar der für seinen Zweck am geeignetsten Stelle, begann das Paar in ungefährer Höhe von drei Meter über dem Fußboden Besenreiser durch das Gitter zu flechten. Der aufmerksame Wärter kam, als er Nistgelüste erkannte, den Vögeln sofort zu Hilfe, indem er drei Holzknüppel querüber im Drahtnetz befestigte. Die Mönchsittiche erkannten dies dankbar an und benutzten sie sofort als Grundlage ihres zukünftigen Nestes. Der Bau wurde von jetzt an eifrig weitergeführt. Das Männchen schleppte eifrig Reiser herbei, und das Weibchen ordnete sie, zunächst um die Grundfläche zu bilden, die möglichst glatt, rund und schüsselförmig hergestellt wurde. Hierauf wölbte es das Dach, und gleichzeitig damit wurde das Eingangsrohr angelegt, eine flach gedrückte, nach außen etwas gesenkte Röhre darstellend. Beides, Dach und Röhre, erschien anfänglich leicht gebaut und durchsichtig, gewann jedoch bald durch Überflechten an Haltbarkeit und Stärke. Je weiter der Bau vorschritt, um so mehr verschwand die erkennbare Form der Röhre, und das endlich fertige Nest bildete eine mächtige Stachelkugel von mehr als einem Meter Durchmesser, an der alle Reiser mit dem dicken Ende nach außen standen und nur eine wenig regelrechte Öffnung die Röhre noch andeutete.
Alle zum Nestbau erforderlichen Stoffe wurden von dem unermüdlichen Männchen herbeigetragen, und zwar indem es das aus dem Vorrate gewählte Reis mit dem Schnabel faßte und kletternd zur Baustelle trug. Das Weibchen dagegen war auf das emsigste beschäftigt, die ihm gebrachten Reiser an- und einzupassen, zu verflechten oder auch zu verwerfen.«
»Im Anfang des Mai«, so beschreibt Schmidt die Tätigkeit unseres erwähnten Paares weiter, »zog sich das Weibchen in das Nest zurück und wurde nunmehr von dem Männchen fleißig gefüttert. Es zeigte sich sehr wenig am Flugloch und kam ganz selten und dann stets nur auf einige Augenblicke heraus. Das Männchen saß den größten Teil des Tages vor dem Flugloch auf der Sitzstange und schien das Nest zu bewachen; denn es erhob, sobald es eine Störung befürchten mochte, ein ratschendes Geschrei. Am 28. Mai lag unter dem Nistkasten am Boden des Flugbauers die Hälfte einer Eischale, aus der offenbar ein junger Vogel ausgeschlüpft war; denn an der inneren Auskleidung derselben waren deutliche Gefäßbildungen sichtbar. Die Vögel verkehrten von da an sehr häufig in dem Neste; namentlich das Weibchen hielt sich viel in demselben auf, streckte aber meistens den Kopf aus dem Flugloch hervor. Von einer Beschäftigung, die mit der Aufzucht eines jungen Vogels in irgendwelcher Beziehung stand, war nichts zu bemerken. Doch glaubte ich, hierauf keinen besonderen Wert legen zu dürfen, da ich gesehen hatte, daß die Vögel ihr Tun und Treiben zu verbergen suchten, wenn sie sich beobachtet glaubten. Es kam auch nach Wochen keine Spur eines jungen Vogels zum Vorschein, und ich mußte daher wohl annehmen, daß derselbe gestorben sei, und erwartete, daß die Eltern demnächst aufs neue brüten würden.
Anfangs Juli vermißte ich einen grünen Kardinal, der mit den Papageien dasselbe Flugbauer bewohnte, und da er trotz sorgfältigen Suchens nirgends zu entdecken war, vermutete ich, daß er sich in einem der Nistkästen verkrochen haben könnte und dort gestorben sei. Der Wärter nahm daher am achten Juli einen Kasten nach dem andern herab und fand zu seiner und meiner nicht geringen Überraschung in dem Nest der Papageien einen lebenden, offenbar noch nicht lange ausgeschlüpften jungen Vogel sowie vier weiße Eier. Der junge Papagei war etwa zwei Zentimeter lang und mit dunkelgrauem Flaum besetzt, das Nest mit Gras sorgfältig ausgefüttert, das Reiserwerk der Unterlage ganz davon bedeckt. Natürlich wurden, um die Vögel ferner nicht zu stören, weitere Beobachtungen an dem Inhalt des Nestes nicht angestellt, sondern der Kasten möglichst schnell wieder an seine Stelle gebracht, und die Folge zeigte, daß die Bewegung desselben ohne Nachteil für die Brut geblieben war.
Höchst auffallend erschien hierbei, daß das Weibchen, das allein und ohne unmittelbare Hilfe des Männchens das Brutgeschäft besorgte, nicht ruhiger und ununterbrochener auf den Eiern gesessen hatte, so daß wir trotz genauer Beobachtung diesen Vorgang ganz übersehen mußten. Ich vermutete, daß der junge Vogel erst ganz kürzlich ausgeschlüpft sei, und daß von den Eiern doch wohl noch etwas zu erwarten stünde. Auch jetzt sah man die Vögel nicht füttern, da das Weibchen sich zu diesem Behufe, wenn beide sich nicht beobachtet wähnten, in das Innere des Kastens begab, während das Männchen auf der Sitzstange vor dem Flugloche Wache hielt. Bemerkten sie, daß man selbst aus größerer Entfernung nach ihnen blickte, so kam auf den Ruf des Männchens sofort das Weibchen aus dem Nest, und beide erhoben ein häßliches Geschrei, das erst aufhörte, wenn der unliebsame Späher sich zurückzog. Sie hatten quer vor das Flugloch ein ziemlich kräftiges Stückchen biegsamen Holzes gespannt, das das Weibchen jedesmal beim Verlassen des Nestes mehr gegen die Mitte der Öffnung schob, als wolle es dadurch die Kleinen verhindern, das Nest zu verlassen, oder etwaigen Feinden den Eingang erschweren. Schalen von ausgeschlüpften Eiern wurden nicht herausbefördert; kein Ton verriet die Anwesenheit eines jungen Vogels. Aber schon nach kurzer Zeit ließ sich aus der Menge der verwendeten Nahrung entnehmen, daß wohl mehrere tüchtige Fresser im Nest sein müßten. Die Alte fütterte anfänglich vorzugsweise Salat, von dem täglich zwei bis drei starke Köpfe verbraucht wurden; später nahm sie außerdem eingeweichtes Weißbrot und schließlich auch Hanfsamen.
Am 7. August sah ich zum ersten Male, daß die Mutter fütterte. Sie würgte unter nickender Bewegung des Kopfes, die sich dem ganzen Körper mitteilte, Nahrung aus dem Kropf, und obwohl sie sich mit dem größten Teil ihres Leibes in dem Nistkasten befand, glaubte ich doch wahrzunehmen, daß sie an mehreren Stellen Futter austeilte. Jedenfalls mußten die Jungen schon ziemlich groß sein, da das Weibchen ihre Schnäbel erreichen konnte, ohne in den Kasten hinabzusteigen. Am Nachmittag des 10. August ließen sich die Köpfe von zwei jungen Papageien am Flugloch des Nistkastens blicken, und am folgenden Tag flog der erste derselben aus und lief munter am Boden umher. Nach ziemlich kurzer Zeit saß er jedoch trübselig mit gesträubtem Gefieder in einer Ecke, und da die Witterung überdies regnerisch zu werden versprach, ließ ich ihn trotz des heftigen Schreiens der Eltern in den Nistkasten zurückversetzen, an dessen Flugöffnung bei dieser Gelegenheit die Köpfe von zwei weiteren Jungen zum Vorschein kamen. Erst am 15. August flog er abermals aus und diesmal in Gesellschaft eines seiner Geschwister. Man bemerkte sofort, welcher Vogel der ältere war, da er weit kräftiger und lebhafter schien als der andere, der nach kaum einer Stunde struppig wie frierend in einer Ecke hockte. Er wurde gegen Abend in das Nest zurückgesetzt, während der größere sich nach dem bedeckten Teil des Flugbauers verfügte, wo er seitdem allnächtlich seinen Aufenthalt nahm. Am achtzehnten August flog ein Junger aus; doch vermag ich nicht zu sagen, ob es der zweite war, den wir in das Nest zurückgebracht hatten, oder der dritte Bruder, der seinen ersten Spaziergang wagte. Sein Zustand war vollkommen zufriedenstellend, so daß keine Sorge für ihn erforderlich wurde. Am 20. kam der letzte aus dem Nistkasten, und zwar ebenfalls in augenblicklich gesundem und kräftigem Zustand.
Die jungen Vögel befanden sich, als sie ausgeflogen, in vollständigem Gefieder; nur hatten die Schwanz- und Steuerfedern noch nicht die Länge wie bei den Alten. Ihre Färbung war dieselbe wie bei diesen, nur das Grün weniger lebhaft, die Schwungfedern sahen mehr grün als blau aus, und die hellen Ränder der grauen Federn am Kopf und der Brust traten weniger hervor, so daß sie viel matter und einfarbiger erschienen. Der Körper hatte annähernd die Größe wie beim ausgewachsenen Vogel, der Kopf war verhältnismäßig groß, der Schnabel weniger gekrümmt. Sie waren anfänglich nicht sehr lebhaft, hockten vielmehr den größten Teil des Tages über dem Boden auf einem Baumast, der ihnen zu diesem Zwecke dorthin gelegt worden war. Wenn die Alten ihnen sich näherten, verlangten sie durch Nicken mit dem Kopf und Schlagen mit den Flügeln nach Nahrung, die ihnen in der Regel auch gereicht wurde. Die Eltern, die sich beide diesem Geschäft unterzogen, nahmen den Schnabel des Jungen, indem sie den Kopf seitwärts wendeten, so in den ihrigen, daß sie die Seite desselben faßten, worauf sie mit der geschilderten Bewegung das Futter einflößten. Die Kleinen legten dabei den Kopf in den Nacken und wiederholten die Gebärden, mit denen sie ihr Verlangen nach Nahrung auszudrücken pflegen. Nach wenigen Tagen wußten sie indes auch die Futterschüssel zu finden und selbständig zu fressen. Doch erhielten sie noch Ende August einen großen Teil ihrer Nahrung von den Eltern. Allmählich wurden sie beweglicher, und bald kletterten sie an dem Gitter des Flugbauers empor. Diese Stellung wurde von den Alten in der Regel benutzt, um das Gefieder der Kleinen in Ordnung zu bringen. Sie kletterten hinter diesen her und zogen eine Feder derselben nach der andern durch den Schnabel, um sie zu reinigen und zu glätten, ganz wie sie es mit den eigenen tun.«
*
Unter allen Papageien, die in unsern Käfigen gezüchtet werden, steht ein kleiner australischer Sittich unbedingt obenan. Schwerlich eignet sich auch ein Papagei in dem Maß zum Stubenvogel wie er. Andere Sittiche bestechen durch die Pracht ihrer Färbung, der Wellensittich, den ich meine, durch Anmut und Liebenswürdigkeit, ich möchte sagen, durch seinen Liebreiz. Schönheit besitzt auch er im hohen Grad, aber seine Liebenswürdigkeit ist größer als die Pracht seines Gefieders. Er gereicht jedem Zimmer zur Zierde und erwirbt sich bald auch das sprödeste Herz.

Wellensittiche ( Melopsittacus undulatus)
Der Wellensittich ( Melopsittacus undulatus), der allein bekannte Vertreter der Sippe der Singsittiche ( Melopsittacus), gehört zu den kleineren Papageien; doch läßt ihn der lange Schwanz größer erscheinen, als er ist. Seine Länge beträgt zwanzig bis zweiundzwanzig, seine Breite sechsundzwanzig bis siebenundzwanzig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge fast zehn Zentimeter. Seine Gestalt ist höchst zierlich, der Leib schlank, der Schnabel höher als lang, seitlich und auf der Rückenfläche abgerundet, der Oberschnabel fast senkrecht herabgebogen und in eine weit überhängende Spitze ausgezogen, vor derselben tief ausgebuchtet, der Unterschnabel so hoch wie der obere und an der Dillenkante abgerundet, der Fuß dünn, schlank, verhältnismäßig hochläufig und mit langen Zehen und Nägeln ausgerüstet, der Fittich lang und spitz, unter den Schwingen die zweite die längste, die Flügelspitze fast ebensolang wie der Oberflügel, der lange Schwanz, dessen beide Mittelfedern die andern erheblich überragen, stufig, so daß das äußerste Paar nur ein Drittel der Länge des mittelsten besitzt, das Gefieder außerordentlich weich und höchst ansprechend gezeichnet, nach dem Geschlecht kaum, nach dem Alter wenig verschieden. Stirn, Oberkopf, Zügel und die Gegend um den Unterschnabel sind schwefelgelb, seitlich begrenzt und geschmückt durch je vier hochblaue, die Spitzen verlängerter Federn einnehmende Flecke, von denen der auf den Wangen stehende der größte ist, während die drei übrigen wie runde Tüpfel erscheinen; Ohrgegend, Hinterkopf, Hinterhals, Mantel, Schultern und der größte Teil der Flügeldecken haben grünlichgelbe Färbung, jede Feder aber wird durch vier feine, schwarze Querlinien, die auf Schultern und Flügeldecken sich auf zwei verringern und verbreitern, gezeichnet; Hinterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken sowie die Unterseite vom Kinn an sind prachtvoll grasgrün, die Handschwingen und deren Deckfedern düster grün, außen schmal gelb, innen schwärzlich gesäumt, auf der Mitte mit breiten, keilförmigen, gelblichen Flecken gezeichnet, die Armschwingen außen grün, schmal gelblich gerandet, innen gelb, an der Wurzel schwärzlich, die letzten Armschwingen und die letzten Schulterfedern braunschwarz mit breiten, gelben Endsäumen, die beiden Spießfedern des Schwanzes düster dunkelblau, die übrigen Steuerfedern grünblau mit breitem, zitrongelbem Mittelfleck, der sich über beide Fahnen erstreckt, und breiten, schwarzen Säumen an der Wurzel der Innenfahne. Das Auge ist blaßgelb, der Schnabel horngelb, an der Wurzel grünlichgrau, die Wachshaut dunkelblau, der Fuß bläulichgrün. Das etwas kleinere Weibchen unterscheidet sich vom Männchen dadurch, daß die Bartflecken nicht ganz so groß sind und die Wachshaut in der Regel graugrün gefärbt ist; der junge Vogel läßt sich an seiner düsteren Färbung, verloschenen Zeichnung und der Ausdehnung der Wellenlinien über die ganze Oberseite sowie dem Fehlen der blauen Tropfenflecke erkennen; auch sind die Brustseiten dunkel quergewellt.
Shaw war der erste Naturforscher, der den Wellensittich kennenlernte und beschrieb, Gould der erste Reisende, der uns einiges über das Freileben mitteilte. Gegenwärtig wissen wir, daß der Vogel in ungeheuren Scharen das ganze innere Australien, und zwar hauptsächlich die mit Gras bewachsenen Ebenen bewohnt und sich hier von den Samen der Gräser nährt. Alle Beobachter, die ihn im Freien sahen, sind ebenso einstimmig in ihrem Lobe wie die Liebhaber, die ihn nur im Käfig beobachten konnten.
Als Gould im Anfang des Dezembers die Ebenen des Innern besuchte, sah er sich von Wellensittichen umgeben und beschloß, längere Zeit an einer und derselben Stelle zu verweilen, um ihre Sitten und Gewohnheiten zu beobachten. Sie erschienen in Flügen von zwanzig bis hundert Stück in der Nähe einer kleinen Lache, um sich zu tränken, und flogen von hier zu regelmäßigen Zeiten nach den Ebenen hinaus, um dort die Grassämereien, ihre ausschließliche Nahrung, aufzunehmen. Am häufigsten kamen sie frühmorgens und abends vor dem Dunkelwerden zum Wasser. Während der größten Tageshitze saßen sie bewegungslos unter den Blättern der Gummibäume, deren Höhlungen gerade jetzt von brütenden Paaren bewohnt wurden. Solange sie sich auf den Bäumen ruhig hielten, waren sie schwer zu entdecken; wenn sie aber zur Tränke gehen wollten, setzten sie sich frei und in Massen auf die abgestorbenen Zweige der Gummibäume oder auf die zum Wasser herniederhängenden Äste.
Ihre Bewegungen sind wundervoll. Der Flug ist gerade und reißend schnell, falken- oder schwalbenartig, dem anderer Papageien kaum ähnelnd, der Gang auf dem Boden verhältnismäßig gut, ihr Klettern im Gezweige wenigstens nicht ungeschickt. Im Fluge lassen sie eine kreischende Stimme vernehmen; im Sitzen unterhalten sie sich mit kosendem Gezwitscher, das man nur deswegen nicht Gesang nennen kann, weil die einzelnen Töne der lautgebenden Vögel mit denen unzähliger anderer sich vermischen und hierdurch ein Wirrwarr von Tönen entsteht.
Auch während der Brutzeit halten sich die Wellenpapageien in Gesellschaften zusammen, obwohl die einzelnen Paare unter diesen, ihres treuinnigen Zusammenhanges wegen, leicht zu erkennen sind. Das Nest steht in den Löchern und Spalten der Gummibäume und enthält im Dezember vier bis sechs Eier von rein weißlicher Farbe und ziemlich rundlicher Gestalt. Ende Dezember sind die Jungen gewöhnlich ausgeflogen und imstande, sich selbst zu versorgen. Sie sammeln sich dann in großen Flügen, die mit den ungepaarten Alten umherschweifen; denn diese schreiten, wenn man aus dem Benehmen der Gefangenen schließen darf, zu einer zweiten und dritten Brut.
Nach Beendigung des Brutgeschäftes treten die Scharen ihre Wanderung an. Sie ziehen regelmäßig von Süden nach Norden und kehren erst dann wieder zu ihrem Brutort zurück, wenn die Grassamen reif sind. In ganz Südaustralien erscheinen sie im Frühling, unserm Herbst also, mit gleicher Regelmäßigkeit wie unsere Zugvögel. Die Eingeborenen behaupten, daß sie sich zuweilen in Gegenden zeigen, in denen man sie früher nicht gesehen hatte, und dies ist bei ihrer Bewegungsfähigkeit recht wohl zu glauben.
Nach Mitteilung eines andern Deutschen, der viele Jahre in Australien lebte, werden die Wellensittiche gegen Abend in großen Beutelnetzen zu Hunderten und Tausenden gefangen, in rohe Kistenkäfige gesperrt und so den Händlern übermittelt. Nach Melbourne bringt man sie in unglaublicher Menge. Aufmerksamere Vogelhändler setzen sie in Australien gesellschaftsweise in kleine Käfige, deren Sitzstangen wie Treppenstufen hinter- und übereinander liegen, damit auf möglichst wenig Raum die größtmöglichste Anzahl von Vögeln Platz finden kann. Ein solches Reisegebauer gewährt ein überaus liebliches Bild. Die ganze Gesellschaft sitzt auf den Stangen in Reih und Glied, und eine Reihe Gesichter schaut über die Köpfe der andern herüber; aller Augen richten sich nach dem Beschauer, und jedes scheint um Erlösung aus der engen Haft zu bitten. Streit und Zank, wie sie bei andern Papageien so häufig vorkommen, werden bei dem Wellensittich wohl auch, aber doch immer nur ausnahmsweise beobachtet. Bis zur Brutzeit leben Tausende äußerst verträglich untereinander, und zwar die gleichen Geschlechter ebensowohl wie die Pärchen. Ich habe in London das große Zimmer eines Vogelhändlers, der eben eine neue Sendung der Wellensittiche erhalten hatte, mit mehr als tausend Paaren und große Zuchträume mit mehreren Hunderten dieser Vögel erfüllt gesehen und auch hier dieselbe Eintracht bemerkt wie im Käfig.
Der Wellensittich gehört nicht zu denjenigen Papageien, die aus Trauer über den Verlust ihres Gefährten oft dahinwelken und sterben, verlangt aber Gesellschaft und erklärlicherweise am liebsten die des entgegengesetzten Geschlechtes seiner eigenen Art. Im Notfall findet er auch in einem verschiedenartigen kleinen Papagei einen Ersatz; niemals jedoch behandelt er einen andern Vogel mit jener liebenswürdigen Zärtlichkeit, die er gegen seinesgleichen an den Tag legt. Es ist deshalb notwendig, ihn immer paarweise zu halten; erst dann gibt er seine ganze Liebenswürdigkeit kund. Sollte einer der Gatten des Paares durch irgendwelchen unglücklichen Zufall sein Leben verlieren, so ersetzt ein anderer Gefährte des betreffenden Geschlechtes den verlorenen rasch und vollständig wieder.
Ein wesentlicher Vorzug des Wellensittichs ist seine Genügsamkeit. Kein zweiter Stubenvogel verlangt so wenig Abwechslung in seinem Futter wie jener kleine Papagei. Ihm genügt ein und dieselbe Nahrung jahrelang. Wir ersetzen ihm die Grassämereien Australiens durch Hirse, Kanariensamen und Hanf; dabei befindet er sich wohl und zufrieden. Vielfache Versuche, ihn an andere Körner zu gewöhnen, haben keinen Erfolg gehabt. Dagegen nimmt er gern saftige Pflanzenblätter zu sich, vor allem Salat, Kohl, Kraut und ähnliches Grünzeug, Mäusegeschirr und dergleichen. Früchte, Zucker und andere Leckereien verschmäht er anfänglich gewiß, läßt sich jedoch nach und nach daran gewöhnen. Trotz seiner Liebhaberei für trockenes Futter trinkt er sehr wenig, zuweilen wochenlang nicht; dessenungeachtet darf man nicht versäumen, ihn fortwährend mit frischem Wasser zu versehen. Salz, Kalk und Sand gehören zu seinen unabweislichen Bedürfnissen. Es versteht sich, daß die Leichtigkeit der Erhaltung wesentlich dazu beiträgt, den Vogel beliebt zu machen.
Aber der Wellensittich versteht es, sich auch noch in anderer Weise die Zuneigung des Menschen zu erwerben. Sein Gang ist ein geschicktes, rennendes, trotz der kleinen Schritte förderndes Laufen, sein Klettern ein vollendetes Turnen, sein Flug ein köstliches, jeden Beobachter begeisterndes Durcheilen der Luft. Man muß gesehen haben, wie ein freigekommener und entfliehender Wellensittich dahinjagt, um seine volle Fluggewandtheit beurteilen zu können. Er jagt mit einem Falken um die Wette, führt die zierlichsten Wendungen, Schwenkungen und Biegungen im Fluge aus, versteht es, die größten und geringsten Entfernungen abzumessen, und läßt sich mit einem Worte nur den vollendetsten Fliegern an die Seite stellen. Erwirbt schon diese Beweglichkeit dem Vogel unsere Zuneigung, so bewahrt er sich dieselbe dauernd durch seine Stimme. Die meisten andern Papageien, selbst jene Arten, die wahre Menschenvögel genannt werden können, werden, so liebenswürdig sie sonst sind, zuweilen unerträglich durch ihre Stimme. Diejenigen unter ihnen, die sich in Worten mit ihren Pflegern unterhalten, können ihrem angeborenen Hange zum Lärmen oft nicht widerstehen, und zwischen den nachgeschwatzten Worten der menschlichen Sprache gellt das abscheuliche Kreischen hindurch. Es gibt wenige Menschen, die diese Ungezogenheit der Papageien auf die Dauer ertragen können. Ganz anders ist es bei den Wellensittichen. Auch sie haben reiche Stimmittel; aber sie verwenden diese niemals in lästiger, vielmehr in anmutender Weise. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn man behauptet, daß der männliche Wellenpapagei den Singvögeln beigezählt werden muß; denn sein Geplauder ist mehr als ein Gezwitscher; es wird zu einem, wenn auch bescheidenen, so doch recht ansprechenden Liedchen. Für mich hat der Gesang dieses Prachtvogels etwas höchst Angenehmes, und andere Tierzüchter sind nicht bloß derselben Meinung, sondern haben auch erfahren, daß der Wellensittich Lehre annimmt, die reichen Lieder anderer guter Sänger nämlich, die er hört, bald täuschend nachahmt. Einzelne haben sogar gelernt, Worte nachzusprechen.
Der Tierzüchter, der Wellensittiche paarweise hält, sie entsprechend pflegt, möglichst wenig stört und ihnen passende Nisthöhlen schafft, wird fast ausnahmslos die Freude erleben, daß sich seine Gefangenen vermehren. Geschieht dies nicht, so liegt die Schuld in der Regel am Pfleger. Am vorteilhaftesten ist es freilich, wenn man einen Schwarm dieser Vögel zusammenbringen und ihm einen größeren, womöglich freistehenden und luftigen Raum gewähren kann. Dann erregt ein Männchen das andere, die Eifersucht tut das Ihrige und läßt die Liebe eher und stärker zum Durchbruch kommen. Ein kleines Zimmer, das, ohne die Vögel zu stören, beliebig gelüftet und geheizt werden kann, dessen Fußboden mit Sand bestreut ist, und dessen Wände mit Nistkästen behangen sind, genügt allen Erfordernissen, die die bescheidenen Wellensittiche an einen Aufenthaltsort stellen. Nicht gerade nötig, aber doch sehr zu empfehlen ist, wenn der Nistbaum außerdem noch durch lebende und durchaus unschädliche Pflanzen geziert werden kann; denn diese bieten der munteren Schar geeignete Orte zum Ruhen und Versteckspielen. Eine dauernde Annehmlichkeit bietet man den Vögeln dadurch freilich nicht. Denn sie verwüsten, wie alle Papageien, grüne Zweige oder Gewächse in kürzester Frist. Allein solche sind ihrem Wohlbefinden entschieden förderlich, und man tut deshalb wohl, ihnen zu bieten, was man im Sommer leicht und ohne Schaden gewähren darf. Ein Bündel frisch abgeschnittener Weiden- oder sonstiger Baumzweige überhaupt wird mit ersichtlicher Befriedigung, um nicht zu sagen, dankbar angenommen und binnen kürzester Frist entblättert und entschält. Dabei fressen die Vögel Knospen, Blatt und Schalenteile und verschaffen sich so eine unbedingt zuträgliche Abwechslung in dem Einerlei ihrer täglichen Nahrung. Selbst im Winter kann man ihnen solche Annehmlichkeit verschaffen; denn auch entblätterte Zweige behagen ihnen sehr. Noch mehr lieben sie unreife Ähren unserer Getreidearten, vor allem Hafer, solange die Körner noch milchig sind. Schneidet man ihnen davon ein Büschel ab, so stürzen sie sich mit wahrer Gier auf dasselbe und verlassen es nicht, bevor das letzte Korn ausgeklaubt und verzehrt worden ist. Zu den Nisthöhlen eignen sich am besten hohle Weidenbäume, deren inneren Raum man an mehreren Stellen durch Bretter abgetrennt hat, um das ganze Stück für mehrere Paare bewohnbar zu machen. Es genügt aber auch schon ein gewöhnlicher Nistkasten mit entsprechend engem Loch, der dem brütenden Weibchen erwünschte Sicherheit vortäuscht. Da sie nach Art der meisten Papageien überhaupt ihre Eier einfach auf den Boden legen, empfiehlt es sich, solchen seicht auszuhöhlen und mit grobem Sägemehl zu bestreuen. Sie sorgen dann selbst für Herstellung einer geeigneten Mulde, indem sie nach eigenem Belieben so viel von dem Sägemehl aus dem Kasten werfen, als ihnen erforderlich erscheint. Ein derartig ausgerüstetes Brutzimmer liefert die günstigsten Ergebnisse; doch genügt in den meisten Fällen auch schon ein mittelgroßer Bauer. Wer es über sich gewinnen kann, Wellensittiche im Zimmer frei umherfliegen zu lassen, kann einer besonderen Vogelstube gänzlich entbehren.
Man muß selbst die liebenswürdigen Tiere gepflegt und ihre Fortpflanzung beobachtet haben, um die Begeisterung verstehen zu können, mit der alle wahren Liebhaber von ihnen sprechen. Je länger man sie kennt, um so mehr gewinnt man sie lieb. Die Beobachtung ihres Treibens und Lebens, ihrer Sitten und Gewohnheiten ist eine unversiegliche Quelle von Vergnügen und Genuß. Während der Paarungszeit wird eigentlich ihre ganze Liebenswürdigkeit erst kund und offenbar. Alles, was man von der Zierlichkeit und Anmut, der Liebenswürdigkeit, gegenseitigen Anhänglichkeit und Hingebung der Zwergpapageien sagen kann, gilt, und wohl in noch reicherem Maße, auch für die Wellensittiche. Das gegenseitige Benehmen beider Gatten ist das anmutigste, das man sehen kann. Jeder beeifert sich in ersichtlicher Weise, dem andern zu Gefallen zu leben; insbesondere das werbende Männchen zeigt sich dem selten versagenden Weibchen gegenüber äußerst liebenswürdig. »Immer begehrlich«, sagt ein Liebhaber, »erzwingt es doch niemals seinen Willen wie andere Vögel, durch Verfolgung des Weibchens bis zu dessen Ermattung. Den Abweisungen der Gattin fügt es sich achtungsvoll und harrt geduldig, bis sich dieses seinen Zärtlichkeiten und Wünschen aus freiem Antrieb ergibt. Die Begattung selbst erinnert in ihrer Innigkeit an das Märchen der Alten von Leda und dem Schwan. Das Weibchen, den Kopf nach dem Männchen zurückgebogen und von demselben Schnabel in Schnabel erfaßt und mit seinen langen Schwingen umschlungen, empfängt seinen Eindruck in nachhaltiger Lust. In der Fütterung des Weibchens und in seiner Zärtlichkeit gegen dasselbe, wenn es auf Augenblicke die Nisthöhle verläßt, ist es unerschöpflich; aber freilich kommt seiner Zärtlichkeit auch seine Eifersucht gleich.«
Der Ausbau des Nestes ist ausschließlich Sache des Weibchens. Es arbeitet mit dem Schnabel so lange an dem Eingangsloch, bis dieses seinen Wünschen entspricht, nagt dann im Inneren größere oder kleinere Spänchen los und legt auf sie in Zwischenräumen von zwei Tagen seine vier bis acht kleinen, rundlichen, glänzend weißen Eier, die das Gelege bilden. Dann brütet es sehr eifrig sechzehn bis zwanzig Tage, und während der ganzen Zeit wird es von dem Männchen gefüttert, verläßt deshalb auch nur seine Nisthöhle, um den dringlichsten Bedürfnissen zu genügen. Die Jungen, die etwa dreißig bis fünfunddreißig Tage im Nest verweilen, verlassen letzteres erst dann, wenn sie ganz befiedert sind. Während der ganzen Zeit ist das Weibchen eifrig bemüht, das Nest rein zu halten; es kehrt wie eine ordentliche Hausfrau jeden Morgen sein Zimmer aus und putzt und reinigt seine Kinder mit unvergleichlicher Sorgfalt. Sofort nach dem Ausfliegen gehen die Jungen ans Futter, und wenige Tage später benehmen sie sich ganz wie die Alten; doch muß man um die Zeit des Ausfliegens eine gewisse Vorsicht anwenden, namentlich wenn man nur ein Paar Brutvögel im Käfig hat; denn die erwähnte Eifersucht des Vaters macht sich dann oft in unbegreiflicher Weise geltend. Derselbe Vogel, der seine Brut mit hingebender Zärtlichkeit fütterte, fällt zuweilen über die flügge gewordenen Kinder wütend her, greift sie mörderisch an und verletzt sie nicht selten so, daß sie infolge der jetzigen Lieblosigkeit zugrunde gehen. Noch unfreundlicher als die Männchen zeigen sich einzelne Weibchen, allerdings nicht gegen ihre eigenen, so doch ihresgleichen Kinder. Solche dürfen selbstverständlich nicht unter der Gesellschaft geduldet, sondern müssen sobald als möglich herausgefangen und verbannt werden.
Sofort, nachdem die erste Brut selbständig geworden ist, schreiten die Alten zu einer zweiten, und wenn diese ausgeflogen, gewöhnlich zu einer dritten und vierten; ja, Franz Schlegel, Vorsteher des Tiergartens zu Breslau, hat beobachtet, daß ein Paar ein volles Jahr lang ununterbrochen brütete! Solche Fälle gehören zu den Ausnahmen; zwei Bruten nacheinander aber scheinen nach meinen Erfahrungen Regel zu sein. Die letzten Jungen aber kann man ohne Sorge mit den Alten zusammenlassen, und dann darf man auch in den Käfig wieder die ersten Jungen einbringen. Diese zeigen sich gleich von Anfang an ebenso liebenswürdig wie die Eltern. Sie haben eine wahre Sucht, ihre jüngeren Geschwister zu pflegen, und füttern diese trotz der Alten. Dabei äffen sie sich gegenseitig alles nach; was der eine tut, unternimmt auch der andere, im Klettern, Fliegen, Fressen und Schwatzen. Der Lärm in solchen Kinderzimmern wird oft betäubend und manchmal selbst den Alten zu toll, die sich dann bemühen, ihm aus dem Weg zu gehen; und wenn nun erst ein ganzer Schwarm zusammengehalten wird, wenn vielleicht zehn Elternpaare zu gleicher Zeit Junge ausbrüten und in die Welt schicken, geht es meist lustig und erregt her. Dann wird auch der Frieden selten gestört; denn die Vorsicht des Männchens kommt kaum oder nicht zur Geltung, wahrscheinlich weil sie sich nicht auf einen Gegenstand richten kann, sondern auf Hunderte richten müßte.
Wie notwendig es ist, Wellensittiche paarweise zusammenzuhalten, sieht man erst dann, wenn man längere Zeit zwei desselben Geschlechtes gepflegt hat. Wird zu solchen ein Genosse des andern Geschlechtes gebracht, so gibt es augenblicklich ein Pärchen und brennende Eifersucht. Neubert, der zwei Paar Wellenpapageien besaß, verlor beide Männchen und erhielt erst nach geraumer Zeit Ersatz für eines von ihnen. Die beiden Witwen hatten sich recht hübsch zusammengefunden; sie waren munter und lebten gemütlich miteinander, als ob sie Männchen und Weibchen wären. Als aber das neue Männchen in den Bauer gebracht wurde, änderte sich dieses schöne Verhältnis augenblicklich. »Die beiden Weibchen«, erzählt er, »saßen in der Höhe des Käfigs dicht beisammen, als das Männchen hineinflog, und beobachteten dasselbe sehr aufmerksam. Nach wenigen Augenblicken sah es zu ihnen empor, rührte sich aber nicht von der Stelle und gab einen eigentümlichen Lockton von sich, der von dem einen Weibchen beantwortet wurde. Als es den Lockton wiederholte, schoß das antwortende Weibchen herab, und es gab jetzt eine Szene wie nach lang erwarteter Heimkehr. Das andere Weibchen sah ganz ruhig zu; als aber das Liebespärchen nach oben und in die Nähe der Witwe kam, da wurde diese fast rasend, fuhr auf die beglückte Braut los, hing sich ihr an den Schwanz und zerrte solange daran, bis die Federn ausgingen. Nun war es Zeit einzuschreiten. Sie wurden auseinandergetrieben, die Xantippe gefangen und von ihrem neuen Herrn, der sie vermählen wollte, mitgenommen.
Zum Schluß will ich noch anführen, daß Wellenpapageien sich auch bei uns im Freien erhalten können. Auf dem Gut eines bedeutenden Tierliebhabers in Belgien entflogen im Frühling des Jahres 1861 zwei Paar Wellenpapageien aus einem Bauer. Sie verloren sich alsbald in den Baumwipfeln einer großen Parkanlage und wurden längere Zeit gar nicht oder nur sehr flüchtig gesehen. Doch blieben sie in ihrem Gebiet wohnen, und wie sich später ergab, hatten sie hier sogar in Baumhöhlen genistet und eine Anzahl Junge erzogen. Der Besitzer überraschte im Herbst einen ganzen Flug von zehn bis zwölf Stück in einem Haferfeld, woselbst sie sich gütlich taten. Von nun an wurden die Vögel durch vorsichtiges Füttern allgemach herbeigelockt und vor Eintritt des Winters zehn Stück von ihnen gefangen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß Wellensittiche in unserm Klima vortrefflich gedeihen würden, und es erklärt sich daher, daß von dieser und jener Seite vorgeschlagen worden ist, ihre Einbürgerung bei uns zu Land zu versuchen. Was aber würden wir damit gewinnen? Angenommen auch, daß die an das Wandern gewöhnten Vögel in einem ihnen sozusagen angewiesenen Gebiet während des Winters verbleiben und nicht, was wahrscheinlicher ist, davon- und dem Süden zufliegen würden; angenommen ferner, daß die »erbärmlichen Flinten«, die Buxtons Versuchen so hinderlich wurden, bei uns zu Lande nicht in Wirksamkeit treten sollten; würden wir in dem Wellensittich einen zwar sehr schönen, aber auch recht schädlichen Vogel uns erwerben und damit in noch höherem Grad als bisher das unverständige Geschrei unerfahrener Vielschreiber über schädliche und nützliche Vögel herausfordern.
*
Die artenreichste Papageisippe, die in Neuholland und Ozeanien überhaupt heimisch ist, umfaßt die Plattschweifsittiche ( Platycercus), mehr oder minder prachtvoll gefärbte Arten von Drossel- bis Krähengröße. Ihre Merkmale liegen in dem kurzen, kräftigen Schnabel, der fast immer höher als lang ist, dem fast immer sehr langen, stufenförmigen Schwanz, der aus auffallend breiten, an der Spitze zugerundeten Federn besteht, sowie endlich dem weichen, in der Regel sehr bunten, ausnahmsweise auch nur grün und rot gefärbten Gefieder. Die Plattschweifsittiche, etwa vierzig an der Zahl, vertreten in Australien und auf den übrigen zu ihrem Verbreitungsgebiete gehörigen Eilanden die Edelsittiche Indiens und Afrikas. Als bemerkenswert hebt Finsch die Tatsache hervor, daß sie da fehlen, wo Edelsittiche vorkommen, und ihr Verbreitungsgebiet erst dort beginnt, wo das jener aufhört.
Einer der bekanntesten Vertreter der Sippe ist die Rosella ( Platycercus eximius), ein Vogel von der Größe einer großen Drossel oder etwa zweiunddreißig Zentimeter Länge. Kopf, Kehle und Brust sowie die unteren Schwanzdecken sind lebhaft scharlachrot, die Federn an der Wurzel gelb, die des Hinterhalses, der Halsseiten, des Mantels und der Schultern schwarz, breit blaßgelb umsäumt, die der Unterbrust hochgelb, der Brustseiten gelb mit schwarzem Mittelfleck, die des Bauches, der Schenkel, des Bürzels und die oberen Schwanzdecken schön hellgrün, gelblich verwaschen, die Schwingen schwarzbraun, außen dunkelblau, die Handschwingen prachtvoll lilablau, die letzten drei bis vier Armschwingen außen breit hellgrün gerandet, alle unterseits grauschwarz, die beiden mittelsten Schwanzfedern dunkel olivengrün, gegen die Spitze zu bläulichgrün, die übrigen in der Wurzelhälfte tiefblau, in der Endhälfte hell lilablau, an der Spitze weiß. Das Weibchen unterscheidet sich nicht erheblich vom Männchen. Neusüdwales und Tasmanien sind die Heimat dieses lieblichen Sittichs. Hier ist er einer der gemeinsten Vögel, lebt jedoch in ganz bestimmten Gegenden, die oft durch einen Bach, über den er kaum oder nicht hinausgeht, begrenzt sein können. Zahlreiche Schwärme bildet er nicht; dafür aber trifft man ihn familien- oder gesellschaftsweise überall. Lieblingsplätze von ihm sind offene Gegenden, die wellenförmigen, grasigen Hügel und Ebenen, die hier und da mit hohen Bäumen oder Buschgruppen bestanden sind. Auf den Straßen ist er ebenso regelmäßig zu finden wie unser Sperling, fliegt auch, aufgescheucht, nur auf den nächsten Baum am Wege und kehrt bald wieder auf den Boden zurück. Die Reisenden versichern, daß der Eindruck, den solcher Prachtvogel unter solchen Umständen auf den Nordländer macht, nicht zu schildern sei.
Die Rosella fliegt mit raschen Flügelschlägen in wellenförmigen Linien dahin, selten aber weit; denn, wie es scheint, ermüdet sie bald. Um so geschickter bewegt sie sich auf dem Boden, woselbst sie einem Finken wenig oder nichts an Gewandtheit nachgibt. Ihre Stimme ist wie bei den meisten Verwandten ein recht angenehmes Pfeifen, das man fast Gesang nennen möchte. Die Nahrung besteht aus Samen verschiedenster Art, namentlich aber Grassämereien; gelegentlich soll sie auch Kerbtiere fangen. Die Brutzeit fällt in die Monate Oktober und Januar, die unserm Frühling entsprechen. Das Weibchen legt sieben bis zehn schöne, weiße, längliche Eier in die Asthöhle eines Gummi- oder ähnlichen Baumes.
Auf unserm Tiermarkt zählt die Rosella zu den häufigeren Arten ihrer Sippe, hat sich auch hier und da in Europa fortgepflanzt. Im übrigen hält sie sich nicht gut in der Gefangenschaft.
*
In der letzten Unterfamilie vereinigen wir die Loris oder Pinselzungenpapageien ( Trichoglossinae), eine besonders durch ihre bewimperte Zungenspitze ausgezeichnete Gruppe. Dem seitlich zusammengedrückten Schnabel, dessen Dillenkante schief aufsteigt, fehlen die für andere Papageien so bezeichnenden Feilkerben vor der Spitze des Oberschnabels. Das Verbreitungsgebiet der Loris beschränkt sich auf Australien, die zu ihm gehörigen Eilande und das Indische Inselmeer mit Ausschluß der Sundainseln und Polynesien. Über ihr Freileben ist noch wenig bekannt; so viel aber wissen wir, daß alle Arten wenigstens zeitweilig von Blütensaft sich ernähren, daher mehr als andere Papageien an die Bäume gebunden sind.
Unter den drei Sippen, in die Finsch die Unterfamilie verteilt, stehen die Breitschwanzloris ( Domicella), schlank gebaute Papageien von Sperlings- bis Dohlengröße, obenan. Als Vertreter der Gruppe mag eine der uns am längsten bekannten Arten dienen, die ich Erzlori genannt habe ( Domicella atricapilla). Im Gefieder herrscht ein prachtvolles Scharlachrot vor; Stirn und Schulter sind tiefschwarz, gegen den Hinterkopf zu dunkelviolett; ein breites Schild auf dem Kropfe, das sich zuweilen bis zur Brust herabzieht, hat lebhaft hochgelbe Färbung. Der Flügelbug ist blau, jede Feder mit weißlichem Endsaum geziert; die Flügel sind dunkelgrasgrün, in der Schultergegend olivengelbbräunlich verwaschen, die Handschwingen erster Ordnung innen schwefelgelb und nur im Spitzendrittel schwarz, die Armschwinge, mit Ausnahme der zwei letzten grünen, innen ganz gelb, die kleinen Unterflügeldeckfedern wie die Befiederung des Unterschenkels kornblumenblau. Um den Stern zieht sich ein schmaler gelber Ring, die übrige Iris ist braun, der Schnabel hochorange, der Fuß grauschwarz. Beide Geschlechter gleichen sich in der Färbung; bei jüngeren Vögeln ist diese im allgemeinen düsterer. Die Federn des Oberrückens sind in der Wurzelhälfte grün, und der gelbe Brustschild fehlt. Laut Rosenberg kommen Farbenabweichungen nicht selten vor. So kann die Kopfplatte rosenrot und der Flügel gelb sein. Infolgedessen sind die Artabgrenzungen hier sehr unsicher. Unsere Farbentafel stellt eine dem Erzlori sehr nahe verwandte Domicella vor, den sog. Gelbmantellori ( Domicella garrula). Herausgeber.
Ich verdanke der Güte des eben genannten Forschers die nachstehenden Angaben über das bis dahin gänzlich unbekannte Freileben des Erzlori: »Der schöne Vogel bewohnt ausschließlich Ceram und Amboina und wird ebensowenig wie ein anderer seines Geschlechtes auf Borneo oder auf dem Festlande gefunden. In seiner Heimat tritt er häufig auf. Er lebt ebensowohl in der Einsamkeit des Waldes wie in der Nähe der menschlichen Wohnungen; in den Gebirgen Cerams beobachtete ich ihn jedoch, meines Wissens, nie. In kleinen Familien raschen Fluges von Ort zu Ort schweifend, sah ich ihn öfters über die Stadt Amboina dahinstreichen, die zierlichsten Schwenkungen in der Luft beschreiben, wobei sein Geschrei und das prächtige, in der Sonne flimmernde Gefieder ihm zum Verräter wurden. Seine Nahrung besteht außer in Pflanzenhonig in weichen Baumfrüchten, zumal denen des Pisang. Das Nest steht in Baumhöhlen; die Eier sind, wie bei allen Papageien, glänzend weiß und etwas größer als die unserer Schwarzdrossel.
»Auf Amboina findet man keinen Vogel häufiger in der Gefangenschaft als gerade den Erzlori, und in der Stadt gibt es kaum ein Haus, kaum eine Hütte, in welcher er fehlt. Er ist der Lieblingsvogel der Amboinesen und verdient es auch zu sein, ebensowohl was seine Schönheit und Sanftmut als seine Gelehrigkeit anlangt. Er lernt ziemlich rasch sprechen und ist dann der Stolz seines Pflegers. Unter dem Preise von acht bis zehn Gulden holländisch ist solch ein gelehrter Vogel, der außerdem für anderthalb bis zwei Gulden feilgeboten wird, nicht zu bekommen. Freilich gibt es auch störrische und heimtückische Erzloris. Man füttert sie mit rohem und gekochtem Reis, in Wasser geweichtem Sago und Pisangfrüchten, gibt ihnen auch täglich frisches Wasser, da sie viel trinken und zumal gern baden, wobei sie sich das Gefieder über und über bespritzen. Auch bei ihnen ist der Ruf ›Lori‹ ein angelernter.«
In unsere Käfige gelangt der Erzlori nicht allzu selten, und ich habe daher mehrfach Gelegenheit gehabt, ihn und andere seiner Sippe zu pflegen oder doch zu beobachten. Die Loris machen den Eindruck munterer, lebhafter, geweckter und kluger Vögel. Sie sind rege vom Morgen bis zum Abend, lebendig und leiblich wie geistig beweglich. Alles, was in ihrem Bereiche sich zuträgt, erregt ihre Aufmerksamkeit, und sie findet dann in heftigem Nicken mit dem Kopfe beredten Ausdruck. Ihre Bewegungen sind ebenso rasch als gewandt und noch besonders dadurch ausgezeichnet, daß sie sich oft zu weiten Sprüngen entschließen. Bei guter Laune gefallen auch sie sich in förmlichen Tänzen, welche sie auf ihren Sitzstangen ausführen. Ihre Stimme ist sehr laut und in hohem Ton unangenehm kreischend. Sie lautet, wie Linden nach längerer Beobachtung feststellte, wie ein scharf ausgesprochenes »Wihe wihe wi wi« und wird mit Pfeifen, Schnurren und Schnalzen eigentümlichster Art begleitet. Alle Kurzschweifloris, welche wir in Gefangenschaft beobachten konnten, sind nichts weniger als verträglich, vielmehr in hohem Grade streitlustig. Ein von mir gepflegter Erzlori begann mit den verschiedenartigsten Genossen seines großen Käfigs Streit, versetzte dieselben durch eigentümliche Kopfbeugungen, abwechselndes Ausbreiten und Zusammenziehen der Federn, Sträuben der Kopffedern und vorschnellende Bewegungen in die größte Aufregung oder den heftigsten Zorn, flog dann scheinbar befriedigt weg, um sich mit dem einen oder dem andern Vogel zu beschäftigen, kehrte aber immer wieder zu dem einen ins Auge gefaßten Gegner zurück. Alle schwächeren Vögel hatte er binnen kurzer Frist unterjocht. Bei ihren Angriffen gehen sie anders zu Werke als ihre Ordnungsgenossen. Sie packen sich mit den Krallen, womöglich am Kopf und am Schnabel, und gebrauchen den letzteren nur gelegentlich, anscheinend bloß zur Abwehr. Ihrem Pfleger gegenüber bekunden sie Zu- oder Abneigung, je nachdem. Einzelne kommen schon als vollkommen gezähmte Vögel in unsern Besitz und sind dann die liebenswürdigsten Gesellen unter der Sonne, lassen sich berühren, streicheln, auf die Hand nehmen, im Zimmer herumtragen, ohne jemals ihren Schnabel zu gebrauchen; andere sind unliebenswürdig und bissig. Jedenfalls aber hat Linden vollständig recht, wenn er sagt, daß sie insgemein in bezug auf Verstand, Zähmbarkeit und Dauerhaftigkeit weit über ihren nächsten Verwandten, den Keilschwanzloris, stehen.
Bei geeigneter Pflege dauern die Breitschwanzloris recht gut im Käfig aus; es ist aber nicht allzu leicht, ihnen solche Pflege angedeihen zu lassen. Vor allem verlangen sie einen warmen Raum und sodann geeignetes Futter. Mit gekochtem Reis, Möhren und andern Früchten, nebenbei auch verschiedenen Sämereien und Milchbrot, befriedigt man die Bedürfnisse einzelner, aber nicht aller, und ein kleiner Fehler, ein gutgemeinter Versuch, ihnen eine Leckerei zu bieten, kann für sie verhängnisvoll werden. So erfuhr Linden, daß seine gefangenen Loris schwarze Kirschen mit Behagen verzehrten und dabei gediehen, unmittelbar nach dem Genusse von Brombeeren aber starben. Eine Hauptbedingung ihres Wohlbefindens ist, ihnen jederzeit Gelegenheit zum Baden zu geben. Sie gehören zu den wasserbedürftigsten Arten ihrer ganzen Ordnung und baden sich, wenn nicht täglich, so doch sicher einen Tag um den andern. Hierbei legen sie sich jedoch nicht in das Wasser, wie andere Papageien zu tun pflegen, sondern setzen sich einfach in den Badenapf und nässen sich Rücken, Brust, Bauch, Flügel und Schwanz, nicht aber den Kopf, durch Schlagen mit den Schwingen und Steuerfedern vollständig ein, trocknen sich hierauf ihr Gefieder und bekunden sodann durch erhöhte Beweglichkeit, wie behaglich sie sich fühlen. »Eigentümlich ist«, schreibt mir Linden, »daß sie auf dem Boden des Käfigs schlafen und in einer Ecke sich ganz platt niederlegen. Ihr Schlaf ist sehr leise und wird, wie sie durch Pfeifen bekunden, durch das unbedeutendste Geräusch, selbst durch jeden Fußtritt außerhalb ihrer Behausung, unterbrochen.«
*
Die Keilschwanzloris ( Trichoglossus), die die zweite Sippe bilden, sind schlank gebaute Arten von Sperlings- bis Taubengröße. Ihr Verbreitungsgebiet fällt beinahe mit dem Wohnkreise der Plattschweifsittiche zusammen, erstreckt sich jedoch etwas weiter nach Westen hin. Das Festland Australiens bildet den Brennpunkt desselben; doch erreicht es bereits in Vandiemensland seine südliche Grenze, wogegen die nördliche auf den Molukkeneilanden Halmahera und Morotai zu suchen ist. Unter den Südseeinseln werden nur Neukaledonien, die Neuen Hebriden und Salomonsinseln von Keilschwanzloris bevölkert; dagegen verbreiten sich diese in westlicher Richtung noch bis Sumbawa und Flores.
Am häufigsten sieht man in unsern Käfigen wohl den Allfarblori ( Trichoglossus novae-hollandiae), eine der größten Arten der Sippe, die dem Karolinasittich ungefähr gleichkommt. Kopf, Backen und Kehle sind lilablau, Hinterhals, Mantel, Bürzel und Schwanz dunkel grasgrün, die Federn des Oberrückens in der Mitte gelb, an der Wurzel rot, die des Nackens, die ein verwaschenes Halsband bilden, gelbgrün, Kropf, Brust und untere Flügeldecken schön zinnoberrot, unregelmäßig und breit dunkler und lichter quergewellt, die Brustseiten hochgelb, die Bauchfedern dunkelblau, an der Wurzel rot, die der Bauchseiten rot mit blauem Endfleck, Schenkel, Schienbein, Aftergegend und untere Schwanzdeckfedern grasgrün, die Federn an der Wurzel rot, hierauf gelb und endlich an der Spitze grün, die Schwingen innen schwarz, in der Mitte durch einen breiten, gelben Fleck gezeichnet, die Schwanzfedern innen zitronengelb, gegen die Wurzel hin etwas ins Rote spielend. Die Iris ist orangerot, der Schnabel blutrot, die Wachshaut dunkelbraun, der Fuß braunfahl.
Obgleich Gould nur Südaustralien als Heimat des Allfarbloris angibt, verbreitet sich derselbe doch, wie neuerdings erwiesen worden ist, über ganz Australien und kommt ebenso auf Vandiemensland vor. Hier lebt der prachtvolle Vogel in Menge, weil die Blüten der gedachten Bäume ihm überflüssige Nahrung bieten. Er ist aber auch so ausschließlich auf die Gummiwälder beschränkt, daß er in andern gar nicht gesehen wird. Diejenigen Bäume, die erst kürzlich ihre Blüten geöffnet haben, werden allen andern vorgezogen, weil sie an Honig und Blütenstaub am reichsten sind. Der Anblick eines Waldes dieser blütenbedeckten Gummibäume, auf denen sich außerdem noch mehrere Arten der gedachten Papageien und Honigvögel umhertreiben, ist nicht mit Worten zu beschreiben. Oft sieht man drei bis vier Arten der Sippe auf einem und demselben Baume beschäftigt und manchmal gemeinschaftlich die Blüten eines und desselben Zweiges berauben. Noch weniger ist es möglich, die tausendstimmig lärmenden Töne und die Schreie mittendurch zu beschreiben, wenn etwa ein Flug sich mit einem Male von einem Baum erhebt, um in einen andern Teil des Waldes überzugehen. Solche Schwärme muß man selbst gesehen und gehört haben, wenn man sich eine klare Vorstellung machen will.
Über das Fortpflanzungsgeschäft vermochte Gould eigene Beobachtungen nicht zu sammeln, erfuhr jedoch durch die Eingeborenen, daß der Allfarblori zwei Eier in Höhlungen der höchsten Gummibäume lege und vom Juli bis September brüte. Daß diese Angabe schwerlich begründet sein dürfte, lassen gefangene Vögel derselben Art, die sechs Eier legten, glaublich erscheinen.
Calay glaubt, daß der Allfarblori ausschließlich vom Blumensaft sich ernähre, auch in Gefangenschaft niemals Sämereien verzehre und deshalb schwierig zu erhalten sei. Diese Angabe ist unbedingt falsch; denn neuerdings gelangt, wie bereits bemerkt, gerade dieser Keilschwanzlori häufiger als jeder andere und in immer steigender Anzahl in unsere Käfige. »Ich erhielt«, schreibt mir Linden, »eines der ersten Paare mit der Weisung zugeschickt, nur Glanz und Wasser zu füttern. Ich befolgte dies anfänglich auch. Als ich aber sah, daß das Futter kaum berührt wurde, gab ich noch Früchte, die begierig genommen wurden; die Folge war jedoch, daß wenige Tage später beide Vögel unter furchtbaren Krämpfen zugrunde gingen. Ein zweites Paar, das ich erwarb und hauptsächlich mit in Milch eingeweichtem Weißbrot fütterte, hielt länger aus, starb aber unter gleichen Erscheinungen. Die Zergliederung ergab weder in dem ersten noch in dem zweiten Fall irgendeinen Anhaltspunkt für Aufklärung der Todesursache. Andere pflegte ich mit wechselndem Glück, muß mich im allgemeinen aber dahin entscheiden, daß die Vögel zu denjenigen gehören, die schwer zu halten sind.« Nach meinen allerdings nicht weit reichenden Erfahrungen muß ich Linden darin beistimmen; doch gibt es Ausnahmen. So schreibt mir Staatsminister Geßler, daß er einen Allfarblori fünf Jahre lang bei bestem Wohlsein erhalten habe, was letzterer unter anderm dadurch betätigte, daß er sechs Eier legte. Gefüttert wurde dieser Vogel mit Glanz, geriebenem magerem Ochsenfleisch, geriebenen Möhren und Zucker, alles in gleichen Teilen untereinander gemischt, und die Lust, mit der der Allfarblori stets auf das in dieser Weise zusammengesetzte Futter losstürzte und bis zum letzten Bröcklein auffraß, bewies, daß er dasselbe seinen Neigungen entsprechend fand. Kerbtiere, die ihm wiederholt geboten wurden, verschmähte er beharrlich und warf sie weg, wenn man sie in den Schnabel brachte.
»Das Wesen des Allfarbloris«, bemerkt Linden ferner, »ist ein viel lebhafteres als das der Breitschwanzloris; man kann es geradezu als stürmisch bezeichnen. Meine Vögel befanden sich stets in einer gewissen Aufgeregtheit und durften deshalb nicht in einer sogenannten Vogel- oder Papageienstube gehalten werden, weil es ihnen hier viel zu laut hergeht, sie zu leicht erschrecken, dann blindlings umherfliegen und häufig das Opfer ihrer Aufgeregtheit werden. Der Flug ist reißend schnell und wird stets mit lautem Gekrächze begleitet. Zum Boden herab kommen sie nur, wenn sie das Bedürfnis fühlen, sich zu baden. Ihre Stimmlaute lassen sich schwer beschreiben; denn sie sind ein Mittelding zwischen Pfeifen und Krächzen, aber gellend und durchdringend.«
*
Das an eigenartigen Vögeln so reiche Neuseeland beherbergt außer dem Kakapo noch eine in hohem Grad bemerkenswerte Vogelsippe, die der Stumpfschwanzloris oder Nestorpapageien ( Nestor). Von den fünf Arten, die man kennt, sind bereits zwei gänzlich ausgerottet worden, der eine wohl schon im Anfang unseres Jahrhunderts, der zweite kaum vor Ablauf der ersten Hälfte desselben; die drei übrigen beleben jedoch die Waldungen beider Hauptinseln noch in so erfreulicher Menge, daß ihr Fortbestand auf viele Jahrzehnte hinaus gesichert erscheint.
Die Stumpfschwanzloris, sehr kräftig und gedrungen gebaute Papageien von Dohlen- bis Rabengröße, kennzeichnen sich durch ihren starken, langen, seitlich zusammengedrückten Schnabel, dessen oberer Teil auf der schmalen, abgerundeten Firste eine seichte, bis gegen das Spitzendritteil hin verlaufende Längsrinne und an der Seite einen sanft gerundeten Leistenvorsprung zeigt und dessen unterer Teil eine breitflächige, ebene Dillenkante und glatte Schneiden ohne Ausbuchtung besitzt, sowie ferner durch ein reiches, breitfederiges, düster olivenbraun oder grün, im Nacken und am Bauch lebhafter gefärbtes Federkleid, das nach dem Geschlecht nicht verschieden ist.
Als der am besten bekannte Vertreter der Sippe darf der Kaka der Maoris ( Nestor meridionalis) angesehen werden. Seine Länge beträgt siebenundvierzig, die Breite dreiundachtzig, die Fittichlänge achtundzwanzig, die Schwanzlänge achtzehn Zentimeter. Das außerordentlich abändernde Gefieder ist in der Regel auf Stirn, Ober- und Hinterkopf nebst den Zügeln weißlichgrau; Rücken, Mantel und obere Flügeldeckfedern haben olivenbraune, ins Grüne scheinende Färbung und sind am Ende deutlich schwarz, die mittelsten Flügeldecken aber purpurbraun gesäumt. Auf die verschiedenen Spielarten will ich nicht eingehen.
Der Kea der Eingeborenen oder »Gebirgspapagei« der Ansiedler ( Nestor notabilis) ist größer als der beschriebene Verwandte, volle fünfzig Zentimeter lang; der Fittich mißt zweiunddreißig, der Schwanz zwanzig Zentimeter. Im Gefieder herrscht Olivengrün vor. Jede Feder zeigt an der Spitze einen halbmondförmigen braunen Fleck und einen schmalen braunen Schaftstrich.
Das Wohngebiet des Kakanestors erstreckt sich über einen großen Teil der westlichen Alpen, von dem Fuß des Gebirges an bis zur Grenze der hochstämmigen Waldungen hinauf; das des Keanestors dagegen beschränkt sich auf einen zwischen anderthalb- bis zweitausend Meter unbedingter Höhe gelegenen Gürtel der südlichen Alpen, von wo er nur während strenger Winter in die Tiefe hinabgetrieben wird. Jener hat sich da, wo der Ansiedler vordringt, bereits in die wenig betretenen Wälder zurückgezogen und ist in vielen Gegenden, woselbst er vormals sehr häufig war, schon recht selten geworden, erscheint aber auch hier noch oft in zahlreichen Schwärmen und tritt im Inneren der Waldungen noch ebenso häufig auf als je; das Leben des Keanestors hat der Mensch bis jetzt noch nicht beeinflussen können. Sein Wohngebiet liegt in einem Höhengürtel, der nur von einzelnen goldgrabenden Abenteurern und jagenden Forschern besucht wird. Wilde Gebirge, wasserreiche, tiefe, schnell fließende und rauschende Flüsse hemmen hier den Fuß des Wanderers und gewähren dem Vogel noch vollste Sicherheit, zerrissene Felsen mit unersteiglichen Wänden voller Höhlen und Spalten geeignete Ruhe- und Nistplätze und die reichen Matten, deren zwerghafte Pflanzenwelt allsommerlich in reichstem Blütenschmuck prangt, Nahrung in Hülle und Fülle. Vielleicht teilt einzig und allein der neuseeländische Edelfalke ( Falco novae-zealandiae) mit ihm das wilde Gebiet, das seinen Lebensbedürfnissen so vollständig entspricht und außer dem eben genannten Feind nur noch einem zweiten, vielleicht aber dem schlimmsten, einem strengen Winter, Einlaß gewährt. Unter solchen Umständen freilich, wenn der ganze Kamm des Gebirges bis tief hinab unter Schnee begraben liegt und kaum wiederzuerkennen ist, sieht er sich genötigt, seine sicheren Felsen zu verlassen und in die Tiefe hinabzusteigen, um hier in den Waldungen Nahrung zu finden.
Wie der Keanestor unternimmt auch der Kaka zu bestimmten Zeiten des Jahres mehr oder minder regelmäßige Wanderungen. Während des Sommers fesselt ihn seine Brut und deren Erziehung an einen bestimmten Ort; sobald aber die Jungen selbständig geworden sind und der elterlichen Führung und Leitung nicht mehr bedürfen, macht er sich auf, um das Land auf weithin zu durchstreifen. Dann sieht man ihn zuweilen in den Waldungen in sehr zahlreichen Gesellschaften, die, durch reichliche Nahrung angelockt, allgemach sich zusammengefunden haben. Der Kakanestor ist ein vollendeter Baum-, der Keanestor ein ebenso entschiedener Erdvogel. Jener bewegt sich auf dem Grunde so schwerfällig wie die meisten übrigen Papageien, nach Art der Raben, jedoch viel tölpelhafter hüpfend, ist dagegen in den Bäumen vollständig zu Hause, klettert mit bewunderungswürdiger Gewandtheit auf- und abwärts und tänzelt mit überraschender Fertigkeit längs der Zweige auf und nieder; der Kea hingegen läuft mit der Schnelligkeit der australischen Grassittiche oder Nasenkakadus auf dem Boden umher und kann kaum noch ein Baumvogel genannt werden.
Mit den meisten Papageien teilen die beiden Nestorarten einen ausgesprochenen Hang zur Geselligkeit. Nicht allein die Gatten eines Paares, sondern auch die Artgenossen halten auf das treueste zusammen. Der Jäger, der die Waldungen durchstreift und nur hin und wieder einen einzelnen Kaka zu Gesicht bekommt, erfährt zu seiner nicht geringen Überraschung, daß sie von allen Seiten herbeieilen, wenn er einen von ihnen verwundet und dieser einen Angstschrei ausstößt. Der bis dahin stille Wald hallt jetzt plötzlich wider von dem vereinigten Schreien der zur Stelle kommenden Vögel, und das lebhafteste Gebärdenspiel verrät, welch innigen Anteil sie an dem Schicksal ihres Gefährten nehmen. Abgesehen von derartigen Veranlassungen ist während des Sommers ihr Tun und Treiben wenig auffallend. Während der heißen Stunden des Tages halten sie sich verborgen und still, und erst mit Beginn der Kühle kommen sie aus ihren Schlupfwinkeln hervor, ebenso wie sie am Morgen mit dem ersten Tagesgrauen ihre Stimme vernehmen lassen und bei Mondlicht, oft längere Zeit nach Sonnenuntergang noch, in Bewegung und Tätigkeit gesehen werden. So still sie waren, während sie ruhten, so laut gellt jetzt ihr eigentümlicher Schrei, ein Klangbild ihrer einheimischen Namen, durch den Wald. Man sieht sie nunmehr in vollster Beschäftigung frei auf den höchsten Zweigen sitzen, an dünneren oder an Ranken umherklettern und ihren kräftigen Schnabel hier und dort einsetzen, um ein Stück Rinde loszuschälen, ein Loch zu erweitern, Mulm zu durchwühlen, Beeren zu pflücken oder sonstige Arbeiten zu Gunsten des verlangenden Magens oder aus Lust am Arbeiten und Zerstören auszuführen. Die Aufnahme des Futters beansprucht ihre Tätigkeit in vollstem Maß. Sie sind Allesfresser im ausgedehntesten Sinne des Wortes. Während der Brutzeit nähren sie sich, dem Bau ihrer Zunge entsprechend, allerdings vorwiegend von Pflanzenhonig; außerdem aber genießen sie fast alle Beeren und Früchte, die in den Waldungen wachsen, überfallen selbst größere Tiere und gehen im ärgsten Notfall sogar Aas an. Ihr sehr kräftiger Schnabel erleichtert ihnen die Arbeiten im morschen Holze, und wenn sie hier einmal Jagdbeute gewittert haben, lassen sie es sich nicht verdrießen, tiefe Löcher in die Baumstämme zu nagen. Potts hebt den Nutzen ihrer Tätigkeit für die Waldungen Neuseelands, denen Spechte bekanntlich fehlen, vielleicht mehr als gebührend hervor und scheint geneigt zu sein, sie den Waldhütern beizuzählen, bemerkt auch, daß sie durch ihre Liebhaberei für Pflanzenhonig insofern noch anderweitigen Nutzen stiften, als sie zur Befruchtung der Blüten beitragen helfen. In Wahrheit dürften ihre Verdienste wohl nicht so hoch angeschlagen werden, als dies nach Vorstehendem scheinen will. Auch wissen andere Beobachter von mancherlei Untaten zu erzählen, die sie sich zuschulden kommen lassen. Potts bezweifelt, daß sie jemals einen in Blüte stehenden gesunden Baum angreifen sollten, während Buchanan einen Kaka ertappte, als er die Rinde von einem in vollem Safte stehenden Baume abschälte, in der Absicht, den ausfließenden Saft aufzusaugen. Noch Schlimmeres berichtet man vom Keanestor. Dieser soll einen Herrn Campbell in arger Weise geschädigt haben. Man bemerkte, daß die Schafherden des genannten Ansiedlers ohne erklärliche Ursache von einer eigentümlichen, bis dahin unbekannten Krankheit heimgesucht wurden, indem auf verschiedenen Stellen ihres Felles handgroße Wunden entstanden, die bis auf die Muskellage in die Tiefe reichten, durch das ausfließende Blut die Wolle verdarben und nicht selten den Tod im Gefolge hatten. Zuletzt beobachtete ein Schäfer, daß diese Wunden durch die Gebirgspapageien verursacht wurden. Einer der Vögel setzte sich auf das erkorene Schaf und fraß ihm, ohne daß das dumme Tier von seinem Peiniger sich befreien konnte, ein Loch in den Leib. Nachdem die Hirten auf den Übeltäter aufmerksam geworden waren, wurden sie, wenn sie im hohen Gebirge weideten, wiederholt Zeugen derartiger Angriffe. So wenig glaublich vorstehende Mitteilung auch scheinen will, so müssen doch alle Zweifel verstummen, wenn man andere Erfahrungen berücksichtigt, die die neuseeländischen Forscher über die ausgesprochenen Raubtiergelüste des Gebirgsnestors gesammelt haben. Für gewöhnlich muß er sich allerdings mit Aas begnügen. In der Regel erscheinen die Diebe während der Nacht, und gewöhnlich unternehmen sie gemeinschaftliche Raubzüge.
Gegen die Brutzeit hin bekunden die Nestorpapageien die übliche Zärtlichkeit und gegenseitige Hingebung. Das Paar, welches sich vereinigte, bleibt stets zusammen, und wenn der eine von einem Baume zum andern fliegt, folgt ihm der aufmerksame Gatte sofort nach. Nunmehr handelt es sich darum, eine passende Niststelle auszufinden oder eine solche zu bereiten. Beide untersuchen die Bäume, deren Inneres hohl, vermorscht und vermulmt ist und wenigstens an einer Stelle durch eine kleinere oder größere Öffnung mit der Außenwelt in Verbindung steht. Diese Eingangsröhre wird zunächst erweitert oder geglättet, und man sieht das Paar mit dieser Arbeit eifrigst beschäftigt. Eine Nisthöhle, in der Buller am 23. Dezember zwei ungefähr zehn Tage alte Junge entdeckte, befand sich nur einen Meter über dem Grunde und bestand aus einem Eingangsloche von sechzig Zentimeter Länge und fünfunddreißig Zentimeter Durchmesser, das in einen Brutraum von etwa vierzig Zentimeter Durchmesser führte. Die Wände desselben waren geglättet und der Boden mit einer dicken Lage von Mulm und einigen Rindenbruchstücken bedeckt, welche letztere von den Vögeln offenbar in das Innere gebracht sein mußten. Ebenso werden aber auch Höhlungen zwischen dem Gewurzel eines Baumes oder geeignete Ritzen im Gefelse von dem Kakanestor als Bruthöhlen benutzt. Die vier rein weißen Eier, deren größter Durchmesser vier und deren kleinster drei Zentimeter beträgt, werden Anfang November gelegt, mit Hingebung bebrütet und die Jungen, die man um Weihnachten findet, von beiden Eltern aufgefüttert. Mit der Brut und Aufzucht der Jungen vergeht fast der ganze Sommer, und erst gegen den Herbst, unser Frühjahr, hin gestaltet sich das Leben des Vogels sorgenlos. Infolge reichlicher Nahrung wird er bald ungemein fett und gilt dann mit Recht als leckeres Wild, erfährt daher auch eifrige Nachstellungen. Um so schlimmer ergeht es ihm im Winter, der als sein schlimmster Feind angesehen werden muß.
Kaka- und Keanestor lassen sich außerordentlich leicht fangen, erstere in Schlingen und Netzen verschiedenster Art, letztere in einer Weise, die an die Erbeutung lebendiger Zeisige oder Leinfinken mittels der an einer Stange befestigten Leimrute erinnert. Der gefangene Vogel benimmt sich auffallend gelassen, tobt und flattert nicht und verhält sich so lange ruhig, bis man die Schlinge wieder entfernt hat. Demungeachtet denkt er anfänglich an seine Befreiung und weiß dieselbe leichter zu erlangen, als der Fänger gewöhnlich annimmt. Ihn in einen Holzkäfig sperren zu wollen, wäre vergebliches Bemühen; denn er zerstört solchen in kürzester Frist. An das Futter geht der Gefangene übrigens ohne weitere Umstände, und bei guter Behandlung erweist er sich so dankbar, daß er binnen wenigen Wochen zu einem ungemein zahmen Haustier wird. Noch leichter als altgefangene gewöhnen sich selbstverständlich jung aus dem Nest gehobene Nestorpapageien an den Verlust ihrer Freiheit. Ihre ausgezeichnete Nachahmungsgabe befähigt sie, Worte und Sätze der Maorisprache zu lernen, ihre Klugheit, sich als Lockvogel für andere ihrer Art gebrauchen zu lassen. Ein sprechender Nestorpapagei steht hoch im Preise; ein Kaka, der seine freilebenden Artgenossen in das Netz des Fängers zu locken versteht, ist seinem Besitzer stets um hohe Summen nicht feil.