
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wale im allgemeinen. Delphine.
Unter den Säugetieren sind die Wale dasselbe, was die Fische unter den Wirbeltieren: ausschließlich dem Wasser angehörige und solchem Leben entsprechend gebaute Geschöpfe. Die Robben verbringen wenigstens noch ein Dritteil ihres Lebens auf dem Lande, werden dort geboren und suchen es auf, wenn sie die freundlichen Strahlen der Sonne genießen und schlafen wollen; bei den Sirenen ist mindestens noch die Möglichkeit des Landlebens vorhanden; die Wale dagegen sind ausschließlich dem Meer zugewiesen. Darauf deutet schon ihre Größe hin; denn nur das Wasser gestattet leichte Beweglichkeit solcher Riesen, und nur das unendlich reiche Meer gewährt ihnen die erforderliche Nahrung.
Warmes Blut und Lungenatmung, Lebendiggebären und Säugen der Jungen, vollkommene Entwicklung des Gehirns und der Nerven; diese wesentlichen Merkmale der Säugetiere sind die einzigen, die die Wale mit den übrigen Ordnungen der Klasse teilen. In jeder andern Hinsicht weichen sie noch weit von den höheren Säugetieren ab als die Sirenen, in denen wir bereits Zwittergestalten zwischen Säugern und Fischen kennen lernten. Jeder wenig gebildete Mensch, jedes noch in der Kindheit stehende Volk hat sie den Fischen zugezählt und erst die genaue Erforschung ihres Wesens und Seins ihnen die Stellung angewiesen, die ihnen gebührt.
Der Leib der Wale ist massig und ungefüge, ohne alle äußere Gliederung; der oft unförmlich große und in der Regel ungleich gebaute Kopf geht ohne deutlich zu unterscheidende Grenze in den Rumpf über, und dieser läuft, nach hinten zu sich verschmächtigend, in eine breite, wagerechte Schwanzfinne aus. Die hinteren Glieder, die, mit Ausnahme der Sirenen, alle übrigen Säugetiere kennzeichnen, fehlen gänzlich; die vorderen sind zu eigentlichen Flossen geworden; man muß sie mit dem zergliedernden Messer untersuchen, wenn man sie als Hände erkennen will, und findet auch dann noch Eigentümlichkeiten ihres Baues auf. Eine hier und da vorkommende Fettflosse, die längs des Rückens verläuft, trägt zur Vermehrung der Fischähnlichkeit dieser Tiere bei. Im übrigen kennzeichnen die Wale äußerlich der weitgespaltene, lippenlose Mund, in dem entweder eine ungewöhnlich große Menge von Zähnen oder aber Barten stehen, das Fehlen des inneren Augenlides, die Lage der Zitzen hinten neben den Geschlechtsteilen und eine dünne, glatte, weiche, fettige, sammetartig anzufühlende, ausnahmsweise an wenigen Stellen mit einzelnen Borsten bedeckte Haut von düsterer Färbung, in der eine sehr dicke Fettschicht liegt, da es die auffallend verdickte Lederhaut ist, zwischen deren Zellen das Fett eingebettet ist.
Das Gebiß der Wale unterscheidet sich nicht allein von dem aller übrigen Säugetiere, sondern sehr wesentlich auch je nach den beiden Hauptabteilungen der Ordnung. »Bei allen Walen«, sagt Carus, »bilden sich in Längsgruben der Kieferschleimhaut Zahnkeime, die sich indes nur bei den Delphinen zu bleibenden Zähnen, die nicht gewechselt werden, weiter entwickeln. Bei den Bartenwalen verschwinden sie, und es entwickelt sich ein diesen Tieren eigentümlicher Besatz der Oberkiefer und Gaumenflächen. In queren Furchen entstehen hornige, frei in die Mundhöhle herabhängende Platten, von denen die äußeren, am Oberkiefer befestigten, die längsten, die an der Gaumenfläche stehenden die kürzesten sind: die Elasmia, die das Fischbein bilden.«
Besonders merkwürdig sind die Atmungswerkzeuge. Die Nase hat ihre Bedeutung gänzlich verloren und ist ausschließlich Luftweg geworden. Ihre auf der höchsten Erhebung des Schädels gelegene Öffnung, das Spritzloch, führt senkrecht in die Nasenhöhle und durch diese in den Kehlkopf. Nasen- oder Spritzlöcher, Nasengang, Kehlkopf und Luftröhre bilden ein einheitliches und geschlossenes, zur Lunge führendes Rohr, Mundhöhle, Rachen und Speiseröhre ein zweites, von den Luftwegen völlig getrenntes Rohr. Diese sinnreiche Trennung von Luft- und Nahrungswegen ist für das dauernde Leben in und unter Wasser natürlich ganz besonders wesentlich. Carus, auf dessen Darstellung Brehm fußt, kannte sie noch nicht. Die Nahrung kann also bei den Walfischen nicht in die »falsche Kehle« kommen und damit ebensowenig Wasser. Aus dem Spritzloch wird daher nicht Wasser, sondern verbrauchte Atemluft und Wasserdampf ausgeschieden, die aber in der kalten Polarluft sogleich zu Wasser kondensieren. Herausgeber. Der Kehlkopf ist nicht geeignet, eine wohllautende Stimme hervorzubringen, wohl aber eine Menge Luft mit einem Male durchgehen zu lassen. Die Luftröhre ist sehr weit, die Lunge hat einen beträchtlichen Umfang, und alle Luftröhrenäste stehen unter einander in Verbindung, so daß von einem aus die ganze Lunge gefüllt werden kann. Dazu kommen noch andere Hilfsmittel, die die Atmungsfähigkeit erhöhen; so besitzen die Herz- und Lungenschlagader weite Säcke, in denen sich gereinigtes und der Reinigung bedürftiges Blut ansammeln kann.
Die Muskeln sind einfach, der Größe der Tiere angemessen und ungemein kräftig. Die Nervenmasse ist äußerst gering; bei einem fünftausend Kilogramm schweren Walfisch von sechs Meter Länge wog das Gehirn noch nicht zwei Kilogramm, nicht mehr als bei dem selten über hundert Kilogramm schweren Menschen! Alle Sinneswerkzeuge stehen auf tiefer Stufe. Die Augen sind klein, die Ohren äußerlich kaum sichtbar, sozusagen nur angedeutet. Gleichwohl läßt sich nicht annehmen, daß Gesicht und Gehör verkümmert sein müssen. Alle Wale beweisen, daß sie nicht allein sehr scharf, sondern auch in weite Ferne sehen, ebenso, daß sie Geräusche aller Art gut wahrnehmen. Nur Geruch scheinen sie nicht zu besitzen; Riechnerven hat man wenigstens noch bei keiner Art gefunden. Über den Geschmack vermögen wir nicht zu urteilen; vom Gefühl aber wissen wir, daß es einigermaßen entwickelt ist.
Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß solcher Leibesbau für das Wasserleben der Wale durchaus geeignet ist. Die wagerecht gestellte Schwanzflosse befähigt zu spielendem Auf- und Niedertauchen oder müheloser Ausbeutung verschiedener Schichten der Höhe und Tiefe; die Glätte der Haut erleichtert die Fortbewegung der ungeheuren Masse, die Fettlage verringert ihr Gewicht, ersetzt das wärmende Haarkleid und gibt zugleich den nötigen Widerstand für den kaum zu berechnenden Druck, den ein Wal auszuhalten hat, wenn er in die Tiefe des Meeres hinabsteigt; die sehr große Lunge ermöglicht, außerordentlich lange unter dem Wasser zu verweilen, und die erweiterten Schlagadern, die Herz und Lunge verbinden, bewahren noch eine beträchtliche Menge gereinigten Blutes in sich auf, das verwendet werden kann, wenn die Tiere längere Zeit als gewöhnlich verhindert werden, die zur Blutentkohlung nötige Luft zu schöpfen.
Die Wale sind zu vollkommenen Meeresbewohnern geworden. Die meisten von ihnen meiden die Nähe der Küsten soviel wie möglich, denn das Land wird ihnen verderblich. Nur die Mitglieder einer Familie gehen zuweilen ziemlich hoch im süßen Wasser empor, jedoch nicht gern weiter, als die Wirkung der Flut sich bemerklich macht. Alle übrigen verlassen das Salzwasser nicht, durchwandern jedoch mehr oder minder regelmäßig kürzere oder weitere Strecken des Meeres. Über diese Wanderungen hat Eschricht in ebenso sachgemäßer wie eingehender Weise berichtet, und seine Angaben sind es, die ich, nach der von Cornelius in seinem trefflichen Büchlein über die Zug- und Wandertiere gegebenen Übersetzung, dem Nachfolgenden zugrunde lege.
»Waltiere gibt es in allen Meeren; keine einzige Art von ihnen aber hat irgendwo einen bleibenden Aufenthalt. Im ganzen genommen halten sich, wie von vornherein zu erwarten, die größeren Arten an die großen, freien Weltmeere, und so wie in die Ostsee hinein einzig und allein der Braunfisch regelmäßig zieht, so schwimmen durch die Gibraltarstraße gewiß nur größere und kleinere Zahnwale, aber weder der Potwal noch irgendein Bartenwal. In großen Meeren kommen letztere, auch die größten unter ihnen, den Küsten oft sehr nahe und wagen sich in Buchten hinein, die sie sonst meiden; dies tun insbesondere die trächtigen Weibchen, mitunter offenbar des Gebärens halber, wie z. B. an der Westküste Afrikas der Südwal im Juni und Juli erscheint und im September mit den Neugeborenen wieder abzieht. Am meisten scheinen die Tintenfischfresser unter den Waltieren sich auf das offene Meer zu beschränken, so besonders die Grindwale und Entenwale, indem sie nur an einsam im Meere liegenden Felsgruppen, beispielsweise an den Färöerinseln, regelmäßig vorkommen. Jede Art hat, wie es scheint, gewisse Lieblingsaufenthaltsplätze für den Sommer, andere, vielleicht weit entlegene, für den Winter, und wandert, nach Art der Zugtiere überhaupt, auf ziemlich bestimmten Fahrstraßen im Frühjahr von diesem zu jenem, im Spätjahre von jenem zu diesem Meere. Schon hieraus ergibt sich, daß nicht nur ein und dieselbe Art, sondern auch dieselben Tiere an mehreren zum Teil sehr entfernt von einander liegenden Gegenden bekannte, weil jährlich erscheinende Gäste sein können; in einigen Meeren stete Sommer- oder Wintergäste, in andern vorüberziehende Wanderer, sowie anderseits keine Küstenstrecke und vielleicht kein Meer auf irgendeine Waltierart einen ausschließenden Anspruch erheben kann, weil eine Gegend dieselben höchstens für eine gewisse Jahreszeit, oft auch nur eine sehr kurze Frist, aufzuweisen vermag. Die Waltierarten eines und desselben Meeres sind also im allgemeinen durchaus verschiedene im Sommer und im Winter. Wer nur das Meer kennt als Sommeraufenthalt der einen Art, wird eine ganz andere angeben als derjenige, der im Winter in ihm beobachtet hat. Um also die Verbreitung der Waltiere zu bestimmen und ein wirklich genügendes Bild sich zu entwerfen, kann man nicht genugsam die Jahreszeit ins Auge fassen.
Die Übereinstimmung der Wanderungen der Wale mit denen der Zugtiere zeigt sich am deutlichsten in der Regelmäßigkeit ihrer jährlichen Wiederholung, und zwar ebensowohl hinsichtlich der Zeit wie der Straßen und Ruheplätze. Im Herbst, besonders gegen Michaeli z. B., kommen an der südlichen Küste der Färöerinseln und an ihnen wieder vorzugsweise im Qualbon-Fjord, drei, vier bis sechs Döglinge vor. So war es bereits vor 180 Jahren, und damals schon lautete die Sage, daß es auch in den heidnischen Zeiten so gewesen. In der Davisstraße nähert sich namentlich bei Jakobshafen unter dem 62. Grade, bei Pisselbik unter dem 64. Grade und bei Friedrichshafen unter dem 62. Grade der Keporkak oder Buckelwal in jedem Sommer regelmäßig der Küste und soll sich von jeher dann an der Küste gezeigt haben. An der norwegischen Küste ist es fast ausschließlich der Skogsvaag und der Qualvaag unweit Bergen, in die der Naagewal und Zwergwal jeden Sommer einzudringen wagen.
Diese Anhänglichkeit an gewisse Aufenthaltsorte ist um so merkwürdiger, als die Waltiere dort einer blutigen, schonungslosen Verfolgung ausgesetzt sind. Wenn aber letztere so weit getrieben wird, daß jedesmal jeder anlangende Wal sein Leben einbüßt, so kann eine solche Vorliebe offenbar nur auf gewissen Bedingungen der Örtlichkeit beruhen, und vielleicht darf man annehmen, daß eben durch die jedesmalige Niedermetzeluug die Tiere verhindert werden, unter Anführung eines erfahrenen Alten ihrer Art andere, minder gefährliche Stellen aufzusuchen. Allein auch da, wo die Vernichtung nicht so vollständig wird, kommen die Scharen immer wieder an; ja, was hier am entscheidendsten ist, wenn die Jagd nur auf ein Stück ausging, und solches mit genauer Not und nicht ohne Verwundungen davon kam, so hat es in manchen Fällen während der folgenden Jahre immer wieder sich dort blicken lassen, bis es endlich erlag. So war es mit dem an einem Loch in der Rückenflosse kenntlichen Finnwale, den die Fischer einer Bucht Schottlands zwanzig Jahre lang beobachteten und unter dem Namen »Hollie Pyke« kannten, bis es ihnen endlich gelang, ihn zu erbeuten. Vielleicht gehört hierher auch der von Bennett erwähnte Fall von einem Pottwal, der auf den Spermwalgründen bei Neuseeland den Walfischfängern als »New Zealand Tom« lange bekannt gewesen war, und zwar ebensowohl seiner Größe und Wildheit wie auch der weißen Färbung seines Buckels halber. Am auffallendsten ist die Angabe Steenstrups, die ich hier wörtlich wiedergeben will. »Die Küstenbewohner Islands geben ihren Walfischen Namen, und die einzelnen Stücke sind ihnen überhaupt als Persönlichkeit bekannt. Die Walfische wählen immer dieselbe Bucht, um ihre Kälber abzulegen; die Mutter kommt regelmäßig jedes zweite Jahr. Man nimmt die Jungen, verschont aber die Alte, deren Leben nur dann bedroht ist, wenn sie sich in eine fremde Bucht verirrt.
Was die Straßen anlangt, denen die Waltiere folgen, so kommen darin bei aller Regelmäßigkeit im allgemeinen doch mehr oder weniger bedeutende Abweichungen vor, wie das ja wohl bei den Zugtieren überhaupt der Fall ist. Aus ihren Weg scheint nicht sowohl der Strom als vielmehr der Wind einen wesentlichen Einfluß zu haben, indem sie, wie es wenigstens viele erfahrene Leute behaupten, immer dem Wind entgegenschwimmen sollen. Gewiß ist, daß nicht nur einzelne Waltiere oft aus ihrer gewohnten Bahn verschlagen werden, sondern auch ganze Scharen, wie z. B. die zweiunddreißig Potwale, die im Jahre 1784, und die siebzig Grindwale, die im Jahre 1812 an der französischen Küste verunglückten. Ein merkwürdiges Beispiel von einer anhaltenden Abweichung von dem gewöhnlichen Wege findet sich auch in der Geschichte des letztgenannten Tieres, indem das Vorüberziehen der großen Scharen desselben an den Färöerinseln in den Jahren 1754 bis 1776, also zweiundzwanzig Jahre lang, fast gänzlich aufgehört hatte, seitdem aber jährlich wieder stattfindet und namentlich im letzten Jahrzehnt eher im Zunehmen begriffen ist.
Dieses Abweichen von der gewohnten Straße, vielleicht auch das beabsichtigte Eindringen in Flußmündungen sind Ursache, daß Waltiere von Zeit zu Zeit in größerer Anzahl stranden und eine Beute der Küstenbewohner werden, wie es in früheren Jahren zuweilen mit dem Grönlandswale, der jetzt nur noch im hohen Norden gefunden wird, der Fall war.
Die Waltiere sind, wie die meisten Zugtiere überhaupt, gesellige Tiere. Man findet da, wo Futter vorhanden ist, oft Hunderte und über tausend nicht nur derselben, sondern selbst verschiedener Arten beisammen, und auch den großen ziehenden Scharen sollen sich, nach dem Zeugnis der Küstenbewohner, einzelne oder mehrere einer andern Art anschließen oder beimischen. Da die Liebe der Weibchen zu den Jungen bei den Walen fast alles übertrifft, was wir sonst bei Tieren beobachten, und die Erziehung der Jungen wie deren Schutz fast allein der Mutter überlassen ist, so hat man die großen Scharen vorzugsweise aus Weibchen bestehend gefunden, die von einzelnen alten Männchen angeführt werden. Das Zusammenhalten der Waltiere in kleinen oder größeren Trupps beruht also zum Teil auf der gemeinsamen Nahrung, zum Teil auf Gesellschafts- und Familienverhältnissen, bei manchen Arten aber offenbar noch, wie bei den Zugtieren überhaupt, auf einem Trieb, während der Wanderung sich einander anzuschließen.«
Alle Wale sind im hohen Grade bewegungsfähige Tiere. Sie schwimmen mit der größten Meisterschaft, ohne irgend sichtbare Anstrengung, manche mit unvergleichlicher Schnelligkeit, und betätigen, wenn sie wollen, eine so außerordentliche Kraft ihrer mächtigen Schwanzflosse, daß sie, trotz der ungeheuren Last ihres Leibes, sich über das Wasser emporzuschnellen und weite Sprünge auszuführen vermögen. Gewöhnlich halten sie sich nahe der Oberfläche, und vielleicht steigen sie in größere Tiefen des Meeres nur dann hinab, wenn sie verwundet werden. Die oberste Schicht des Wassers ist ihr eigentliches Gebiet, weil sie mit dem Kopf und einem Teil des Rückens emporkommen müssen, wenn sie Atem schöpfen wollen. Ihr Luftwechsel geschieht in folgender Weise. Der emporgekommene Wal spritzt zuerst unter schnaubendem Geräusch das Wasser, das in die nur unvollkommen verschlossenen Nasenlöcher eindrang, mit so großer Gewalt empor, daß es sich in seine Tropfen auflöst, aber dennoch bis zu fünf und sechs Meter Höhe emporgeschleudert wird. Dieser Wasserstrahl läßt sich am besten mit einer Dampfsäule vergleichen, die aus einer engen Röhre entweicht; auch das Schnauben erinnert an das durch den Dampf unter gegebenen Umständen verursachte Geräusch. Einen Wasserstrahl, wie ihn ein Springbrunnen in die Höhe schleudert, wirft kein Wal aus, obgleich die meisten Zeichner dies darstellen und noch viele Naturbeschreiber es angeben. Gleich nach dem Ausstoßen zieht das Tier unter ebenfalls laut hörbarem, stöhnendem Geräusch mit einem raschen Atemzuge die ihm nötige Luft ein, und manchmal wechselt es drei-, vier-, auch fünfmal in der Minute den Atem; aber nur das erste Mal nach dem Auftauchen wird ein Strahl emporgeschleudert. Die Nasenlöcher sind so günstig gelegen, daß der Wal beim Auftauchen immer mit ihnen zuerst ins Freie kommt, und somit wird ihm das Atmen ebenso bequem wie andern Tieren. Er erhebt sich schwimmend bis zur Oberfläche des Wassers, reckt den vorderen Teil des Leibes über dieselbe empor, so daß etwa das vordere Drittel der Rückenfirste sichtbar wird, atmet und versinkt, den ganzen Leib krümmend, hierauf wiederum in der Tiefe, wobei der hintere Teil seines Leibes beinahe ganz, die Schwanzflosse in der Regel gänzlich sichtbar zu werden pflegt. Man darf annehmen, daß ein ruhig dahinschwimmender, ungestörter Wal mindestens alle anderthalb Minuten einmal Luft schöpft; aber man hat auch beobachtet, daß er weit länger unter Wasser verweilen kann. Erfahrene Walfänger behaupten übereinstimmend, daß gewisse Wale, wenn verwundet, bis achtzig Minuten unter Wasser aushalten können. Unter solchen Umständen leistet wahrscheinlich das in den erwähnten Schlagadersäcken aufbewahrte, angesäuerte Blut der Atemnot noch eine Zeitlang Vorschub; endlich aber macht sich das Säugetier doch geltend, und der Wal muß wieder zur Oberfläche emporsteigen, um dem unvermeidlichen Erstickungstode zu entrinnen. Bei unterbrochenem Luftwechsel stirbt der Wal so sicher wie jeder andere Säuger an Erstickung, nach den Beobachtungen der Walfänger sogar in sehr kurzer Zeit. Ein Wal, der sich in dem Tau verschlang, mit dem man einen seiner eben getöteten Gefährten behufs der Ausnutzung emporgewunden hatte, war nach wenigen Minuten eine Leiche. Schwerer zu begreifen ist, daß unsere Tiere, die doch bloß Luft atmen, in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit ebenfalls sterben, wenn sie auf das Trockene geschleudert werden. Dort fehlt es ihnen nicht an Luft, und auch der Hunger tötet ein so gewaltiges Tier schwerlich so schnell; gleichwohl ist der gestrandete Wal, wie schon bemerkt, jedesmal dem Verderben preisgegeben.
Mehrfach ist als Streitfrage aufgeworfen worden, ob die Wale eine Stimme haben oder nicht. Die Frage darf, wie sich eigentlich von selbst versteht, von vornherein bejaht werden, da eine Stimmritze vorhanden ist und es sich nicht einsehen läßt, aus welchem Grunde diese nicht ihre Schuldigkeit tun sollte; es liegen jedoch auch hinreichend verbürgte Beobachtungen vor, die entscheidend sind. Bei großer Gefahr, unter dem Schmerzgefühl schwerer Verwundungen, nach Strandungen, überhaupt in Todesnot, schreien die Wale zuweilen laut. Nach Versicherung aller Ohrenzeugen, die hierüber berichten, lassen sich die unter solchen Umständen ausgestoßenen Laute mit denen irgendeines andern Tieres nicht vergleichen. Sie bestehen in einem Brüllen, das als schrecklich, entsetzlich geschildert wird und diese Bezeichnung um so mehr verdienen soll, je größer der Wal ist, der brüllt. Ob die Tiere ihre Stimme auch behufs einer Benachrichtigung anderer ihrer Art verwenden, hat man, soviel mir bekannt, bisher noch nicht mit Sicherheit feststellen können; Beobachtungen, die gelegentlich des Strandens gesellig lebender Waltiere gemacht wurden, sprachen jedoch auch hierfür.
Alle Wale nähren sich von Tieren und nehmen wahrscheinlich nur zufällig Pflanzen mit auf; wenigstens bedarf es noch genauerer Beobachtung, bevor man behaupten kann, daß eine Art, der Finnfisch nämlich, die Tange, die man oft in großer Menge in seinem Magen findet, abweidet oder ein Delphin die in das Flußwasser gefallenen Früchte frißt. Größere und kleinere Meertiere der verschiedensten Klassen sind die Beute, der sie nachstreben. Gerade die größten Arten nähren sich von den kleinsten Meertieren, und umgekehrt die kleineren sind die tüchtigsten Räuber. Sämtliche Zahnwale sind Raubtiere im eigentlichen Sinne des Wortes, und manche von ihnen verschonen selbst die Schwächeren ihrer eigenen Sippschaft nicht; dagegen begnügen sich die Bartenwale mit sehr kleinen Tieren, mit winzigen Fischen, Krebsen, schalenlosen Weichtieren, Quallen und dergleichen. Man kann sich leicht vorstellen, welch unschätzbare Massen von Nahrung die Riesen des Weltmeeres zu ihrer Erhaltung bedürfen; ein einziger Wal verzehrt wahrscheinlich täglich Millionen und selbst Milliarden winziger Geschöpfe.
Über die Zeit der Fortpflanzung fehlen noch genauere Nachrichten. Vielleicht geschieht sie zu jeder Jahreszeit, am häufigsten aber wohl gegen das Ende des Sommers. Es scheint, daß sich dann die Herden in bestimmte Paare auflösen, die längere Zeit zusammenhalten. Vor der Begattung zeigt das Männchen seine Erregung durch Plätschern mit den gewaltigen Flossen an und verursacht bei stillem Wetter Donnergetöse. Gar nicht selten wirft es sich auf den Rücken, stellt sich senkrecht auf den Kopf und bewegt die Wogen auf weithin, springt auch wohl, mit der riesigen Masse seines Leibes spielend, über die Oberfläche des Wassers heraus, taucht senkrecht in die Tiefe, erscheint von neuem und treibt andere Scherze zur Freude des Weibchens. Die Begattung geschieht in verschiedener Weise, indem sich das Männchen entweder auf das umgedrehte Weibchen legt, oder beide zur Seite geneigt sich aneinander schmiegen, oder endlich beide, Brust gegen Brust gekehrt, eine mehr oder weniger senkrechte Stellung im Wasser annehmen. Beider vereinigte Kraft ermöglicht, wie Scammon sagt, jede beliebige Stellung während der Begattung. Wie lange die Tragzeit währt, ist zurzeit noch nicht ermittelt. Man nimmt zwar an, daß sie bloß sechs bis zehn Monate dauert, dürfte aber schwerlich diese Annahme beweisen können. Bei den kleineren mag die angegebene Zeit der wahren wohl ziemlich nahe kommen; die großen aber können ebensogut einundzwanzig oder zweiundzwanzig wie neun oder zehn Monate trächtig gehen. Für letzteres spricht die mitgeteilte Beobachtung Steenstrups, daß die Mutter in jedem zweiten Jahre an gewissen Orten erscheint, um zu gebären. Über den Geburtshergang selbst fehlt jegliche Kunde; insbesondere wissen wir nicht, was die Alte tut, um das Junge zum Saugen zu veranlassen, ihm begreiflich zu machen, wo und wie es den Nahrungsquell zu finden und zu benutzen habe. Andere Seesäugetiere werden entweder auf dem festen Lande, das ihnen unbehinderte Atmung gestattet, zur Welt gebracht, oder, wenn sie im Wasser geboren werden, wie dies bei den Sirenen der Fall ist, von der Alten mit Hilfe der Brustflossen an die Brüste gelegt und wahrscheinlich, solange sie saugen, über dem Wasser gehalten; die Wale hingegen müssen, ihrem Leibesbau entsprechend, vom ersten Augenblick ihres wirklichen Lebens an dieselben Bewegungen ausführen wie die Alten, um nicht zu ersticken, also im wesentlichen deren Lebensweise teilen. Schon hieraus ergibt sich, daß sie in einem hoch entwickelten Zustande zur Welt kommen müssen, um überhaupt leben zu können. Nach mehrfachen Beobachtungen haben sie bei der Geburt bereits ein Viertel der Größe ihrer Erzeuger, keineswegs aber auch deren Befähigung erlangt, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, müssen im Gegenteil sehr sorgfältig gepflegt und sehr lange gesäugt werden. Frühere Beobachter gaben an, daß die säugende Alte nach wie vor ihres Weges weiterschwimme und das an den Zitzen angehängte Junge einfach nachschleife; Scammon hingegen bemerkt ausdrücklich, daß sie, während sie ihren Mutterpflichten Genüge leistet, wie erschlafft in dem Wasser liege, fast den ganzen Hinterteil ihres Leibes über der Oberfläche erhebe und sich ein wenig zur Seite neige, um es dem säugenden Jungen möglichst bequem zu machen. Die kleineren Arten können wahrscheinlich weit früher entwöhnt werden als die großen, die kaum vor Ablauf ihres ersten Lebensjahres fähig sein dürften, ihre Nahrung selbst zu erwerben. Bis dahin pflegt sie die Mutter mit rührender Zärtlichkeit, gibt sich ihrethalben ohne Bedenken allen Gefahren preis, die beider Leben bedrohen können, und verläßt sie, solange sie leben, nie. Das Wachstum der Jungen scheint verhältnismäßig langsam vor sich zu gehen; die Bartenwale zumal dürften, wie man annimmt, kaum vor dem zwanzigsten Jahre ihres Lebens zur Fortpflanzung geeignet sein. Wie lange ihr Dasein währt, weiß man nicht. Man behauptet, daß das hohe Alter sich durch Zunahme des Grau an Körper und Kopf, das Vergilben der weißlichen Farbe, die Abnahme des Trans, die große Härte des Speckes und die Zähigkeit der sehnigen Teile bestimmen läßt; allein man ist durchaus nicht imstande, die Zeit anzugeben, in der diese Veränderungen beginnen.
Auch die Wale haben ihre Feinde, namentlich in den ersten Zeiten ihres Lebens. Mehrere Haie und der Schwertfisch sollen förmlich auf junge Walfische jagen, wie sie ja auch ältere angreifen und dann tagelang mit Vergnügen von dem riesenhaften Leichnam fressen. Weit gefährlicher als alle Seeungeheuer wird den Walen der Mensch. Er ist es, der bereits seit mehr als tausend Jahren fast sämtliche Arten der Ordnung regelrecht verfolgt und einige von ihnen bereits der Vertilgung nahegebracht hat.
Bei Gefahr verteidigen die Wale sich gegenseitig, zumal die Mütter ihre Kinder mit großem Mut. Die kleineren gebrauchen ihr starkes Gebiß; die größeren versuchen nur durch unbändige Bewegungen Angriffe abzuwehren. Im Verhältnis zu ihrer Größe sind die ungeschlachten Tiere höchst ungefährliche Gegner desjenigen Feindes, der ihnen den größten Schaden zufügt. Der Mensch kümmert sich im ganzen wenig um das Toben und Wüten der von ihm angegriffenen Riesen, weil er Mittel zu finden weiß, auch deren größte Anstrengungen zu vereiteln.
Im Anfang hat sich der Mensch wahrscheinlich bloß mit denjenigen Walen begnügt, die ihm das Meer selbst zuführte, d.h. mit solchen, die durch Stürme auf den Strand geworfen wurden. Erst später dachte er daran, sich mit den Riesen des Meeres im Kampfe zu messen. Man schreibt den Basken die Ehre zu, das erste Volk gewesen zu sein, das im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert eigentliche Schiffe für den Walfischfang ausrüstete. Anfangs begnügten sich diese kühnen Seefahrer, die Finnfische in dem nach ihrem Lande genannten Golf aufzusuchen; aber schon im Jahre 1372, bald nach der Entdeckung des Kompasses, steuerten sie nach Norden und fanden hier die eigentlichen Walfischgründe auf. Es steht fest, daß sie schon, trotz aller Gefahr der unbekannten Meere und des furchtbaren Klimas, bis an die Mündung des Lorenzstromes und an die Küste von Labrador vordrangen. Um das Jahr 1450 rüsteten die Reeder von Bordeaux ebenfalls Walfischfahrer aus und suchten die wertvolle Beute in den östlichen Teilen des nördlichen Eismeeres auf. Bürgerkriege lähmten Schiffahrt und Handel der Basken, und der im Jahre 1633 erfolgte Einfall der Spanier in ihr Land beendete ihren Walfischfang für immer. Ihre großartigen Erfolge aber mochten die Habsucht anderer Seevölker erweckt haben; denn schon im sechzehnten Jahrhundert zeigten sich englische und bald darauf holländische Walfischfahrer in den grönländischen Meeren. Man sagt, daß die ausgewanderten baskischen Fischer den beiden nördlichen Völkern die Kunst des Walfischfanges gelehrt haben. Die Stadt Hull rüstete im Jahre 1598 die ersten Schiffe aus; in Amsterdam wurde 1611 eine Gesellschaft gebildet, die ihre Jagdfahrten nach den Meeren von Spitzbergen und Nowaja Semlja richteten. Bald nahm dieser Teil der Seefahrt einen bedeutenden Aufschwung. Schon sechzig Jahre später verließen hundertdreiunddreißig Schiffe mit Walfischfängern die holländischen Häfen. Die Blütezeit des Fanges trat später ein. In den Jahren 1676 bis 1722 sandten die Holländer fünftausendachthundertsechsundachtzig Schiffe aus und erbeuteten in dieser Zeit 32907 Wale, deren Gesamtwert damals mindestens dreihundert Millionen Mark unseres Geldes betragen haben mag. Noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts wurde die gewinnreiche Jagd eifrig betrieben. Friedrich der Große ließ im Jahre 1768 Walfischfänger ausrüsten; die Engländer hatten etwa um dieselbe Zeit zweihundertzweiundzwanzig Schiffe auf den nördlichen Meeren.
Gegenwärtig sind die Amerikaner die eifrigsten Walfänger. Nach einer von Scammon gegebenen Zusammenstellung beschäftigten sich in dem Zeitraume von 1835 bis 1872, also in achtunddreißig Jahren, 19 943 Fahrzeuge, und zwar 17685 Barken und Vollschiffe, 907 Briggs und 1351 Schoner und Sloops, mit dem Walfischfange, gewannen 3 671 772 Tonnen oder Fässer Walrat sowie 6 553 014 Tonnen Tran und erzielten dafür die Summe von 272 274 916 Dollars. Nach Scammons Schätzung wurden, um dies zu erreichen, alljährlich 3865 Pottfische und 2875 Bartenwale getötet, wozu noch ein Fünftel an verwundeten und verlorenen gerechnet werden muß, so daß man die Gesamtsumme aller innerhalb des gegebenen Zeitraumes erbeuteten oder doch vernichteten Wale auf nicht weniger als 292 714 annehmen darf.
Bei dem ungeheuren Aufschwung, den die Schiffahrt genommen hat, darf es uns nicht wundernehmen, daß zurzeit alle Polarmeere, die den kühnen Seefahrern nicht unüberwindliche Hindernisse entgegensetzen, besucht werden. Die Schiffe verlassen ihre heimischen Häfen schon im März oder im September, je nachdem sie mit Beginn des Sommers in dem nördlichen oder im südlichen Eismeer fischen wollen. Dort bleiben die meisten Fänger bis zum September, einige wohl auch bis zum Oktober, hier bis zum März oder spätestens bis zum April. Der Fang ist im ganzen wenig gefährlich, wohl aber die Fahrt. Jedes Jahr bringt der Walfischflotte schwere Verluste. Von dreiundsechzig Schiffen im Jahre 1819 gingen zehn, von neunundsiebzig im Jahre 1821 elf, von achtzig im Jahre 1830 einundzwanzig zugrunde. Am gefährlichsten wird den Walfahrern die Ostküste der Baffinsbai, bezüglich der Versuch, die große Eisbarre zu durchdringen, die diesen Meeresteil fast ganz erfüllt. »Wird«, sagt Hartwig, »auf dieser engen und gefährlichen Durchfahrt das Schiff vom Treibeise gegen die fest ansitzenden Eismassen gestoßen, so ist dessen Verlust unvermeidlich, den seltenen Fall ausgenommen, daß es durch den Druck aus dem Wasser gehoben und später, beim Auseinandergehen des Eises, wieder in die Fluten gesenkt wird. Zum Glück gehen bei solchen Schiffbrüchen nur selten Menschenleben verloren, da das Meer fast immer ruhig ist und die Mannschaft Zeit genug hat, sich auf andere Schiffe zu retten. Der Walfang überhaupt ist nicht nur ein sehr gefährliches und anstrengendes, sondern auch ein höchst unzuverlässiges Geschäft, so daß bei ihm das Ostender Sprichwort: »Vischerie – Lotterie« sich vollkommen bewährt. Oft gelingt es in kurzer Zeit, das ganze Schiff mit Tran und Fischbein zu beladen, wobei natürlich der Reeder ein glänzendes Geschäft macht und die ganze Bemannung sich eines reichlichen Lohnes erfreut; manchmal aber ist am Ende der Fahrt auch kein einziger Fisch gefangen worden, und dann hat die Mannschaft, die für ihren Lohn auf einen Teil des Fanges angewiesen ist, alle Not und Mühe umsonst gehabt, und der Unternehmer ist um eine bedeutende Summe ärmer.
Wie sehr der Walfang von den Launen des Zufalls abhängt, geht aus folgenden amtlichen Angaben deutlich hervor. Im Jahre 1718 wurden von den hundertacht Schiffen der holländischen Grönlandsflotte 1291 Fische gefangen, deren Wert etwa zwölf Millionen Mark betrug; im folgenden Jahre dagegen erbeuteten hundertsiebenunddreißig Schiffe bloß zweiundzwanzig Wale. Infolge dieses entmutigenden Ergebnisses rüstete man das nächste Mal nur hundertsiebzehn Schiffe aus; diese fingen aber 631 Walfische und entschädigten die Reeder einigermaßen für den erlittenen Verlust.« Daß bei einer ebenso unumschränkten wie unvernünftigen Verfolgung auch die früher reichsten Jagdgründe verarmen müssen, ist selbstverständlich. Die Abnahme der Wale, die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sich steigerte, erregt das lebhafte Bedauern des Tierfreundes, vermindert glücklicherweise aber auch die Anzahl der unmenschlichen Jäger. Aus der obenerwähnten Zusammenstellung Scammons geht hervor, daß die amerikanische Walfischerei im Jahre 1854 ihre höchste Blüte erreicht hatte, von dieser Zeit an jedoch stetig zurückging. Während man in dem gedachten Jahre sechshundertachtundsechzig Schiffe ausrüstete und 73 696 Tonnen Walrat sowie 319 837 Tonnen Tran gewann, ist die Anzahl der Schiffe bis zum Jahre 1872 auf zweihundertachtzehn und die Ausbeute auf 44 881 Tonnen Walrat und 31 395 Tonnen Tran herabgesunken. Der Gewinn erreicht die Kosten der Ausrüstung nur noch in einzelnen Fällen, und diese Erwägung steuert der sinnlosen Vertilgung der teilnahmswerten, dem Menschen nur ausnahmsweise Schaden zufügenden Seetiere mehr als jede andere Rücksicht.
Der Fang der Wale ist schon so oft und so ausführlich beschrieben worden, daß ich mich aus die kürzeste Schilderung desselben beschränken darf. Wenn die Schiffe in den Walgründen angekommen sind, kreuzen sie entweder in bestimmten Breiten auf und nieder oder legen sich an irgendeiner günstigen Stellen vor Anker und beobachten von nun an unablässig das Wasser. Der Ausruf des Mannes im Mastkorbe: »Dort blasen sie!« bringt die gesamte Mannschaft in eine unglaubliche Aufregung. Sorgfältig ausgerüstete Boote Die Handharpune ist natürlich längst durch eine Harpunenkanone (vgl. Abb.) ersetzt worden, die zudem nicht mehr von Booten, sondern von den kleinen Fangdampfern selbst bedient wird. Im nördlichen Eismeer sind übrigens die Wale so nahezu restlos ausgerottet worden, daß die norwegische Regierung sich – leider viel zu spät – veranlaßt gesehen hat, ein Schutzgesetz zu erlassen, das – eine seltsame Ironie des Schicksals – nun nicht mehr den Walen, sondern ihren Vernichtern zugutegekommen ist insofern, als die norwegische Regierung den Walfängern nunmehr eine Entschädigung für ihre, sowieso unrentabel gewordenen Betriebe gezahlt hat. Heute arbeiten die norwegischen Fangsleute in der Antarktis, und so wird es nicht mehr lange dauern, bis auch die Wale zu den ausgestorbenen Tieren gehören. Herausgeber. werden ausgesetzt, jedes von ihnen mit sechs bis acht tüchtigen Ruderern, einem Steuermann und dem Harpunenwerfer bemannt, und alle jagen nun so eilig als möglich den ruhig ihren Weg schwimmenden Walen entgegen. Die Angriffswaffe, deren sich der Harpunier bedient, ist ein lanzenartig zugespitztes, scharfes, mit Widerhaken versehenes Eisen, das an einer sehr langen und äußerst biegsamen Leine befestigt wurde. Letztere liegt auf einer leicht drehbaren Walze im Vorderteil des Bootes sorgfältig aufgerollt. Beim Näherkommen rudert man langsam und vorsichtig auf den Walfisch zu, je näher, um so besser, und der Harpunier wirft nun mit voller Kraft das scharfe Eisen in den Leib des riesigen Tieres. In demselben Augenblick schlagen alle Ruder in das Wasser, um das Boot aus der gefährlichen Nähe des verwundeten Ungeheuers zu entfernen. Gewöhnlich taucht der Wal sofort nach dem Wurf blitzschnell in die Tiefe und wickelt dabei die Leine so rasch ab, daß man Wasser auf die Rolle gießen muß, um die Entzündung derselben zu verhindern. Die große Schnelligkeit der ersten Schwimmbewegung hält jedoch nicht lange an. Der Wal schwimmt ruhiger, und seine furchtbaren Feinde sind jetzt imstande, die Verfolgung wieder aufzunehmen. Freilich kommt es auch vor, daß das Boot von dem fliehenden Tiere mit rasender Schnelligkeit stunden-, ja halbe Tage lang nachgeschleift wird. Nach einer Viertelstunde etwa erscheint der Verwundete wieder an der Oberfläche, um zu atmen. Das eine oder andere Boot nähert sich ihm zum zweiten Male, und ein neuer Wurfspieß dringt in seinen Leib. »Die menschliche Einbildung«, sagt ein Augenzeuge, »kann sich nichts Schrecklicheres vorstellen, als die Schlächterei, die man hier sieht. Entsetzt stürzt sich der Walfisch von Woge zu Woge, springt im Todeskampfe aus dem Wasser heraus und bedeckt das Meer umher mit Blut und Schaum. Er taucht unter, indem er einen Wirbel auf seinem Pfade zurückläßt; er kommt empor, und die tödliche Lanze dringt in einen noch unberührten Lebensquell; wohin er sich auch kehrt, das kalte Eisen stachelt ihn zur Verzweiflung auf. Im vergeblichen Aufwande seiner Stärke macht er die See kochen wie in einem Topfe; ein Zittern ergreift seinen ungeheuren Leib und schüttelt ihn wie der erwachende Vulkan die Wand des Berges. Endlich hat er sich verblutet, senkt sich auf die Seite und wird nun verächtlich von den Meereswogen umhergeschleudert, ein willkommenes Ziel für Tausende von Vögeln, die augenblicklich herbeikommen, in der Absicht, von dem riesigen Aas zu speisen.«
Der getötete Wal geht rasch in Fäulnis über. Schon einen Tag nach seinem Tode ist er zu einer ungeheuren schwammigen Masse angeschwollen, und gar nicht selten treiben die sich entwickelnden Gase den Leichnam so auf, daß er unter heftigem Knall berstet und dabei einen unerträglichen Gestank verbreitet. Gewöhnlich haben die Walfischfänger ihre Arbeit schon beendet, ehe die Fäulnis beginnt. Man schleppt den erlegten Riesen an einem starken Seil mit mehreren Booten nach dem Schiff, befestigt ihn dort und schreitet nun zum Einschneiden. Am Hauptmast hat man zwei schwere Rollen angebracht; durch diese laufen starke Taue, deren Enden auf der einen Seite an der Ankerwinde befestigt sind, auf der andern über Bord herabhängen. An ihnen befestigt man den ungeheuren Kopf, um ihn bis zu den Halswirbeln emporzuwinden. Im Genick trennt man ihn von dem übrigen Körper, den man an großen Haken zum Zerschneiden aufhängt. Der Kopf wird mittlerweile auf das Deck gezogen und später dort des Fischbeins, der Zähne bzw. des Walrats beraubt. Die Speckschneider stehen auf schmalen Gerüsten, die an den Seiten des Schiffes hängen. Sie stechen zuerst um den Körper herum, über den Rücken und Bauch meterbreite Streifen ab, befestigen einen solchen Streifen an einem Tau und geben das Zeichen zum Aufwinden. Während die einen die Ankerwinde in Bewegung setzen, helfen die Untenstehenden mit ihren scharfen Spaten nach und trennen den Speck von dem infolge des Aufwindens sich drehenden Leibe ab. So fährt man fort, bis aller Speck in schraubenartig gewundenen Streifen vom Leibe abgeschält ist. Der Rumpf bleibt dem Meergetier überlassen.
Nach dem Aufwinden kommt der Speck in das Zwischendeck, wo er zuerst von mehreren Leuten in größere Stücke und sodann durch eine Maschine in dünne Scheiben geschnitten wird. Das Auskochen geschieht in großen, auf dem Verdeck eingemauerten Kesseln, deren Herd ringsum mit Wasser umgeben ist. Im Anfang verwendet man Steinkohlen zur Feuerung, später benutzt man die übrigbleibenden Stücke des ausgekochten Specks zur Unterhaltung der Flamme. Der gewonnene Tran wird in einer Kühlpfanne abgekühlt und dann sofort in die Tonnen gefüllt, die man im untersten Schiffsraum verladet. Kleine Wale weidet man aus, zerhackt sie sodann in Stücke und kocht diese. »In ihren schlechtesten Kleidern«, so schildert Pechuel-Lösche, »halbnackt, tanzend und singend, sich jagend und ihre Gerätschaften schwingend, triefend von Tran und rußig wie die Teufel, tummeln sich die Schiffsleute um den Herd. Ein doppelt reges Leben herrscht überall an Bord. Überraschend zumal ist der Anblick dieses Treibens des Nachts, wenn in einem erhöhten eisernen Korbe behufs der Beleuchtung ein Haufen ausgesottener Speckstücke lustig brennt und die lodernden Flammen grelle Streiflichter auf das Deck, die schwarzen Rauchwolken, die ragenden Masten mit ihren Segeln und weit hinaus auf die Wellen werfen. Am Tage verraten mächtige Rauchmassen im Gesichtskreise einen auskochenden Walfänger lange, bevor man das Schiff selbst in Sicht bekommt.«
War der Wal ein Bartenwal, so werden, nach Angabe des ebengenannten Berichterstatters, die auf dem Vorderschiff aufgestapelten, schon in kleinere Stücke zerlegten Fischbeinsiebe einer abermaligen Bearbeitung unterzogen, um sie in einzelne Platten zu zerlegen und von der anhängenden Gaumenhaut zu befreien. Nachdem man sie soweit gereinigt, verstaut man sie einstweilen im hinteren Raume des Zwischendecks, um sie später, wenn das Schiff aus den hohen Breiten in wärmere Gewässer zurückkehrt, einer nochmaligen Behandlung durch Wasser zu unterziehen, nämlich mit Besen blankzuscheuern, an der Luft zu trocknen und endlich in Bündel zu packen.
*
Die Wale trennt man naturgemäß in zwei Hauptgruppen, die man mit Fug und Recht als Unterordnungen bezeichnen darf, in die Zahn- und Bartenwale. Bei ersteren ( Denticete) finden sich in beiden oder mindestens in einem Kiefer Zähne, die nicht gewechselt werden, bei einzelnen jedoch zum Teil oder gänzlich ausfallen können. Dieses Merkmal genügt, um sie in allen Fällen von den Bartenwalen zu unterscheiden.
Die erste Familie umfaßt die Delphine ( Delphinida), mittelgroße oder kleine Wale, bei denen beide Kiefern in ihrer ganzen Länge oder in einem Teile derselben mit fast gleichartig gebildeten, mehr oder weniger kegelförmigen Zähnen besetzt sind und deren Nasenlöcher in der Regel nur in einem einzigen querliegenden, halbmondförmigen, mit den Spitzen nach vorn gerichteten Spritzloch münden. Der Leib ist regelmäßig gestreckt, der Kopf verhältnismäßig klein, der Schnauzenteil desselben oft vorgezogen und zugespitzt, eine Rückenflosse gewöhnlich vorhanden.
Die Delphine beleben alle Meere der Erde und sind die einzigen Wale, die weit in den Flüssen emporsteigen, ja selbst ihre ganze Lebenszeit in ihnen und in den Seen, die mit jenen zusammenhängen, verbringen. Sie wandern wie die Wale von Norden nach Süden oder von Westen nach Osten und umgekehrt. Alle sind im hohen Grade gesellig; manche schlagen sich in sehr starke Scharen, die dann tage- und wochenlang miteinander im Meere hin und her streifen. Kleinere Arten vereinigen sich hierbei wohl auch mit Verwandten zu Trupps, die vielleicht wochenlang gemeinschaftlich jagen und dabei dem Anschein nach von einem Mitglied der Gesellschaft geleitet werden. Die Lebhaftigkeit aller Delphine, ihre geringe Scheu vor dem Menschen und ihre Spiele haben sie schon seit uralter Zeit Schiffern und Dichtern befreundet.
Fast alle Delphine schwimmen mit außerordentlicher Gewandtheit und Schnelligkeit und sind deshalb zum Fischfang im hohen Grade befähigt. Gerade sie gehören zu den furchtbarsten Räubern des Meeres; sie wagen sich selbst an den ungeheuren Walfisch und wissen diesen dank ihrer Ausdauer wirklich zu bewältigen. Ihre Hauptnahrung bilden Kopffüßler, Weich-, Krusten- und Strahlentiere; einzelne sollen aber auch Seetange und Baumfrüchte zu sich nehmen und diese sogar von den Bäumen, die sich über das Wasser neigen, abpflücken. Gefräßig, raubgierig und grausam sind sie alle. Was genießbar ist, erscheint ihnen als gute Beute; sie verschmähen nicht einmal die Jungen ihrer eigenen Art oder ihrer nächsten Verwandten. Unter sich betätigen sie innige Anhänglichkeit; sobald aber einer von ihnen getötet worden ist, fallen sie wie die Wölfe über den Leichnam her, zerreißen ihn in Stücke und fressen ihn auf. Zur Paarungszeit streiten die Männchen um den Besitz des Weibchens, und ein etwa im Kampfe getöteter Nebenbuhler wird wahrscheinlich ebenfalls verzehrt. Die Weibchen werfen nach einer Tragzeit von etwa zehn Monaten ein oder zwei Junge, säugen diese lange, behandeln sie mit der größten Sorgfalt und beschützen und verteidigen sie bei Gefahr.
Alle Delphine werden von dem Menschen ungleich weniger verfolgt als die übrigen Wale. Ihre schlimmsten Feinde sind ihre eigenen Familienglieder; aber mehr noch als irgendwelches Raubtier wird ihnen ihr Ungestüm verderblich. Sie verfolgen mit solcher Gier ihre Beute, daß sie oft durch diese auf den verräterischen Strand gezogen werden, gänzlich außer Fahrwasser geraten und scharenweise auf dem Trocknen verkommen müssen. Zuweilen finden die Fischer Dutzende von ihnen am Strande liegen. Im Todeskampf lassen sie ihre Stimme vernehmen, ein schauerliches Stöhnen und Ächzen, das bei einigen von reichlichen Tränengüssen begleitet wird.
Der Mensch gewinnt von vielen Arten einen erheblichen Nutzen; denn fast alle Teile des Leibes finden Verwendung. Man ißt das Fleisch, das Fett und die edleren Eingeweide, benutzt Haut und Gedärme und schmilzt aus ihrem Speck einen sehr gesuchten, feinen Tran.

Butskopf oder Schwertwal ( Orca orca)
Der Schwertfisch oder Butskopf ( Orca orca), Vertreter der gleichnamigen Sippe ( Orca), kann eine Länge von 9 Meter erreichen, bleibt jedoch meist erheblich hinter diesen Maßen zurück, indem er durchschnittlich kaum über 5 bis 6 Meter lang wird. Dieser Länge entsprechen reichlich 60 Zentimeter lange und 15 Zentimeter breite Brustflossen, eine etwa anderthalb Meter breite Schwanzfinne und eine kaum weniger lange Rückenfinne. Der Kopf ist im Verhältnis zur Größe des Tieres klein, das kleine, langgeschlitzte Auge nicht weit hinter der Mundspalte und wenig höher als dieselbe, das halbmondförmige Spritzloch über und hinter den Augen gelegen, der Hals nicht abgesetzt, der Leib spindelförmig gestreckt, auf der Rückenseite nur wenig, seitlich und unten stärker gewölbt, der Schwanz, dessen Länge fast den dritten Teil der Gesamtlänge einnimmt, gegen das Ende hin seitlich zusammengedrückt und oben und unten scharf gekielt, die verhältnismäßig kurze und breite Brustfinne etwa im ersten Viertel des Leibes seitlich und ziemlich tief unten angesetzt, an ihrer Einlenkungsstelle verschmälert, an der Spitze abgerundet, die etwas hinter dem ersten Drittel der Länge wurzelnde Rückenfinne sensenförmig und mit der Spitze oft seitlich umgebogen, die große Schwanzflosse zweilappig, in der Mitte eingebuchtet und an den Enden in Spitzen vorgezogen, die Haut vollkommen glatt und glänzend. Die Färbung scheint vielfach abzuändern. Ein mehr oder minder dunkles Schwarz erstreckt sich über den größten Teil der Oberseite, ein ziemlich reines Weiß über die Unterseite, mit Ausnahme der Schnauzen- und Schwanzspitze; beide Farbenfelder sind zwar scharf begrenzt, jedoch bei den verschiedenen Stücken nicht übereinstimmend verteilt.
Es scheint, daß der Schwertfisch in früheren Zeiten verbreiteter war als gegenwärtig. Die römischen Naturforscher geben auch das Mittelmeer als seine Heimat an. Er bewohnt das nördliche Atlantische, das Eismeer und vielleicht das nördliche Stille Meer, schwärmt jedoch regelmäßig bis zu den Küsten Englands, Frankreichs und Deutschlands hinab. Auffallenderweise erscheint er nicht in den Winter-, sondern in den Sommermonaten in den südlicheren Gewässern, indem er im Mai anzukommen und im Spätherbst zu verschwinden Pflegt. Nach Tilesius steht man ihn im Nordmeer gewöhnlich zu fünf und fünf, wie einen Trupp Soldaten, Kopf und Schwanz nach unten gekrümmt, die Rückenflosse wie ein Säbel aus dem Wasser hervorstehend, äußerst schnell dahinschwimmen und wachsamen Auges das Meer absuchen; nach Lösche vereinigen sich mindestens ihrer vier und niemals mehr als ihrer zehn. Sie sind nirgends häufig, finden sich aber ebensowohl inmitten der Weltmeere wie nahe an den Küsten, dringen hier auch nicht selten in Buchten ein oder steigen selbst weit in den Flüssen empor. Schwimmen sie in bewegter See, so sieht es aus, als ob ihnen die aufrechte Haltung der hohen Rückenfinne viel Beschwerden verursache, weil dieselbe zu dem schlanken Leibe in keinem Verhältnis zu stehen scheint und schwerfällig hin und her schwankt; der erste Eindruck aber verschwindet gänzlich bei genauerer Beobachtung. »Sieht man diese Mörder«, sagt Lösche, »in der ihnen eigentümlichen Schwimmweise durch das Wasser streichen oder bei hochgehender See in schön gerundeter Bewegung Welle auf und ab eilen, so stellt man unwillkürlich Vergleiche mit dem kunstvollen Fluge der Schwalben an, Vergleiche, die durch die eigentümliche Art der Farbenverteilung nur an Berechtigung gewinnen. Jedenfalls muß man unter allen Walen gerade ihnen den Preis der Schönheit zuerkennen. Sie halten sich gewöhnlich sehr lange unter Wasser auf, verweilen ungefähr fünf Minuten an der Oberfläche und blasen drei- bis zehnmal kurz und scharf einen einfachen, dünnen und niedrigen Strahl. Doch bleiben sie nicht während der ganzen Zeit mit dem Oberteil des Kopfes und Rückens über Wasser, sondern »runden«, wie es die echten Delphine tun, indem sie nach jedesmaligem Blasen untertauchen, dicht unter der Oberfläche hinziehen, wieder einen Augenblick erscheinen, um zu blasen usw., bis sie endlich in schräger Richtung in die Tiefe gehen.«
Ihre Jagd gilt nicht bloß kleineren Fischen, sondern auch den Riesen des Meeres; denn sie sind nicht nur die größten, sondern auch die mutigsten, raubsüchtigsten, gefräßigsten, blutdürstigsten und deshalb gefürchtetsten aller Delphine. Die Grönlandfahrer sehen sie oft bei Spitzbergen und in der Davisstraße. Mehrere von ihnen fallen den Walfisch an, ängstigen ihn und reißen mit ihrem furchtbaren Gebiß ganze Stücke aus seinem Leibe, wodurch er dermaßen entsetzt und abgemattet wird, daß er die Zunge herausstreckt. Um diese ist es den Mordfischen am meisten zu tun; denn sowie er den Rachen aufsperrt, reißen sie ihm die Zunge heraus. Daher kommt es, daß die Fänger dann und wann einen toten Walfisch antreffen, der die Zunge verloren hat. Pontoppidan beschreibt den Schwertwal unter dem Namen Speckhauer. »Ihrer zehn oder mehrere beißen sich in den Seiten des Walfisches so fest ein, daß sie daran wohl eine Stunde lang hängen und nicht eher loslassen, als bis sie einen Klumpen Speck von der Länge einer Elle herausgerissen haben. Unter ihrem Angriff brüllt der Walfisch jämmerlich, springt wohl auch manchmal klafterhoch übers Wasser in die Höhe; dann sieht man, daß sein Bauch ebenfalls von diesen seinen Feinden besetzt ist. Zuweilen tummeln sich diese so lange um ihr Schlachtopfer herum, bis sie es fast gänzlich abgehäutet und ihm den Speck abgerissen haben. Die Fischer finden dann zu ihrem Vorteil eine Menge Speck im Meere.« Infolgedessen verdient der Schwertfisch die ihm von Linné beigelegte Bezeichnung »Tyrann oder Peiniger der Walfische und Robben« vollständig und wetteifert nicht allein, sondern übertrifft sogar jeden Hai, jedes Raubtier der See überhaupt. Wo er sich zeigt, ist er der Schrecken aller von ihm bedrohten Geschöpfe; wo er auftritt, verlassen diese, falls sie es vermögen, die Gewässer. Keineswegs an seine hochnordische Heimat gebunden, durchschweift dieses furchtbare, ebenso schnelle und gewandte wie stürmische, gefräßige, grausame und blutgierige Tier weite Meeresstrecken, überall Tod und Verderben bereitend. Solange ein Trupp der Mordfische sich auf der Jagd befindet, eilt er ohne Aufenthalt seines Weges dahin; gesättigt aber gefällt er sich in wilden Spielen, indem jeder einzelne abwechselnd auf und nieder taucht, sich dreht und wendet, oft auch mit mächtigem Satze über das Wasser emporspringt oder sonstige Gaukelei treibt, dabei aber immer noch seinen Weg so rasch fortsetzt, daß die ganze Gesellschaft bald dem Auge entschwindet. Kein einziger Delphin ist imstande, mit dem Schwertfisch an Schnelligkeit zu wetteisern. Seine ungeheure Gefräßigkeit nötigt ihn oft, sich nahe der Küste auszuhalten, wo er insbesondere die von Fischen wimmelnden Flußmündungen aufzusuchen pflegt; bei Verfolgung größerer Beute aber schwimmt er auch meilenweit in das hohe Meer hinaus und meidet auf Tage, vielleicht auf Wochen die Nähe des Landes. Wo immer Grönlandwale, Weißwale und Seehunde sich finden, wird man, laut Brown, diesen ihren rastlosen Feind niemals vermissen. Der Weißwal wie der Seehund stürzen bei seinem Anblick angsterfüllt der Küste zu, ersterer in der Regel zu seinem Verderben, der letztere keineswegs immer zu seiner Rettung. Alle Walfänger hassen seinen Anblick; denn seine Ankunft ist das Zeichen, daß jeder Wal den von ihm bejagten Teil der See meidet, sei es auch, daß er sich zwischen dem Eise verbergen müsse, um der ihm drohenden Verfolgung zu entgehen. »Im Jahre 1827«, erzählt Holböll, »war ich Augenzeuge einer blutigen Schlächterei, die dieses raubwütige Tier verursachte. Eine große Herde Weißwale war in der Nachbarschaft von Gotteshafen auf Grönland von ihrem blutdürstigen Feinde verfolgt und in eine Bucht getrieben worden, aus der jene keinen Ausweg fanden. Hier rissen die Schwertfische die unglücklichen Belugas buchstäblich in Fetzen. Sie töteten viel mehr Weißwale, als sie zu verzehren imstande waren, so daß die Grönländer, abgesehen von ihrer eigenen Beute, noch einen erheblichen Anteil von der des Schwertfisches gewinnen konnten.« Die Robben wissen sich kaum vor ihrem furchtbarsten Feinde zu retten. In vielen Fällen wenden sie alle Mittel vergebens an; die Anstrengung und vielleicht mehr noch die Todesangst, die sie ausstehen, lähmen ihre Kräfte; der mordsüchtige Delphin erreicht sie, packt sie mit seinen zähnestarrenden Kiefern, erhebt sich mit ihnen über die Oberfläche des Wassers, schüttelt sie wie eine Katze die Maus, zermalmt und verschlingt sie. Und nicht mit einer Beute begnügt sich das gefräßige Ungeheuer, sondern bis zum Platzen, buchstäblich bis zum Ersticken füllt es mit ihnen und andern Tieren seinen nimmersatten Schlund. Eschricht entnahm dem Magen eines fünf Meter langen Schwertfisches dreizehn Meerschweine und vierzehn Robben, dem Rachen aber den fünfzehnten Seehund, an dem das Ungetüm erstickt war. Auch Scammon fand den Magen eines von ihm erlegten Schwertfisches mit jungen Seehunden angefüllt und konnte beobachten, daß selbst die größten Seelöwen es vermeiden, mit jenen zusammenzutreffen, vielmehr, solange Butsköpfe sich zeigen, auf den sicheren Felsen verweilen. Mit ebenso unbeschränkter Gier stürzt sich der Schwertfisch auch auf den Grönlandwal. »Gelegentlich«, sagt Brown, »findet man mehr oder minder große Stücke von Fischbeinplatten im Meere schwimmen, die aller Vermutung nach nur vom Schwertfisch abgerissen worden sein können und wahrscheinlich zu der Erzählung Veranlassung gegeben haben, daß der gefürchtete Delphin es namentlich auf die Zunge des Walfisches abgesehen habe.« Ob letzteres wirklich begründet ist, steht dahin; wahr aber scheinen alle Erzählungen zu sein, die von Angriffen der Schwertfische auf Grönland- und andere große Wale berichten. Drei oder vier solcher Ungeheuer werfen sich ohne Bedenken selbst auf den größten Bartenwal, der bei Wahrnehmung seiner furchtbarsten Feinde geradezu von Furcht gelähmt zu sein scheint und zuweilen sich kaum anstrengt, ihnen zu entgehen. »Der Angriff dieser Wölfe des Weltmeeres«, sagt Scammon, »auf eine so riesenhafte Beute erinnert an den von einer Meute gehetzten und niedergerissenen Hirsch. Einige hängen sich an das Haupt des Wales, andere fallen von unten über ihn her, während mehrere ihn bei den Lippen packen und unter Wasser halten oder ihm, wenn er den gewaltigen Rachen aufreißt, die Zunge zerfetzen. Im Frühling des Jahres 1858 wurde ich Augenzeuge eines solchen, von drei Schwertfischen auf einen weiblichen Grauwal und sein Junges ausgeführten Angriffes. Das Junge hatte bereits die dreifache Größe des stärksten Butskopfes erreicht und lag wenigstens eine Stunde mit den dreien im Kampf. Die grimmigen Tiere stürzten sich abwechselnd auf die Alte und ihr Junges und töteten endlich das letztere, worauf es auf den Grund des etwa fünf Faden tiefen Wassers herabsank. Im Verlauf des Kampfes wurde auch die Kraft der Mutter fast erschöpft, da sie verschiedene tiefe Wunden in der Brust und an den Lippen erlitten hatte. Sobald aber das Junge erlegen war, tauchten die Schwertfische in die Tiefe, um hier große Fleischstücke loszureißen, dieselben im Maul bis zur Oberfläche des Wassers emporzubringen und zu verschlingen. Während sie sich so sättigten, entrann die geängstigte Walmutter, jedoch nicht ohne einen langen Streifen blutgetränkten Wassers hinter sich zu lassen.« Wie dieser erfahrene Seemann und Walfischfänger fernerhin berichtet, hat man beobachtet, daß Schwertfische bei harpunierten Walen sich eingefunden und ungeachtet aller Abwehr seitens der Walfischfänger ihre oder richtiger jener Beute unter Wasser gezogen haben. Nach so vielen und übereinstimmenden Berichten läßt sich kaum an der Wahrheit derselben zweifeln, auch wenn man, mit Lösche, den allgemeinen, zu Übertreibungen reizenden Haß der Seeleute und ihre gestaltungstüchtige Einbildungskraft gebührend in Betracht zieht. Übrigens fand auch die Bemannung des Schiffes, auf dem Lösche beobachtete, einmal einen frisch getöteten Nordwal, dem die linke Unterlippe und der größte Teil der Zunge fehlte, der aber sonst keine Verwundung zeigte. »Seit einigen Tagen hatten wir Mörder gesehen und mußten diese unter solchen Umständen für die Täter halten.« Wahrscheinlich verschonen die furchtbaren Tiers keinen ihrer Verwandten, mit alleiniger Ausnahme des Potwales. In den Augen der Möwen und andern fischfressenden Seevögel sind sie willkommene Erscheinungen, weil bei den durch sie verursachten Schlächtereien immer etwas für jene abfällt. Nach Scammons Beobachtungen unterscheiden alle Möwen die Butsköpfe sehr wohl von andern Delphinen und begleiten sie soviel wie möglich fliegend auf weithin, in der Hoffnung, durch sie zu reicher Beute zu gelangen.
Über die Fortpflanzung der entsetzlichen Räuber fehlen uns zurzeit noch alle Nachrichten. Man weiß nicht einmal, wann die Weibchen ihre Jungen zur Welt bringen.
Obgleich der Schwertfisch, wie Steller sagt, fast gar kein Fleisch besitzt, sondern aus lauter flüssigem Fett besteht, wird doch nirgends regelmäßig auf ihn gejagt. Dies erklärt sich, laut Scammon, ebensowohl daraus, daß dieser Wal wegen seiner verschiedenartigen und unregelmäßigen Bewegungen jede Verfolgung erschwert, wie aus dem geringen Nutzen, den er, als eines der magersten Glieder seiner Familie, nach seinem Tod gewährt. Einzelne fängt man zuweilen in Flüssen. So kennt man drei Beispiele, daß Schwertfische in der Themse harpuniert wurden. Banks, der beim Fang des einen zugegen war, erzählt, daß der bereits mit drei Harpunen bespickte Schwertfisch das Fischerboot zweimal von Blackwall bis Greenwich und einmal bis Deptford mit sich nahm. Er durchschwamm den Strom, als er schon sehr schwer verwundet war, noch immer mit einer Schnelligkeit von acht Seemeilen in der Stunde, und behielt seine volle Kraft lange bei, obgleich er bei jedem Auftauchen eine neue Wunde erhielt. Niemand wagte, so lange er am Leben war, ihm sich zu nähern. Erst im Jahre 1841 wurde die genaue Beschreibung des Schwertfisches entworfen. Bei dem holländischen Dorse Wyk op Zee strandete ein fünf Meter langes Weibchen und gab einem tüchtigen Naturforscher Gelegenheit, es zu beobachten. Sein Gerippe gereicht dem reichen Museum zu Leyden zu ganz besonderer Zierde.
*
Der gemeinste Delphin unserer Meere ist der Braunfisch ( Phocaena communis), Vertreter der nicht eben artenreichen Sippe der Meerschweine ( Phocaena). Er erreicht eine Länge von 1,5 bis 2, in seltenen Fällen auch wohl 3 Meter und ein Gewicht von höchstens 500 Kilogramm. Der Kopf ist klein, die Schnauze breit und kurz abgerundet, das fast in gleicher Höhe mit der Mundspalte stehende Auge langgeschlitzt, der gelblichbraune Stern einem mit der Spitze nach unten gekehrten Dreiecke ähnlich, das in einiger Entfernung dahinter gelegene Ohr sehr klein, das zwischen den Augen im oberen Stirndrittel sich öffnende Spritzloch breit halbmondförmig, der Leib in der vorderen Hälfte gerundet, in der hinteren schwach seitlich zusammengedrückt und gekielt, unterseits ein wenig abgeflacht, der Schwanz, der etwa den dritten Teil der Gesamtlänge einnimmt, seitlich schwach zusammengedrückt, oben stärker, unten schwächer gekielt, die Schwanzfinne groß, in der Mitte stumpfwinkelig eingebuchtet, also zweilappig, die im ersten Viertel der Leibeslänge ziemlich tief angesetzte Brustfinne verhältnismäßig kurz und länglich eiförmig gestaltet, die Rückenfinne auf der vorderen und oberen Seite schwach gewölbt, auf der hinteren seicht ausgeschnitten, die vollkommen kahle Haut weich, glatt und glänzend, ihre Färbung oberseits ein dunkles Schwarzbraun oder Schwarz, mit grünlichem oder violettem Schimmer, unterseits, von der Spitze des Unterkiefers an schmal beginnend, nach hinten zu sich verbreiternd und an der Wurzel der Schwanzfinne endigend, reinweiß, die Färbung der Brustfinnen ein mehr oder weniger dunkles Braun. Zwanzig bis fünfundzwanzig Zähne in jedem Kiefer, also achtzig bis hundert im ganzen, bilden das Gebiß.
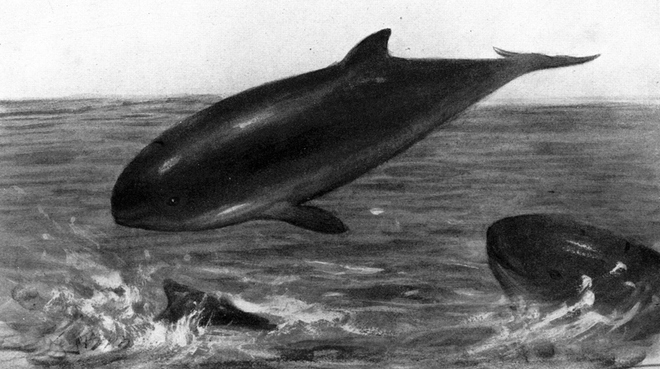
Braunfisch oder Tümmler ( Phocea communis)
Der Braunfisch ist es, dem man auf jeder Reise in der Nordsee begegnet, der die Mündungen unserer Flüsse umschwärmt und, ihnen entgegen schwimmend, gar nicht selten bis tief in das Innere des Landes vordringt. So hat man ihn wiederholt im Rhein und in der Elbe angetroffen, bei Paris und London erlegt. Laut Collingwood sieht man ihn alljährlich in der Themse bis Greenwich und Deptford hinauf, nach eigenen Erfahrungen ebenso in der unteren Elbe. Unter Umständen steigt er sehr weit flußaufwärts und verweilt monatelang im süßen Wasser, vorausgesetzt, daß ihm hier genügender Spielraum bleibt. Verbürgten Nachrichten zufolge hat man ihn in der Elbe noch oberhalb Magdeburgs gesehen und ihn einmal wochenlang im unteren Rheingebiete beobachtet.
Als die eigentliche Heimat des Braunfisches ist der ganze Norden des Atlantischen Weltmeeres, von Grönland bis Nordafrika, einschließlich der Ostsee, anzusehen. Außerdem schwärmt er, durch die Beringstraße gehend, im Großen Weltmeere umher und gelangt hier bis in die Breite der japanesischen Inseln. Es scheint, daß auch er regelmäßige Reisen unternimmt, mit Eintritt des Sommers nördlich geht und sich gegen den Winter hin wieder nach Süden wendet. So erscheint er, nach Brown, in der Davisstraße erst im Frühjahr, dringt jedoch nicht weiter als bis zum 67. Grad vor, verweilt bis zum Spätherbst in den hochnordischen Gewässern und verläßt diese dann wieder, um nach Süden zurückzukehren. Um dieselbe Zeit wie im hohen Norden dringt er auch in die Ostsee ein, verbringt in ihr meist den ganzen Sommer und Herbst und läßt sich manchmal erst durch den wirklichen Eintritt des Winters aus dem ihm dem Anschein nach lieb gewordenen Gewässer vertreiben. Im Frühling zieht er den Heringen nach und verfolgt sie mit solchem Eifer, daß er den Fischern oft im hohen Grad lästig wird. Seine Gefräßigkeit ist sprichwörtlich; er verdaut außerordentlich schnell und bedarf einer ansehnlichen Menge von Nahrung. Die Fischer hassen ihn, weil er ihr Gewerbe beeinträchtigt, ihnen auch manchmal wirklich Schaden zufügt. Ohne Mühe zerreißt er die dünnen Netze, die Fische bergen, und frißt behäbig die Gefangenen auf. Stärkere Netze freilich werden ihm oft zum Verderben, weil er in ihnen hängen bleibt und erstickt.
Wie schon aus vorstehendem ersichtlich, gehört der Braunfisch zu den wenigen Walen, die die Küstengewässer dem hohen Meere entschieden bevorzugen. Sunde und Straßen, Buchten und Fjorde bilden sein liebstes Jagdgebiet, nächstdem hält er sich, wie Scammon auch von einem seiner Verwandten sehr richtig hervorhebt, besonders gern in entfärbtem Meerwasser, d. h. auf allen zwischen den trübenden Flüssen und dem hohen Meere gelegenen Stellen auf und entfernt sich kaum jemals aus diesen oder jenen Gewässern. Gesellig wie alle Delphine, tritt er doch nur ausnahmsweise in größeren Scharen auf, schwimmt vielmehr einzeln oder paarweise, zu dritt, viert, sechst oder acht seines Weges dahin. Auch er ist ein vorzüglicher Schwimmer, teilt mit großer Kraft und überraschender Schnelligkeit die Wellen und ist imstande, sich springend über diese zu erheben, steht jedoch andern größeren Delphinen in allen Beziehungen nach, gefällt sich wenigstens nicht so oft wie sie in jenen spielenden Kraftäußerungen, die die Delphine insgemein auszuführen pflegen. Seine Gewohnheit ist, mehr oder minder unter der Oberfläche dahinzuschwimmen, für einen Augenblick emporzukommen, Luft zu wechseln und, kopfvoran, wieder in der Tiefe zu verschwinden. Hierbei krümmt er seinen Leib so stark, daß er förmlich kugelig aussieht, und wenn er rasch nach einander auftaucht, gewinnt es den Anschein, als ob er ununterbrochen Purzelbäume schlage. Besonders lebhaft tummelt er sich, wie dies schon die Alten wußten, vor oder während eines Sturmes im Wasser umher; er wälzt sich dann, anscheinend jubelnd, in den rollenden Wellen umher, überschlägt sich und wird buchstäblich zum Tümmler. Selbst in der schwersten Brandung findet er kein Hindernis, sucht dieselbe vielmehr oft in ersichtlicher Weise auf und weiß allen Gefahren der andern Walen so verderblichen Küste geschickt zu entrinnen. Bevor die Dampfschiffe aufkamen, war es viel leichter, diese Tiere zu beobachten, als gegenwärtig. Sie folgen zwar auch den Dampfern nach, doch bei weitem nicht mit derselben Furchtlosigkeit und Zudringlichkeit wie den stiller dahingleitenden Segelschiffen. Gewöhnlichen Kauffahrern sind sie, solange diese in der Nähe der Küsten verweilen, regelmäßige Begleiter. Sobald das Schiff oder auch nur ein Boot ausgelaufen ist, sammeln sich drei bis sechs Braunfische in einer Entfernung von zehn bis fünfzehn Meter um dasselbe und folgen ihm nun oft über eine Meile ununterbrochen nach, kommen ab und zu über die Oberfläche empor, gleichsam als wollten sie sich Schiffer und Bootsmannschaften betrachten, tauchen, schwimmen unter dem Kiel des Fahrzeuges durch, erscheinen wieder, eilen voraus, beschreiben einen Bogen und kehren von neuem zum Schiff zurück usw. Zuweilen, namentlich nachts, gesellen sie sich auch wohl zu den auf der Reede oder im Hafen ankernden Schiffen und umspielen dieselben ohne jegliche Scheu.
Die Brunst beginnt zu Anfang des Sommers, währt aber vom Juni bis zum August. Um diese Zeit sind sie aufs äußerste erregt, durcheilen pfeilschnell die Fluten, verfolgen sich wütend und jagen eifrig hinter dem Weibchen drein. Jetzt scheint es für sie keine Gefahr mehr zu geben. Sie schießen im blinden Rausch oft weit auf den Strand hinaus, rennen mit dem Kopf an die Seitenwände der Schiffe und finden hier oder dort ihren Tod. Nach neun- oder zehnmonatlicher Tragzeit, gewöhnlich im Mai, werfen die Weibchen ein oder zwei kleine, nur 50 Zentimeter lange und 5 Kilogramm schwere Junge, pflegen dieselben mit der allen Walen gemeinsamen, aufopfernden Liebe, verteidigen sie nach Kräften bei Gefahr und säugen und führen sie, bis sie das erste Lebensjahr erreicht haben; denn solange soll es dauern, ehe sie als erwachsen gelten können. Die reichlich vorhandene Milch der Weibchen schmeckt salzig und fischig.
Außer den Heringen, die zeitweilig die ausschließliche Nahrung der Braunfische bilden, verzehren diese noch Makrelen, Lachse, andere Fische und oft auch Tange; wenigstens findet man diese nicht selten in ihrem Magen. Der Lachse wegen steigen sie bis hoch in die Flüsse empor, und hier beeinträchtigen sie die Fischerei wirklich in sehr empfindlicher Weise. Tote Tiere oder Fleischstücke scheinen sie nicht zu fressen; wenigstens sah Lösche nie, daß diejenigen, die beim Umspielen des Schiffes von ihm gefüttert werden sollten, die ihnen zugeworfenen Fleischstücke erschnappten.
Der Braunfisch ist das einzige Mitglied seiner Ordnung, das ich bis jetzt in der Gefangenschaft gesehen habe. Es wurde mir erzählt, daß ein Amerikaner so glücklich gewesen sei, eine größere Walart längere Zeit am Leben zu erhalten; doch ist hierüber bis jetzt, soviel mir bekannt, nichts veröffentlicht worden. Im Tiergarten zu London hat man wiederholt Versuche angestellt, Braunfische und andere Delphine zu halten, ein befriedigendes Ergebnis aber noch nicht erlangt. Dasselbe war leider auch bei dem Braunfische der Fall, von dem ich aus eigener Erfahrung reden kann. Das Tier wurde mir im August von einem Fischer überbracht, der es am Abend vorher gefangen und die Nacht hindurch in einer Wanne aufbewahrt hatte. Es war anscheinend gesund und noch sehr munter, und ich hoffte deshalb, es wenigstens einige Tage lang erhalten zu können. Unser Wal wurde zunächst in einem tiefen Wassergraben ausgesetzt und schwamm auch sofort in demselben auf und nieder. Die Oberfläche des gedachten Grabens war jedoch gerade dicht mit Wasserlinsen bedeckt, und diese hinderten ihn beim Atemholen so, daß ich es für nötig fand, ihn in einen größeren Teich zu bringen. Hier hatte er genügenden Spielraum. Er durchkreuzte das Gewässer nach allen Richtungen und schien bereits nach einer Stunde eingewöhnt, wenigstens wohl bekannt zu sein; denn man sah ihn in ziemlich regelmäßigem Wechsel bald hier, bald dort auftauchen, Atem holen und wieder verschwinden. Ob er den in dem Teich befindlichen Fischen nachgestellt hat oder nicht, vermag ich nicht zu sagen; es schien jedoch, als ob er bei seinem Schwimmen irgendwelche Jagd betreibe. Um die Schwimmvögel auf dem Gewässer bekümmerte er sich nicht; sie dagegen betrachteten ihn mit entschiedenem Mißtrauen. Wo auch das schwarze Tier auftauchen mochte, entstand Unruhe. Die Schwäne reckten ihren Hals lang empor und blickten mit größter Verwunderung und Teilnahme nach dem Störenfriede; die Gänse und Enten verließen das Wasser und flüchteten aufs Land, von wo aus sie dann aufmerksam den Bewegungen des Tieres folgten. So trieb es der Braunfisch während des ganzen Tages. Er schwamm ruhelos auf und nieder, mied die flachen Stellen des Teiches sorgfältig und bevorzugte dafür die Mitte, blies seinen Wasserstrahl in regelmäßigen Zeitabschnitten empor und gab uns Gelegenheit, sein Treiben zu beobachten, freilich nur auf Augenblicke; denn das trübe Wasser hinderte zu meinem Bedauern, ihn auch unter der Oberfläche zu verfolgen. Schon am andern Morgen war er verendet. Dieses schnelle Dahinscheiden ist mir rätselhaft geblieben. Es liegt kein Grund vor zu glauben, daß Süßwasser einem luftatmenden Seetier so schnell verderblich werden könne; unsere Erfahrungen widersprechen einer solchen Annahme auch geradezu. Ebensowenig läßt sich denken, daß ein Tier von der Größe des Braunfisches schon innerhalb achtundvierzig Stunden dem Mangel an Nahrung erliege, und gleichwohl ist kaum etwas anderes als Todesursache anzunehmen; denn die Leichenschau ergab, daß der gedachte Gefangene vollkommen unverletzt war Somit scheint es wirklich, als wäre die bekannte Gefräßigkeit der Wale, wie beim Maulwurf, unumgängliches Bedürfnis zum Leben.
Wegen seiner oft höchst lästigen Räubereien wird der Braunfisch allerorten gehaßt und um so eifriger verfolgt, als auch Fleisch und Fett noch einen guten Ertrag liefern, überall, wo die Heringszüge regelmäßig ankommen, senkt man zur Zeit des Zuges starke, weitmaschige Netze in die Tiefe der Flüsse, durch die wohl die Heringe, nicht aber auch die Braunfische schlüpfen können. Auf Island stellen die Fischer ihre Netze bei Beginn der Brunstzeit aus, die den Braunfisch in einen so großen Rausch versetzt, daß er blind wird, wie die Leute sagen. In früheren Zeiten wurde sein Fleisch sehr geschätzt. Schon die alten Römer verstanden die Kunst, wohlschmeckende Würste aus ihm zu bereiten; spätere Köche wußten es so herzurichten, daß es, wie beispielsweise in England, sogar auf die Tafel des Königs und der Vornehmen gebracht werden konnte. Heutzutage bildet es für ärmere Küstenbewohner und für die oft an frischem Fleisch Mangel leidenden Schiffer eine notdürftige Speise, wird jedoch von allen Fischern zurückgewiesen, solange noch ein Ersatz desselben zu beschaffen ist. Das Fleisch alter Tiere sieht schwärzlich aus und ist derb, grobfaserig, zähe und tranig, deshalb auch schwer verdaulich; dasjenige aber, das von jüngeren Tieren stammt, wird als fein und wohlschmeckend gerühmt. Eingesalzen und geräuchert findet es bei den nicht verwöhnten Nordländern günstige Aufnahme. Der Tran ähnelt dem des Walfisches, ist aber feiner und wird deshalb mehr geschätzt. Die Grönländer benutzen ihn zum Schmalzen ihrer Speisen oder schlürfen ihn mit Wohlgefallen. Die Haut endlich wird gegerbt und dann als Leder verwendet. So überwiegt vielleicht der Nutzen den von diesem Delphin verursachten verhältnismäßig geringen Schaden.
*
Mertens, der als Schiffsarzt eines Walfischfahrers im Jahre 1671 Spitzbergen, das er für Grönland hielt, besuchte und über nordische Seetiere berichtete, erwähnt zuerst einen der auffallendsten Delphine: den Weißfisch oder die Beluga, die die Sippe der Weißwale ( Beluga) vertritt. Als das wichtigste Merkmal der hierhergehörigen Tiere mag das Fehlen einer Rückenflosse angesehen werden.
Die Beluga, der Weißwal oder Weißfisch ( Delphinapterus leucas) wird 4 bis 6 Meter lang; seine Brustfinne mißt 60 Zentimeter in der Länge und etwa die Hälfte in der Breite, und die starke Schwanzfinne erreicht etwa 1 Meter an Breite. Der länglichrunde Kopf ist verhältnismäßig klein, auf der Stirn stark gewölbt, das kleine Auge in einiger Entfernung hinter der Schnauze, das einfach halbmondförmige Spritzloch auf der Vorderseite der Stirn gelegen, der Leib langgestreckt, die zweilappige Schwanzfinne in der Mitte tief eingeschnitten, die Haut glatt, ihre Färbung bei alten Tieren gelblichweiß, bei jungen bräunlich oder bläulichgrau, später lichter gefleckt, bis nach und nach das Jugendkleid in das der Alten übergeht.
Der Verbreitungskreis der Beluga erstreckt sich über alle Meere rings um den Nordpol, dehnt sich aber nicht weit nach Süden aus. Ihre Heimat sind die Gewässer in der Nähe von Grönland, die Behringsstraße und das Behringsmeer, von wo aus sie alljährlich regelmäßige Reisen antritt. An der Küste von Dänisch-Grönland bemerkt man sie nur in den Wintermonaten; denn spätestens im Juni verläßt sie die Küste südlich des 72. Grades, um sich in die Baffinsbai und die westlichen Küsten der Davisstraße zu begeben; im Oktober begegnet man ihr auf der Wanderung nach Westen, im Winter sieht man sie, meist in Gesellschaft mit dem Narwal, zwischen oder unmittelbar an dem Eise. Erst im Oktober erscheint sie, laut Holböll, oft in Scharen von mehreren tausend Stück in der Nähe von Gotteshafen unter dem 69. Grade, anfangs Dezember beim Kap der Guten Hoffnung unter dem 64. Grade und etwas später zu Fischernes unter dem 63. Grade. Auf dieser Strecke hält sie sich in allen Buchten Südgrönlands während des ganzen Winters auf, begibt sich aber schon zu Ende des April oder mit Beginn des Mai langsam auf die Wanderung. In seltenen Fällen verirrt sie sich auch wohl nach südlichen Meeren, ist jedoch schon einige Male bis an die Küsten des mittleren Europa herabgekommen.
Nach Versicherung der Grönländer entfernt sich die Beluga selten weit vom Lande, gehört vielmehr wie der Braunfisch dem Küstengebiet an. Aus diesem Grunde steigt sie nicht allzuselten viele Meilen weit in den Flüssen auf, ist bei dieser Gelegenheit auch schon wiederholt tief im Lande, nach Dall im Jahre 1863 einmal bei Nulato im Yukonflusse, etwa siebenhundert englische Meilen von der See, gefangen worden. Kleine Fische, Krebse und Kopffüßler bilden ihre Nahrung; außer ihnen findet man auch regelmäßig Sand in ihrem Magen, was die Grönländer zu der scherzhaften Äußerung veranlaßt hat, daß sie ohne Ballast nicht zu schwimmen vermöge.
In ihrem Auftreten und Wesen unterscheidet sich die Beluga in jeder Beziehung von den stürmischen Schwertfischen und ebenso von den Meerschweinen. Fast niemals sieht man sie einzeln, vielmehr regelmäßig in Gesellschaften, die zu ungeheuren Scharen anwachsen können. Der Anblick einer solchen Herde soll, wie Faber sagt, ein wahrhaft prachtvolles Schauspiel gewähren, da die blendenden Tiere beim Atemholen bis zum halben Leibe aus den dunklen Meereswogen sich erheben und die See in unbeschreiblicher Weise schmücken. Nach Scammon halten sich in diesen Trupps, die aus Weibchen und Männchen zu bestehen pflegen, in der Regel ihrer zwei oder drei, also wohl das Paar mit einem Jungen, dicht nebeneinander. Auch die Beluga schwimmt vorzüglich und gefällt sich unter Umständen ebenfalls in Gaukeleien, steht hinsichtlich ihrer Beweglichkeit aber doch weit hinter dem Schwertfisch zurück. Bei ihren Jagden auf Bodenfische, beispielsweise Flunder, geschieht es nicht selten, daß sie in seichtes Wasser gelangt und sich in demselben kaum noch bewegen kann. Unter solchen Umständen benimmt sie sich jedoch sehr ruhig und unterläßt in der Regel jene heftigen Anstrengungen, die bei ähnlichen Gelegenheiten ihre Verwandten in große Gefahr bringen. Beim Auf- und Niedertauchen vernimmt man ein eigentümliches Tönen, das nach Scammon an das schwache Brüllen eines Ochsen erinnert, nach Brown aber auch in ein förmliches Pfeifen übergehen kann, so daß man unwillkürlich an einen Vogel erinnert wird und den Seemann versteht, wenn er die Beluga scherzhafterweise »Seekanarienvogel« nennt.
über die Fortpflanzung gibt der alte Steller eine wenig verbürgte Nachricht. »Das Weibchen«, sagt er, »führt seine Jungen auf dem Rücken mit sich fort und wirft dieselben, wenn es in Gefahr kommt, gefangen zu werden, sofort in die See.«

An den Strand getriebene Grindwale ( Globiocephalus melas)
Alle Walfischfänger begrüßen den Weißfisch mit Freude, weil sie ihn als einen Vorläufer des Walfisches ansehen, segeln deshalb auch oft in seiner Gesellschaft weiter, ohne ihn zu belästigen. Unter solchen Umständen kommt unser Delphin bis dicht an die Schiffe heran und gaukelt nach Behagen in unmittelbarer Nähe derselben auf und nieder, bleibt jedoch immer scheu und entflieht bei dem geringsten Geräusch. Für Grönländer und Eskimos ist die Beluga der wichtigste aller Wale, weil jene nicht allein den von ihr gewonnenen Tran sehr hoch schätzen, sondern auch ihr Fleisch als höchst notwendige Wintervorräte verwerten. Die meisten fängt man mit Hilfe von Netzen, die an den Eingängen der Fjorde und Busen oder in den Straßen zwischen Inseln ausgestellt werden. Genau in derselben Weise verfahren die Nord- und Ostsibirier, die das Erscheinen der Beluga auch aus dem Grunde mit Freuden sehen, weil sie die Ankunft verschiedener, in den seichten Buchten oder in den Flüssen laichenden Seefische, namentlich des Dorsches, Schellfisches, der Schollen und Lachsarten, anzuzeigen pflegt. Die meisten nordischen Völkerschaften stimmen darin überein, daß das Fleisch und der Speck der Beluga ein angenehmes Nahrungsmittel ist, und auch der alte Steller gibt ihnen hierin recht. Brust- und Schwanzfinne gelten, wenn sie gut zubereitet werden, als ganz besondere Leckerbissen. Die Haut wird getrocknet und gegerbt und findet dann vielfache Verwendung. So fertigt man auf Kamtschatka Riemen an, die ihrer Weichheit und Festigkeit wegen sehr geschätzt werden. Speck und Öl sind vorzüglich, leider aber in so geringer Menge vorhanden, daß sich nicht einmal die Kleinfischerei bezahlt macht.
*
Die hochnordischen Lande sind ebenso unwirtliche wie arme Landstriche. Sie allein vermögen nicht, den Menschen zu ernähren und zu erhalten. Der Getreidebau ist kaum der Rede wert; das tägliche Brot muß aus dem fernen, reicheren Süden eingeführt werden. Aber die Natur behandelt die Nordländer doch nicht so stiefmütterlich, als wir leicht glauben möchten. Was das Land ihnen verwehrt, ersetzt ihnen das Meer. Dieses ist der Acker, den der Nordländer bebaut; dieses ist seine Schatzkammer, sein Vorratshaus, sein ein und alles. In keinem Teil der Erde weiter ist der Mensch so ausschließlich an das Meer gebunden wie im hohen Norden; nirgendwo ist die Not größer als hier, wenn das Meer einmal seine reichen Schätze nicht in gewohnter Weise erschließt. Vogelfang und Fischerei, diese beiden Gewerbe sind es, die die Nordländer ernähren.
Unter allen Gaben nun, die das Meer darbietet, ist für die Nordländer keine wichtiger als der Grind oder Grindwal ( Globiocephalus melas), ein Vertreter der Sippe der Rundkopfwale ( Globiocephalus), deren Merkmale in dem tatsächlich fast kugelförmigen, wie geschwollen erscheinenden Kopfe, den weit unten eingelenkten sichelförmigen Brustflossen, der von der Mitte des Körpers sich erhebenden Rückenflosse, den breiten, die Oberkiefer bedeckenden Zwischenkiefern und den zwölf bis vierzehn kegelförmigen Zähnen jederseits zu suchen sind. Auch abgesehen von dem kugeligen Kopfe unterscheidet sich der Grind durch die Gestalt seines Leibes sehr erheblich von den bisher genannten und noch zu erwähnenden Delphinen. Der Leib ist nicht spindelförmig, sondern seitlich zusammengedrückt, die Linie des Rückens bis unmittelbar vor der Schwanzflosse fast gerade, von hier aus steil nach dem Schwanze abfallend, die Bauchlinie insbesondere am Vorderteil stark gewölbt, die Seitenlinie vom Kopf an in sanftem Bogen nach dem Schwanze zu verjüngt. Die kahle, glatte und glänzende Haut ist oberseits tiefschwarz, unterseits graulichschwarz gefärbt, ziemlich regelmäßig, aber auf der Unterseite des Halses mit einem breiten, weißen, herzförmigen Flecken geziert, dessen Spitze sich nach rückwärts kehrt, bei einzelnen Stücken auch wohl in einen schmalen, bis hinter die Geschlechtsteile sich ausdehnenden Streifen übergehen kann. Sehr alte Männchen erreichen eine Länge von 6 bis 7 Meter, die Mehrzahl bleibt jedoch hinter diesen Maßen um 1 bis 1,5 Meter zurück. Bei einem 6 Meter langen Grinde beträgt der Umfang des Leibes an der dicksten Stelle 3 Meter, die Länge der Brustfinne 1,6 Meter, die größte Breite derselben 50 Zentimeter, die Höhe der Rückenfinne 1,3, die Breite der Schwanzfinne 1,8 Meter.

Gelandete Grindwale ( Globiocephalus melas)
Obwohl der Grind fast alljährlich an dieser oder jener nordischen Insel, durch eigenes Ungeschick oder vom Menschen getrieben, auf den Strand läuft und, wie im Eingange erwähnt, für die Inselbewohner von erheblicher Bedeutung ist, haben wir doch über sein Werden und Sein, sein Leben und Treiben im hohen Meere, sein Wesen und Gebaren bis jetzt nur sehr dürftige Nachrichten erhalten. Als seine wahre Heimat haben wir das Nördliche Eismeer und wahrscheinlich auch wohl den nördlichsten Teil des großen Stillen Meeres anzusehen; es erscheint mindestens noch fraglich, ob der von Cope unterschiedene, zu Ehren Scammons benannte Schwarzwal ( Globiocephalus Scammoni) artlich vom Grind sich unterscheidet, oder ob derselbe nicht vielmehr als eine Spielart des Grindwales bezeichnet werden darf. Im nördlichen Eismeer ist dieser zwar überall bekannt, tritt aber nirgends regelmäßig auf, sondern wird nur gelegentlich gesehen, so beispielsweise nach Brown in den Sommermonaten längs der ganzen Küste von Dänisch-Grönland. Vom Eismeer aus durchschwärmt er ebenso unregelmäßig den nördlichen Teil des Atlantischen Meeres, unter Umständen selbst bis zur Breite der Straße von Gibraltar vordringend, folgt aber hierbei nicht mit derselben Bestimmtheit wie andere Wale gewissen Straßen. Im Großen Weltmeer scheinen die Verhältnisse etwas anderer Art zu sein; laut Scammon begegnet man ihm vorzugsweise da, wo auch der Kaschelot vorkommt, nicht allzuselten aber, zu zahlreichen Herden geschart, in der Nähe der Küste, und zwar in den nördlichen Teilen des Weltmeeres ebensowohl wie unter den niederen Breitengraden. Geselliger als seine Familien- und Ordnungsverwandten, lebt er stets in Trupps und Herden, die von zehn bis zwanzig zu tausend und mehr ansteigen können, wie es scheint, von alten erfahrenen Männchen geleitet werden und diesen mit derselben Gleichgültigkeit, richtiger Kopflosigkeit, nachfolgen wie die Schafe ihrem Leithammel, wäre es auch zu ihrem Verderben. Sie schwimmen mit bemerklicher Regelmäßigkeit und Stetigkeit durch die Wogen, laut Lösche, nach Art anderer Delphine, indem sie nach jedem Blasen »runden« und, dicht unter der Oberfläche hinziehend, zum Blasen kurz auftauchen, hierbei, durchschnittlich acht- bis zehnmal nacheinander, unter scharfem Geräusch einen dünnen, etwa meterhohen Strahl aufwerfend. Wenn sie sehr schnell schwimmen, erheben sie sich oft so weit über die Oberfläche, daß der größte Teil des Kopfes und ein guter Teil des Leibes sichtbar werden. Bei gutem, vollkommen stillem Wetter sieht man, insbesondere in niederen Breiten, nicht selten eine ganze Herde in wirrem Durcheinander förmlich gelagert, d. h. ohne jegliche Bewegung auf einer und derselben Stelle liegend, ohne mit dem Kopfe unterzutauchen und demgemäß auch ohne in der üblichen Weise zu spritzen, also wohl behaglicher Ruhe sich hingebend. Zu anderer Zeit gewährt man einzelne, die eine vollkommen senkrechte Stellung angenommen haben und den größten Teil des Kopfes aus dem Wasser herausstecken. An Schwimmfertigkeit steht der Schwarzwal wohl kaum hinter seinen größeren Verwandten zurück, scheint sich jedoch nicht in dem Grade wie diese in Spielen und Gaukeleien zu gefallen. »Ich habe«, bemerkt Lösche, »sie nur einmal spielen und springen sehen, und zwar während eines schweren Sturmes. Wir hatten beigedreht, um diesen auszuwettern, und sahen plötzlich dicht am Schiff eine enggeschlossene Schar von mehreren hundert Stück in größter Eile gegen die hochgehende See anschwimmen, indem sie sich im tollsten Übermut den heranrollenden Wellen entgegenwarfen, dieselben durchschnitten und sich auf der andern Seite in höchst drolliger Weise herausschnellten. Sie schienen sich an Kühnheit der Sprünge und Seltsamkeit der Stellungen gegenseitig überbieten zu wollen, schwammen mit sich gleichbleibender Eile weiter und entschwanden endlich unseren Blicken.«
Die Nahrung besteht vorzugsweise in verschiedenen Tintenfischen; doch fand man in dem Magen getöteter auch Dorsche, Heringe und andere kleine Fische, Weichtiere und dergleichen.
Über die Zeit der Fortpflanzung ist man noch nicht im klaren, und fast will es scheinen, als ob die Paarung an keinen bestimmten Monat gebunden sei, vielmehr während des ganzen Jahres stattfinden könne. In den nördlichen Meeren dürften die meisten Jungen zu Ende des Sommers geboren werden, da man in den Spätherbstmonaten und im Januar die meisten säugenden Weibchen nebst ihren Jungen beobachtet. Für das Stille Meer gilt diese Angabe jedoch nicht; laut Scammon fand man in einem an der Küste von Guatemala erlegten Weibchen im Februar einen fast ausgetragenen Keimling von beinahe Meterlänge, während man im südlichen Eismeer um diese Zeit höchstens halberwachsene Junge anzutreffen pflegt. Die Mutter liebt ihren Sprößling ebenso warm und innig wie andere weibliche Wale ihre Nachkommen und säugt ihn auch dann noch, wenn sie, auf den Strand geworfen, ihrem Tode entgegensieht.
Kein einziges anderes Waltier strandet so häufig und in solcher Menge wie der Grind, dessen Geselligkeit ihm bei Gefahr regelmäßig verderblich wird. Nicht allein, daß die gesamte Herde ihrem Leiter blindlings folgt, läßt sie sich auch durch die Klagelaute eines von Todesnot bedrängten Genossen herbeilocken und erleidet dann regelmäßig mit ihm dasselbe Schicksal. Vielleicht ist es nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß dieser Wal seinen Tod nicht im Meere, sondern am Lande findet. Kaum ein Jahr vergeht, in dem nicht hier oder da eine größere oder geringere Anzahl auf den Strand läuft. Im Jahre 1779 verunglückte eine Herde von zweihundert, 1805 eine von dreihundert Stück auf den Shetlandsinseln, ein Jahr später eine solche von zweiundneunzig an der kleinen, zu den Orkaden gehörigen Insel Pamona; in den Jahren 1809 und 1810 wurden elfhundert Stück in einer nach den Grinden Walfjord genannten Bucht auf Island ans Ufer geworfen; am 7. Januar 1812 strandete ein Trupp von siebzig Stück an der Nordküste der Bretagne, andrer Fälle nicht zu gedenken. Über die letzte Strandung erhielt Cuvier Bericht.
Zwölf Fischer, die in sechs Booten ihrem Gewerbe oblagen, bemerkten eine Stunde vom Lande eine große Anzahl Wale. Sie holten Hilfe und Waffen, hetzten die Tiere und trieben endlich ein Junges auf den Strand, dessen Geschrei oder Geplärr die andern eiligst herbeizog, so daß zuletzt die ganze Herde am Strande liegen blieb. Die Gelegenheit, so große und seltene Tiere zu sehen, zog eine Menge Menschen herbei, darunter auch Cuviers Berichterstatter, der nun das Betragen der jetzt so hilflosen Geschöpfe genau beobachten konnte. Die Herde bestand aus sieben Männchen und zwölf Jungen; alle übrigen waren alte Weibchen, von denen mehrere Junge haben mußten, weil ihre Euter so reich an Milch waren, daß diese in Zwischenräumen und selbst noch im Tode daraus hervorspritzte. Bei denen, die nicht mehr säugten, lagen die Zitzen in einer Grube des Euters verborgen. Die gestrandeten Tiere blieben einige Zeit am Leben, wurden aber schwächer und schwächer, stießen klägliche Töne aus, versuchten vergeblich, sich wieder zu befreien und erwarteten endlich den Tod, wie es schien, mit vollkommener Ergebung. Ein altes Männchen hielt fünf Tage aus, ehe es endlich dem Verderben erlag.
»Am 2. Juli«, so erzählt Graba über den Grindwalfang auf den Färöerinseln, »erscholl mit einem Male von allen Seiten her der laute Ruf ›Grindabud‹. Dieser Ruf zeigt an, daß ein Haufen Grindwale durch ein Boot entdeckt worden sei. In einem Augenblick war ganz Thorshaven in Bewegung; aus allen Kehlen erscholl es ›Grindabud‹, und allgemeiner Jubel verkündete die Hoffnung, sich bald an einem Stück Walfleisch zu erlaben. Die Leute rannten durch die Gassen, als ob die Türken landen wollten. Hier liefen einige zu den Booten, dort andere mit Walfischmessern; dort wieder trabte eine Frau ihrem Manne nach mit einem Stück trockenen Fleisches, damit er nicht verhungere; Kinder wurden über den Haufen gerannt; und vor lauter Eifer fiel einer aus dem Boot in die See. In Zeit von zehn Minuten stießen elf Achtmannsfahrer vom Lande; die Jacken wurden ausgezogen und die Ruder mit einem Eifer gebraucht, daß die Fahrzeuge wie ein Pfeil dahinschossen. Wir verfügten uns zum Amtmann, dessen Boote und Leute in Bereitschaft waren, und gingen mit ihm erst auf die Schanze, um von hier zu sehen, wo die Wale seien. Durch unser Fernrohr entdeckten wir zwei Boote, die Grindabud anzeigten. Jetzt stieg eine hohe Rauchsäule beim nächsten Dorfe auf, gleich darauf eine auf einem benachbarten Berge; überall flammten Zeichen; Boten wurden zu allen benachbarten Ortschaften gesandt; der Fjord wimmelte von Fahrzeugen. Wir bestiegen die Jacht des Amtmanns und hatten bald alle übrigen eingeholt. Jetzt erblickten wir die Wale, um die von allen Booten ein weiter Halbkreis geschlossen wurde. Zwischen zwanzig bis dreißig Boote, denen wir uns angeschlossen hatten, umringten, jedes etwa hundert Schritte voneinander entfernt, den Haufen und trieben ihn langsam vor sich her, der Bucht von Thorshaven zu. Der vierte Teil aller Wale war ungefähr sichtbar; bald tauchte ein Kopf hervor und spie seinen Wasserstrahl aus, bald zeigte sich die hohe Rückenfinne, bald der ganze Oberkörper. Wollten sie den Versuch machen, unter den Fahrzeugen durchzuschwimmen, so wurden Steine und Stücke Blei, an Schnüren befestigt, in das Wasser geworfen; schossen sie rasch vorwärts, so wurde gerudert, daß die Ruder abbrachen. Wo Unordnung herrschte, wo einige Boote sich zu weit vordrängten oder Fehler begingen, dahin ließ der Amtmann sich rudern, was so schnell geschah, daß schwerlich ein Pferd im gestreckten Galopp es mit der Jacht aufgenommen hätte. Als die Wale dem Eingange des Hafens nahe waren und nicht leicht mehr entrinnen konnten, eilten wir der Stadt zu. Der Strand wimmelte von Menschen, die dem Morden zusehen wollten. Wir wählten einen guten Standpunkt aus, von wo wir alles ganz in der Nähe betrachten konnten.
Je näher die Wale dem Hafen und dem Lande kamen, desto unruhiger wurden sie, drängten sich auf einen Haufen dicht zusammen und achteten wenig mehr des Steinewerfens und Schlagens mit den Rudern. Immer dichter zog sich der Kreis der Boote um die unglücklichen Schlachtopfer, immer langsamer zogen sie in den Hafen hinein, die Gefahr ahnend; jetzt, als sie in den Westervaag gekommen waren, der ungefähr zweihundertfünfzig Schritte breit und doppelt so lang ist, wollten sie sich nicht länger wie eine Herde Schafe treiben lassen und machten Miene umzukehren. Nun nahte der entscheidende Augenblick. Unruhe, Besorgnis, Hoffnung, Mordlust zeigten sich in den Gesichtern aller Färinger. Sie erhoben ein wildes Geschrei; alle Boote stürzten auf den Haufen zu und stachen mit ihren breiten Harpunen diejenigen Wale, die dem Boote nicht so nahe waren, daß der Schlag ihres Schwanzes dieses hätte zerschmettern können. Die verwundeten Tiere stürzten mit fürchterlicher Schnelligkeit vorwärts, der ganze Haufe folgte und rannte auf den Strand.
Nun begann ein fürchterliches Schauspiel. Alle Boote eilten den Walen nach, fuhren blindlings unter sie und stachen tapfer darauf los. Die Leute, die am Lande standen, gingen bis unter die Arme in das Wasser zu den verwundeten Tieren, schlugen ihnen eiserne Haken, an die ein Strick gebunden war, in den Leib oder in die Blaselöcher, und nun zogen drei bis vier Mann den Wal vollends auf das Land und schnitten ihm die Gurgel bis auf den Rückenwirbel durch. Im Todeskampf peitschte das sterbende Tier die See mit seinem Schwanze, daß das Wasser weit umherstob; die kristallhelle Flut des Hafens war blutrot gefärbt, und Blutstrahlen wurden aus den Blaseröhren in die Luft gespritzt. So wie der Soldat in der Schlacht alles menschliche Gefühl verliert und zum reißenden Tier wird, so entflammte die Blutarbeit die Färinger bis zur Wut und Tollkühnheit. An dreißig Boote, dreihundert Menschen, achtzig getötete und noch lebende Wale befanden sich auf einem Raum von wenigen Geviertruten. Geschrei und Toben überall. Kleider, Gesichter und Hände vom Blut gefärbt, glichen die sonst so gutmütigen Färinger den Kannibalen der Südsee; kein Zug des Mitleids äußerte sich bei dem gräßlichen Gemetzel. Als aber ein Mann durch den Schlag des Schwanzes eines sterbenden Wales niedergestreckt und ein Boot in Stücke zerschlagen war, wurde der letzte Teil dieses Trauerspiels mit mehr Vorsicht zu Ende gespielt. Achtzig getötete Wale bedeckten den Strand; nicht ein einziger war entkommen. Sobald das Wasser erst mit Blut gefärbt und durch das Schlagen mit dem Schwanze der sterbenden Wale getrübt ist, erblinden die noch lebenden und taumeln im Kreise umher. Entrinnt auch einer zufällig in das klare Wasser, so kehrt er doch sogleich in das blutige zu seinen Gefährten zurück.
Oft trifft es sich, daß der Grind sich nicht gut treiben lassen will, besonders wenn es große Haufen von mehreren Hunderten sind. Dann kehrt er sich nicht an das Steinewerfen, geht unter den Booten durch und verursacht den Leuten tagelange, oft ganz vergebliche Arbeit. Oftmals entwischt er, wenn er schon in eine der wenig geeigneten Buchten getrieben ist, durch die Hitze und Unvorsichtigkeit der Leute. Wenn diese nämlich zu früh stechen, so daß der Grind nicht mit einer Fahrt auf den Strand läuft, so kehrt er wieder um und läßt sich nicht zum zweiten Male treiben; oder wenn sie zuerst solche Grinde treffen, die nicht mit dem Kopf gegen den Strand gerichtet sind, so schießen diese Verwundeten in die See hinaus, und der ganze Haufe folgt. Tritt die Nacht ein, bevor man zum Schlachten kommt, so schließen die Boote einen engen Halbkreis vor der Bucht und die Leute zünden Feuer an; dann meint der Grind, es sei der Mond, zieht sich gegen denselben hin und hält sich ruhig bis zum Morgen, an dem dann die Blutarbeit beginnt.
Nach einer Stunde Ruhe wurden die Körper nebeneinandergelegt, geschätzt und ihre Größe mit römischen Zahlen in die Haut eingeschnitten. Die Verteilung geschieht nach der Größe des Landbesitzes, noch ebenso, wie sie seit undenklichen Zeiten vorgenommen wurde. Nachdem jedem Boot sein Anteil zugewiesen war, wurden die Fische zerlegt. Dies geschieht in folgender Weise. Sobald sie auf das Land gezogen sind, werden zuerst die Finnen ab- und dann der Körper in der Mitte durchgeschnitten. Nun wird der Speck in breiten Streifen, darauf das Fleisch in Stücken abgelöst, Leber, Herz und Niere, die schmackhaftesten Bissen für die Färinger, herausgenommen und darauf der Rumpf umgekehrt und mit der andern Seite ebenso verfahren.
Der Nutzen dieser Tiere für das Land ist sehr groß. Man rechnet im Durchschnitt auf jeden Wal eine Tonne Tran, die im Handel mit elf Taler bezahlt wird. Fleisch und Speck werden frisch gegessen und eingesalzen getrocknet. Je frischer das Fleisch zerschnitten wird, desto besser der Geschmack. Ich habe das frische Walfleisch gekocht recht gern gegessen; es hat Ähnlichkeit mit grobem, eingepökeltem Rindfleisch. Der Speck hat fast gar keinen Geschmack, war mir aber widerlich. Wenn die Färinger vierzehn Tage lang frisches Walfleisch gegessen haben, glänzen ihre Gesichter und Hände, sogar die Haare von Fett. Nach achtundvierzig Stunden ist das Fleisch nicht mehr zu genießen und wirkt als Brechmittel. Die Haut an den Finnen wird zu Riemen an den Rudern gebraucht, und von den Gerippen werden Einfriedigungen Solche Umzäunungen gibt es bei uns heute noch z. B. auf der Nordseeinsel Borkum. Borkumer Fischer gingen in früheren Jahrzehnten nämlich auch auf den Walfang. Herausgeber. um das Land gemacht; der Magen wird aufgeblasen und zur Aufbewahrung von Tran verwandt, so daß nur die Eingeweide ungenutzt bleiben, die durch Boote in die See hinausgeschleppt werden, damit sie nicht am Lande faulen.«
*
Kein anderer Wal, kein anderes Seetier überhaupt, hat die Dichter und Naturforscher der Alten in gleicher Weise beschäftigt, zu den glühendsten Schilderungen und zu der wunderlichsten Fabelei begeistert wie der Delphin. Er ist es, der Arion nach Tänarium zurückbringt, bezaubert von dem herrlichen Spiele und Gesange des Dichters, den räuberische Schiffer gezwungen hatten, ins Meer zu springen; er ist es, von dem Plinius die hübsche Geschichte des Knaben erzählt, der durch wiederholtes Füttern mit Brot in solchem Grade die Liebe eines Delphins sich erwarb, daß dieser ihn mehrere Jahre lang täglich über den Lucrinischen See nach Puteoli in die Schule trug und auf dieselbe Weise wieder nach Hause brachte. »Als der Knabe starb, erschien der Delphin noch immer am gewohnten Orte und grämte sich bald darauf über den Verlust seines Lieblings zu Tode.« Weiter wird gefabelt, daß im Altertum die Delphine beim Fange der Meerbarben behilflich waren, indem sie dieselben scharenweise in die Netze trieben und für diesen Dienst mit einem Teil der Beute und mit Brot belohnt wurden, das in Wein getränkt war. Der alte Geßner nimmt nicht allein die vorstehenden Angaben als unzweifelhafte Tatsachen gläubig hin, sondern weiß sie, dank seiner Belesenheit, noch durch viele andere zu vervollständigen, vergißt auch nicht zu erzählen »von Würdigkeit der Delphinen und wie hoch sie geachtet«.
Der Delphin vertritt mit einigen ihm sehr nahestehenden Arten eine besondere Sippe ( Delphinus). Ihre Merkmale sind folgende: Der verhältnismäßig kleine Kopf spitzt sich nach vorn in eine schnabelförmig verlängerte, dem Gehirnteil an Länge gleichkommende oder noch übertreffende Schnauze zu, deren Kiefer mit außerordentlich zahlreichen, kegelförmigen und bleibenden Zähnen besetzt sind; die Brustflossen stehen ganz seitlich, etwa im ersten Fünftel des Leibes; die Rückenfinne erhebt sich fast von der Mitte der Oberseite; die Schwanzflosse ist verhältnismäßig sehr groß und beinahe rein halbmondförmig gestaltet.
Der Delphin ( Delphinus delphis) erreicht durchschnittlich eine Länge von 2 Meter, der eine etwa 30 Zentimeter hohe Rückenfinne und eine 55 bis 60 Zentimeter lange und 15 bis 18 Zentimeter breite Brustfinne entspricht. Der verhältnismäßig kleine Kopf nimmt ungefähr den vierten Teil der ganzen Körperlänge ein und zeichnet sich aus durch leicht gewölbte, sanft abfallende Stirn, die durch eine Querfurche und eine hinter derselben befindliche wulstartige Erhöhung von der mittellangen, ziemlich gestreckten, vollkommen geraden, oben und unten flachgedrückten, schnabelartigen Schnauze sehr deutlich geschieden wird; die langgeschlitzten, herzsternigen Augen liegen in geringer Entfernung hinter und über den Mundwinkeln, das überaus kleine Ohr nahe hinter dem Auge, das Spritzloch zwischen den Augen. Der eher gedrungene als gestreckte, spindelförmige Leib ist in der Vorderhälfte des Körpers gerundet, in der hinteren seitlich schwach zusammengedrückt, die Rückenfinne schmal, hoch und spitz, am vorderen Rande gewölbt, am hinteren ziemlich tief ausgeschnitten, also fast sichelförmig, die Brustfinne, die im ersten Drittel des Körpers sich einlenkt, etwas länger und schmäler als die Rückenfinne, die in zwei stumpfspitzige Lappen geteilte Schwanzfinne nur in der Mitte ein wenig eingebuchtet, die Haut ungemein glatt und nicht bloß glänzend, sondern förmlich schillernd, oberseits grünlichbraun oder grünlichschwarz, unterseits scharf, jedoch nicht in gerader Linie begrenzt, blendend weiß, seitlich hier und da graulich oder schwärzlich gefleckt. Die Anzahl der Zähne unterliegt bedeutenden Schwankungen. Sie stehen in gleichmäßigen Abständen, durch kleine Zwischenräume getrennt, nebeneinander, so daß die oberen zwischen die unteren und die unteren zwischen die oberen eingreifen, sind langgestreckt, kegelförmig, sehr spitz und von außen nach innen schwach gekrümmt, die mittleren die längsten, die vorderen wie die hinteren, ziemlich gleichmäßig abnehmend, merklich kürzer.
 w
w
Delphin ( Delphinus delphis)
Alle Meere der nördlichen Halbkugel sind die Heimat dieses berühmten Tieres, das so erheblich zur Unterhaltung der Seefahrer und Reisenden beiträgt. In seinem Wesen und Treiben erinnert der Delphin in jeder Beziehung an seine begabteren Verwandten, nur zeigt er sich womöglich noch spiellustiger und launenhafter als alle. Bald treibt er sich, von der Küste entfernt, im hohen Meere herum, bald steigt er weit in den Flüssen empor. Seine Trupps kommen auf die Schiffe zu, umspielen diese lange Zeit, ehe sie wieder eine andere Richtung nehmen, tauchen ohne Unterlaß auf und nieder, erheben den Rücken des Kopfes auf Augenblicke über die Oberfläche des Wassers, wechseln unter schnaubendem Geräusch, indem sie einen dampfartigen Strahl ausstoßen, Luft und verschwinden wieder in der Tiefe. Sie schwimmen so außerordentlich rasch, daß sie nicht allein dem Gange des schnellsten Dampfschiffes mit Leichtigkeit folgen, sondern dabei noch allerlei Gaukeleien treiben und, wenn sie wollen, das Schiff nach Belieben umschwärmen, ohne dabei zurückzubleiben. Nach eigenen Beobachtungen halten sie sich meist nur in geringer Tiefe unter der Oberfläche und immer in einem dichtgedrängten Trupp, so daß der eine unmittelbar neben oder vor dem andern dahineilt. Gelegentlich schnellt dieser oder jener über das Wasser empor, fällt, ohne lautes Geräusch zu verursachen, köpflings wieder in die Tiefe hinab und nimmt eilfertig seine frühere Stellung wieder ein. Lösche schildert, meine Beobachtungen bestätigend, aber wesentlich erweiternd, ihr heiteres Treiben in trefflicher Weise. »Jeder Seemann«, sagt er, »freut sich immer wieder, wenn er eine sogenannte ›Schule‹ oder Schar von Delphinen sieht. In einen langen und verhältnismäßig schmalen Zug geordnet, eilen die lustigen Reisenden durch die leichtbewegte See; mit hurtigen Sprüngen und einer Schnelligkeit, als gelte es ein Wettrennen, verfolgen sie ihren Weg. Einen bis zwei Meter weit schnellen sich die glänzenden Leiber in zierlichen Bogen durch die Luft, fallen kopfüber in das Wasser und schießen von neuem heraus, immer dasselbe Spiel wiederholend. Die Übermütigsten der Schar überschlagen sich in der Luft, indem sie dabei in urkomischer Weise mit dem Schwanze wippen; andere lassen sich flach auf die Seite oder auf den Rücken fallen; noch andere springen kerzengerade empor und tanzen, indem sie sich drei-, viermal mit Hilfe des Schwanzes vorwärts schnellen, aufrecht stehend oder wie Sprenkel gebogen über die Oberfläche dahin. Kaum sehen sie ein Schiff, das unter allen Segeln vor der leichten Brise herläuft, so schwenken sie ab und kommen auf dasselbe zu. Nun beginnt erst die wahre Lust. In weitem Bogen umkreisen sie das Fahrzeug, hüpfen vor ihm her und an den Seiten entlang, kehren zurück und geben ihre schönsten Kunststücke zum besten. Je schneller das Schiff segelt, um so ausgelassener ist ihr Treiben.«
Sie bilden enggeschlossene Schulen von zehn, hundert und auch vielen hundert Mitgliedern. Lösche hat in den Meeren unter den Wendekreisen solche gesehen, die vielleicht viele tausende zählten. Geselligkeit ist in der Tat ein Grundzug ihres Wesens, scheint aber mehr auf der Gemeinsamkeit der von ihnen verfolgten Zwecke als gegenseitiger Anhänglichkeit zu beruhen. Daß die Delphine sich unter Umständen gegenseitig vielleicht auch verteidigen und schützen, darf wohl nicht gänzlich in Abrede gestellt werden; ob aber die zarteren Gefühle wirklich auch den Sieg über ihre, hinter der keines anderen Delphines zurückstehenden Gefräßigkeit und Raubgier in allen Fällen davontragen, dürfte sehr fraglich sein. Während unserer Reise auf dem Roten Meere wurde unser Dampfschiff regelmäßig von Delphinen umschwärmt, und mehrmals kamen diese unmittelbar vor dem Buge des Schiffes so hoch zur Oberfläche empor, daß ein erfolgreicher Schuß auf sie abgegeben werden konnte. Sogleich nach dem Schusse färbte sich das Wasser rot von dem gewaltsam ausströmenden Blute; der getroffene Delphin drehte sich einige Male um sich selbst herum und kam dann langsam zur Oberfläche empor. Alle übrigen Mitglieder der Bande blieben augenblicklich beim Leichnam zurück, nach Versicherung unseres erfahrenen Schiffsführers aber nur in der edlen Absicht, den liebwerten Genossen aufzufressen. Das Gebiß bekundet deutlich genug, daß der Delphin zu den schlimmsten Räubern des Meeres gehört.
Seine Nahrung besteht aus Fischen, Krebsen, Kopffüßlern und andern Seetieren. Am liebsten jagt er den Sardellen, den Heringen und mit besonderer Gier den fliegenden Fischen nach. Er ist es hauptsächlich, der diese sonderbaren Bewohner des Meeres über den Wasserspiegel emportreibt; denn gar nicht selten sieht man ihn selbst hinter den aufgestiegenen und dahinrauschenden Flugfischen emporschnellen und dann eilig in der von jenen angegebenen Richtung weiter schwimmen. Nach drei- bis viermaligem Auftreiben hat er die fliegenden Fische gewöhnlich so abgehetzt, daß sie ihm leicht zur Beute werden. Bei dieser Fangart sind Möwen, Tölpel und andere Seevögel seine treuen Gehilfen, indem sie die aus dem Wasser in die Lust getriebenen Fische während des Fliegens verfolgen und sie wiederum dem unten auflauernden Räuber zutreiben.
Zehn Monate nach der Paarung, die im Herbst geschieht, wirft das Weibchen ein Junges von 50 bis 60 Zentimeter Länge und beweist ihm geraume Zeit die größte Zärtlichkeit. Wie behauptet wird, sind die Jungen erst nach zehn Jahren vollkommen erwachsen; dafür sollen sie aber auch, wie ein alter griechischer Schriftsteller angibt, bis hundertunddreißig Jahre alt werden. Fischer, die gefangenen Delphinen Stücke aus der Schwanzfinne geschnitten hatten, wollen in Erfahrung gebracht haben, daß die Lebensdauer zwischen fünfundzwanzig bis dreißig Jahre beträgt.
Der Delphin hat in dem Schwertfische einen schlimmeren Feind als in dem Menschen; denn dieser verfolgt ihn nur, wenn ihn Mangel an frischem Fleisch dazu treibt. Noch heutigestags genießt unser Wal seitens des Menschen eine gewisse Verehrung. Doch vereinigen sich hier und da wohl einige Fischer, umringen mit ihren Booten nach altgriechischer Fangweise eine Schar von Delphinen, erschrecken sie durch plötzliches Geschrei und versuchen, sie nach dem Strande hinzutreiben, wo sie angsterfüllt auf das Trockene laufen. Dann vernimmt man ein seufzerartiges Gestöhn von den zu Tode geängstigten Tieren. Auch Walfänger, die sich nach frischem Fleische sehnen, erlegen dann und wann einen Delphin, während dieser in gewohnter Weise das Schiff umspielt. »Die ganze Mannschaft«, so schildert Lösche, »versammelt sich am Buge und pfeift in allen Tonarten eine wahre Katzenmusik zu dem Tanze im Wasser; denn der sehr musikliebende Delphin soll hierdurch zum Bleiben ermuntert werden, bis die Harpune tückisch an eine kurze Leine befestigt und diese durch einen im oberen Tauwerke befestigten Block gezogen ist. Nun schwingt sich der Harpunier hinaus in das Tauwerk, während zwanzig bis dreißig Hände das innere Ende der Leine fassen. Ein halbes Dutzend Delphine schießt eben unter ihm vorüber; einen Augenblick folgt er, mit der Waffe zielend, einer der schlanken Gestalten, dann sendet er sie mit sicherem Wurfe in den Rücken derselben. ›Fest!‹ schreit er, und die das innere Ende der Leine haltenden Leute laufen trampelnd nach hinten und entreißen im Nu den Getroffenen seiner kristallenen Heimat. Eine Schlinge wird über des zappelnden Schwanz geworfen, und bald liegt der lustige Springer tot auf dem Decke. Seine Genossen sind verschwunden: so schnöder Undank mußte sie vertreiben. Doch eine Meile vom Schiffe entfernt tauchen sie wieder auf und setzen in gleicher Weise, wie sie gekommen, die Reise fort. Vielleicht umspielen sie schon in der nächsten Stunde ein anderes Schiff.« Früher verzehrten auch die meisten Küstenbewohner das Fleisch erlegter Delphine mit Behagen; namentlich geschah dies in katholischen Ländern während der Fastenzeit, weil der Delphin als echter Fisch angesehen oder doch erklärt wurde. Engländer und Franzosen richten das Fleisch in künstlicher Weise zu und erzielten dadurch wenigstens ziemlich schmackhafte Speise. Gegenwärtig ist man aber fast überall von dem Genuß abgekommen.
Schon im Jahre 1819 veröffentlichte Humboldt Beobachtungen über einen die süßen Gewässer Südamerikas bewohnenden Delphin, ohne jedoch eine nähere Beschreibung desselben zu geben. Desmarest erhielt im folgenden Jahre das fragliche Tier aus dem Museum zu Lissabon und beschrieb es, aber noch immer sehr kurz und unvollständig. Genauere Nachrichten übergaben im Jahre 1831 unsere verdienstvollen Landsleute Spix und Martius der Öffentlichkeit; erst dem Franzosen D'Orbigny jedoch verdanken wir die endgültige Beschreibung. Dieser Forscher, der bald nach Spix und Martius Peru bereiste, war so glücklich, das Tier selbst zu erhalten. Mit den Forschungen unserer Landsleute unbekannt, erfuhr er zu seiner nicht geringen Verwunderung, daß tief im Innern des südamerikanischen Festlandes, fünfhundert Meilen vom Atlantischen Weltmeere, ein großer »Fisch« lebe, den er, der Beschreibung nach, nur als Delphin zu deuten vermochte. Leider waren die Indianer mit dem Gebrauche der Harpune so wenig vertraut, daß sie ihm das fragliche Tier nicht zu liefern vermochten. Endlich erlangte er den Delphin bei dem brasilianischen Grenzposten Principe Dobeira, dessen Soldaten sich mit diesem Fange beschäftigten, und erhielt hierdurch Gelegenheit, ihn zu zeichnen und zu beschreiben.
Die Inia der Guarayos, Bonto der Brasilianer ( Delphinus amazonicus) ist ein zu unserer Familie gehöriger Wal, dessen Schnauze zu einem schmalen, rundlichen, stumpfen, steifbehaarten Schnabel sich verlängert hat, der in jeder Kinnlade sechsundsechzig oder achtundsechzig spitze Zähne mit gekrümmten und kräftigen Kronen zeigt. Der schlanke Leib trägt lange, am oberen Ende ausgeschnittene und gegen die Spitze zu sichelförmig verschmälerte Brustfinnen, eine nicht lappige Schwanzflosse und eine sehr niedere Fettflosse auf dem Rücken. Die Leibeslänge schwankt zwischen 2 bis 3 Meter; bei einem Tiere von 2 Meter Länge wird die Rückenfinne 40 Zentimeter lang und gegen 5 Zentimeter hoch, die Brustfinne 41 Zentimeter lang und 16 Zentimeter breit, und die Schwanzfinne endlich 47 Zentimeter breit. Das Weibchen soll nur halb so groß werden. Auf der ganzen Oberseite ist die Inia blaßbläulich, auf der Unterseite rosenrötlich gefärbt; doch gibt es mancherlei Abweichungen; man trifft manchmal durchaus rötliche und bisweilen auch ganz schwärzliche an. Neuerdings hat man mehrere verwandte Arten unterschieden.
So viel man bis jetzt weiß, bewohnt das beachtenswerte Geschöpf fast alle Flüsse Südamerikas zwischen dem 10. und 17. Grade südlicher Breite. In dem Amazonenstrome und seinen Nebenflüssen wie im Orinoco ist er allenthalben eine bekannte Erscheinung. In seinen Bewegungen soll er sich von den Seedelphinen unterscheiden, langsamer und weniger lebhaft sein, ruhiger schwimmen, oft an die Oberfläche kommen, um zu atmen, und gewöhnlich nur zu kleinen Gesellschaften sich vereinigen; doch bestätigt Humboldt erstere Angaben nicht, sah auch ihrer viele zusammen. »Die Luft«, sagt er, »wurde wieder still, und alsbald fingen große Wale aus der Familie der Spritzfische, ganz ähnlich den Delphinen unserer Meere, an, in langen Reihen an der Oberfläche sich zu tummeln. Die Krokodile, langsam und träge, schienen die Nähe dieser lärmenden, in ihren Bewegungen ungestümen Tiere zu scheuen; wir sahen sie untertauchen, wenn die Spritzfische ihnen nahe kamen. Daß Wale so weit von den Küsten vorkommen, ist sehr auffallend; man trifft sie zu allen Jahreszeiten an, und keine Spur scheint anzudeuten, daß sie zu bestimmten Zeiten wandern wie Lachse. Die Spanier nennen sie, wie die Seedelphine, Toninas; ihr indianischer Name ist Orinocua.« Ein anderes Mal erzählt er: »Im dicksten Walde vernahmen wir zu unserer größten Überraschung einen sonderbaren Lärm. Wir schlugen an die Büsche, und da kam ein Schwarm anderthalb Meter langer Toninas zum Vorschein und umgab unser Fahrzeug. Die Tiere waren unter den Ästen eines Baumes versteckt gewesen. Sie machten sich durch den Wald davon und warfen dabei die Wasserstrahlen, nach denen sie in allen Sprachen Blas- oder Spritzfische heißen. Ein sonderbarer Anblick mitten im Lande, drei- bis vierhundert Meilen von den Mündungen des Orinoco und Amazonenstromes. Ich bin immer noch der Ansicht, daß diese Delphine von denen des Meeres gänzlich verschiedene Arten sind.« Durch Bates erfahren wir, daß der Amazonenstrom von mindestens drei verschiedenartigen Delphinen bewohnt wird, und daß diese Wale überall zahlreich, hier und da aber in überraschender Menge auftreten. »An den breiteren Stellen des Strombettes«, sagt der treffliche Beobachter, »von seiner Mündung an bis zu fünfzehnhundert englischen Meilen aufwärts, hört man beständig, namentlich aber bei Nacht, eine oder die andere Art rollen, blasen und schnarchen, und gerade diese Laute tragen nicht wenig dazu bei, im Reisenden das Gefühl der Meeresweite and Meeresöde hervorzurufen.«
Wichtige Merkmale trennen den Narwal ( Monodon monoceros), Vertreter der gleichnamigen Sippe ( Monodon), so weit von den übrigen Zahnwalen, daß man eine eigene Familie ( Monodontia) auf ihn begründet hat. Das Gebiß unterscheidet sich von dem aller übrigen Wale durch zwei mächtige, zwei bis drei Meter lange, verhältnismäßig aber schwache, von rechts nach links gewundene, innen hohle, wagerecht im Oberkiefer stehende Stoßzähne, von denen in der Regel einer, und zwar der rechtsseitige, verkümmert, und die beim Weibchen nur ausnahmsweise zu einer beschränkten Entwicklung gelangen, kennzeichnet sich auch außerdem durch zwei kleine Vorderzähne und einen Backenzahn im Oberkiefer, die jedoch nur bei jungen Tieren regelmäßig gefunden werden. Der Unterkiefer trägt niemals Zähne. Der walzige, vorn abgerundete Kopf nimmt etwa ein Siebentel der Gesamtlänge des langgestreckten, fast spindelförmigen Leibes ein; die sehr kurze, breite und dicke, rechtsseitig etwas verkürzte Schnauze scheidet sich nicht von der flachen Stirne und fällt nach vorn hin fast senkrecht ab; das Auge liegt tief an den Kopfseiten, wenig höher als die Schnauzenspitze, das sehr kleine Ohr etwa 15 Zentimeter weiter nach hinten, das halbmondförmige Spritzloch auf der Stirnmitte zwischen den Augen. Von ihm aus führt eine kurze gemeinschaftliche Röhre nach zwei unter dem Spritzloche sich ausbreitenden, weiten, sackartigen, mit dunkelgrauer Haut ausgekleideten Luftbehältern, die mit den Luftröhren sich verbinden und oben durch Klappen geschlossen werden können. Eine Rückenfinne fehlt, wird aber durch eine Hautfalte angedeutet; die Brustflossen sind etwa im ersten Fünftel des Leibes eingelenkt, kurz, eiförmig und vorn dicker als hinten; die sehr große Schwanzfinne zerfällt, weil sie in der Mitte einen tiefen Einschnitt zeigt, in zwei große Lappen. Die Färbung der glänzenden und weichen, samtartigen Haut scheint, je nach Geschlecht und Alter, nicht unerheblichen Veränderungen unterworfen zu sein. Beim Männchen heben sich von der weißen oder gelblichweißen Grundfärbung zahlreiche, unregelmäßig gestaltete, meist längliche, aber verhältnismäßig große dunkelbraune Flecken ab, die auf dem Rücken am dichtesten, auf dem Bauch am dünnsten stehen und am Kopf fast ineinander verfließen; beim Weibchen sind die Flecken kleiner und dichter gestellt als beim Männchen; junge Tiere endlich sehen noch dunkler aus als alte. Es gibt jedoch auch rein- oder fast reinweiße und ebenso grauliche, einfarbige Stücke. Die Gesamtlänge des Narwals soll bis auf 6 Meter ansteigen können, beträgt jedoch in der Regel nicht mehr als 4 bis 5 Meter, die Länge der Brustfinne 30 bis 40 Zentimeter, die Breite der Schwanzfinne 1 bis 1,3 Meter.
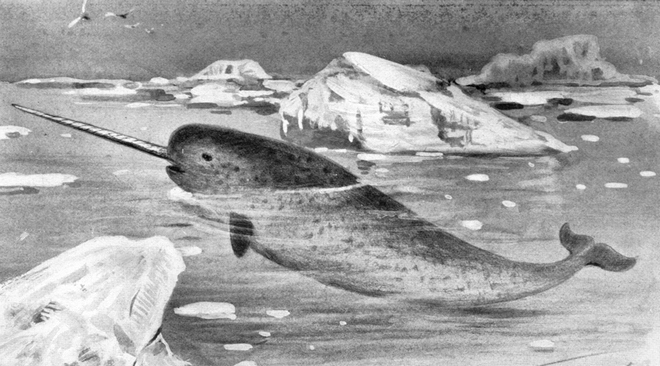
Narwal ( Monodon monoceros)
Daß unsere Vorfahren vom Narwal fabelhafte Geschichten zu erzählen wußten, darf uns nicht in Erstaunen setzen. Ein so auffallend gestaltetes Tier erregt notwendigerweise die Verwunderung des Menschen, und solange die Wissenschaft nicht ihr entscheidendes Wort gesprochen, ist die liebe Phantasie beschäftigt. Namentlich über den Zahn hat man allerlei gemutmaßt und, um offen zu sein, mutmaßt man noch. Wir dürfen in diesem Zahn wohl nur eine Waffe sehen, wie sie das männliche Geschlecht so oft vor dem weiblichen voraus hat.
Der Narwal, ein Bewohner der nördlichen Meere, wird am häufigsten zwischen dem 70. und 80. Grad der nördlichen Breite getroffen. In der Davisstraße, in der Baffinsbai, in der Prinzregenten-Einfahrt, im Eismeere zwischen Grönland und Island, um Nowaja Semlja und weiter in den nordsibirischen Meeren ist er häufig. Südlich des Polarkreises kommt er selten vor; an den Küsten Großbritanniens strandeten, so viel mir bekannt, in den letzten Jahrhunderten nur vier Narwale; an den deutschen Küsten wurden nur im Jahre 1736, aber zweimal, solche beobachtet und erlegt. In seiner Heimat begegnet man ihm fast ausnahmslos in zahlreichen Herden; denn er steht an Geselligkeit hinter keinem einzigen seiner Verwandten zurück. »Gelegentlich seiner Wanderungen«, sagt Brown, »habe ich solche Herden gesehen, die viele Taufende zählten. Zahn an Zahn und Schwanzfinne an Schwanzfinne, so zogen sie nordwärts, einem Reiterregimente vergleichbar, anscheinend mit größter Regelmäßigkeit auf und nieder tauchend und in Wellenlinien ihre Straße verfolgend. Solche Herden werden nicht immer nur von einem und demselben Geschlecht gebildet, wie dies Scoresby annahm, bestehen vielmehr aus Männchen und Weibchen, bunt durcheinander gemischt.« Hinsichtlich ihrer Wanderungen wie der Wahl ihrer Aufenthaltsorte stimmen sie am meisten mit dem Weißwale überein, dürfen aber noch mehr als dieser Polartiere genannt werden; denn erst mit dem Eintritt der strengsten Winterzeit ziehen sie nach Süden hinab und, sobald es irgend möglich ist, d. h. sobald das Eis es gestattet, wieder nach Norden hinauf oder beziehentlich nach Westen hinüber. Verringert das sich mehr und mehr verbreitende Eis ihr Jagdgebiet, so drängen sie sich, gewöhnlich in Gemeinschaft der Weißwale, an den wenigen Stellen zusammen, die auch im härtesten Winter offen bleiben, und bilden hier beim Atmen zuweilen ein so dichtes Gewimmel, daß man sich, wie der alte Fabricius sagt, billig wundern muß, wie geschickt sie es anfangen, einander mit ihren Stoßzähnen nicht zu verletzen. Neuere Seefahrer bezeichnen diesen Wal als ein sehr munteres, behendes Tier, das mit außerordentlicher Schnelligkeit und durch sein oft wiederholtes Auf- und Niedertauchen das Meer zu beleben und die Aufmerksamkeit des Beobachters zu fesseln weiß. Ein einziger starker Schlag seiner Schwanzflosse genügt, um Wendungen nach jeder Seite hin auszuführen; nur eine Drehung in engem Kreise wird ihm schwer. Bei jedem Emporsteigen stößt das Tier Luft und Wasser mit Heftigkeit durch die Nase, wodurch ein weithin hörbares Schnauben entsteht. Wenn eine Herde rasch vorüberschwimmt, vernimmt man auch gurgelnde Laute, die dadurch hervorgebracht werden, daß mit der Luft Wasser ausgestoßen wird, das in die Nasenöffnung drang.
Im Einklang mit der Geselligkeit des Narwals steht seine Friedfertigkeit. Mit andern Walen besteht er gewiß nicht solche Kämpfe, wie man gefabelt hat, und auch mit seinesgleichen lebt er verträglich, solange die Liebe nicht ins Spiel kommt und die Gemüter zweier Männchen erhitzt. Daß letzteres zuweilen geschehen und ernste Kämpfe verursachen muß, darf man mit Bestimmtheit annehmen, da man selten einen alten Narwal erlegt, dessen Zahn unverletzt wäre, auch mehrmals solche beobachtet hat, deren Zähne nicht allein abgebrochen, sondern in deren Zahnhöhlen sogar andere Zähne gerammt worden waren. Über die Zeit der Paarung, die Trächtigkeitsdauer und Geburt der Jungen weiß man übrigens bis jetzt noch sehr wenig; Brown allein bemerkt, daß die Geschlechter in aufrechter Stellung sich paaren und das Weibchen ein einziges Junges zur Welt bringt.
Seegurken, nackte Weichtiere und Fische bilden die Nahrung des auffallenden Geschöpfes. Scoresby fand in seinem Magen Glattrochen, die fast dreimal so breit waren als sein Maul, und wundert sich, wie es ihm möglich wird, mit dem zahnlosen Maul eine so große Beute festzuhalten und hinabzuwürgen, glaubt deshalb, daß der Narwal diesen Rochen vorher mit seinem Stoßzahn durchbohrt und erst nach seiner Tötung verschlungen habe. Der unhöfliche Seemann vergißt aber dabei wieder das arme Weibchen, das doch auch leben will. Wahrscheinlich ist, daß der Narwal seine Nahrung im Schwimmen erhascht und durch den Druck seines Maules so zusammenpreßt, daß er sie hinabwürgen kann; gefangene Seehunde wickeln die Schollen auch erst zusammen wie die Köchin einen Eierkuchen, bevor sie den breiten Bissen als mundgerecht betrachten.
Mancherlei Gefahren und viele Feinde bedrohen das Leben des Narwals. Von keinem andern Waltiere findet man so viele Überbleibsel als von ihm. Der Winter, der oft überraschend schnell eintritt, auf weithin das hochnordische Meer in eisige Banden schlägt und damit allen luftatmenden Seetieren ihr Dasein unendlich erschwert und gefährdet, raubt Hunderten und Tausenden das Leben, und das Meer schwemmt dann deren Leichen und ihre Überbleibsel an den Strand. Kleine Schmarotzer quälen, große wehrhafte Feinde bedrohen ihn. Nicht allein in den Eingeweiden, sondern auch in den Höhlen hinter dem Gaumen siedeln sich gierige Schmarotzer in Wurmgestalt an, verursachen bösartige Entzündungen und verbittern ihrem Nährtier jeden Bissen; der furchtbare Schwertfisch fürchtet den Stoßzahn nicht im geringsten und wütet, wenn er mit dem Narwal zusammentrifft, unter seinen Scharen nicht minder als unter den harmlosen Belugas; der Mensch endlich stellt ihm ebenfalls mit Eifer nach. Doch befassen sich nur die eingeborenen, nicht aber die zugereisten Walfänger mit seiner Jagd; denn seine Schnelligkeit und Gewandtheit erschwert diese, solange nicht eisfreie Strecken des Meeres behufs des Atemholens ihn an eine und dieselbe Stelle binden. Im hohen Meere werden einzelne harpuniert; im ganzen aber ist die Jagd nirgends bedeutend, weil für europäische oder amerikanische Verhältnisse wenig lohnend. Fleisch und Tran werden gleich hoch geschätzt. Ersteres ist sehr schmackhaft, zumal wenn es entsprechend zubereitet wird. Alle in Grönland lebenden Däninnen bringen es, gekocht wie gebraten und in eine aus der speckigen Haut des Narwals bereitete Gallerte gelegt, mit dem Bewußtsein auf den Tisch, daß es auch der verwöhnteste Fremde rasch schätzen lernen werde. Eingeborene Grönländer essen das Fleisch gekocht und getrocknet, die Haut und den Speck roh, brennen das Fett in Lampen, verfertigen aus den Flechsen guten Zwirn, aus dem Schlunde Blasen, die sie beim Fischfang gebrauchen, und wissen selbst die Gedärme zu verwenden. Die Walfischfahrer schmelzen zwar den Speck aus, sehen aber doch in den Stoßzähnen den Hauptgewinn der Jagd.
In früheren Zeiten wurden für die Stoßzähne ganz unglaubliche Summen bezahlt. Man schrieb ihnen allerlei Wunderkräfte zu und wußte sie somit noch vielseitiger zu verwenden als wir, die in ihnen bloß eine das Elfenbein in jeder Hinsicht übertreffende Masse sehen. Noch vor etwa dritthalbhundert Jahren gab es sehr wenig Narwalzähne in Europa, und diejenigen, die die Seefahrer bisweilen fanden, wurden ohne Mühe verwertet. Man hielt die Zähne für das Horn des Einhorns in der Bibel, und deshalb eben setzen die Engländer solchen Zahn dem fabelhaften Einhorn ihres Wappens auf. Je mehr man aber zu der Überzeugung kam, daß diese Zähne nicht vom Einhorn stammten, verloren sie ihre Wunderkräfte; aber noch Ende des vorigen Jahrhunderts fehlten sie in Apotheken nicht, und manche Arzte wußten ihre Unwissenheit noch immer durch Verordnung von gebranntem Narwalpulver darzulegen.
*
Eines der bekannteren Mitglieder der Familie der Schnabelwale ( Hyperodontina) ist der Entenwal oder Dögling ( Hyperodon rostratum), Vertreter der gleichnamigen Sippe ( Hyperodon), ein sehr kräftig gebauter Zahnwal von 6 bis 8 Meter Länge. Der Kopf erinnert entfernt an den des Butskopfes, das halbmondförmige Spritzloch ist auf der Oberseite der Stirn zwischen den beiden Augen gelegen, die verhältnismäßig sehr kleine, länglich und eiförmig gestaltete, stumpf abgerundete Brustfinne im vorderen Drittel des Leibes eingelenkt, die kleine, niedere, schwach sichelförmig gebogene Rückenflosse im letzten Körperdrittel aufgesetzt, die große Schwanzflosse am Hinteren Rande schwach eingebuchtet und in zwei ziemlich spitze Lappen zertrennt. Von der Mitte des Unterkiefers verläuft jederseits längs der Kieferäste eine kurze, aber tiefe Hautfalte nach rückwärts; eine ähnliche Furche befindet sich weiter hinten an der Kehle; die übrige Haut ist eben, glatt und glänzend, mehr oder minder gleichmäßig schwarz, auf der Oberseite in der Regel aber dunkler als auf der Unterseite gefärbt.
Das Verbreitungsgebiet des Döglings scheint auf das Nördliche Eismeer und den Norden des Atlantischen Meeres beschränkt zu sein; von hier aus unternimmt er jedoch regelmäßige Wanderungen, die ihn in mehr oder minder südlich gelegene Gebiete führen, erscheint, wie oben bemerkt, alljährlich in der Nähe der Färöerinseln, nicht selten auch an den großbritannischen Küsten, und steigt hier sogar dann und wann in für ihn günstig gelegenen Flüssen aufwärts. Nach Angabe Lösches bläst er kurz und puffend einen niedrigen, sehr dünnen Strahl vier- bis sechsmal hintereinander, bleibt dabei aber nicht an der Oberfläche, sondern »rundet« nach jedem Blasen. Kopffüßler, schalenlose Weichtiere und im günstigsten Falle kleine Fische bilden seine Nahrung. Von ersteren verzehrt er unglaubliche Mengen; man fand in dem Magen eines getöteten die Überreste von mehr als zehntausend Tieren.
Der Dögling ist wiederholt an den Küsten Englands, Frankreichs, Hollands, Deutschlands, Schwedens, Rußlands und Sibiriens gestrandet. Im September des Jahres 1788 lief bei Honfleur ein Weibchen mit seinem Jungen auf. Die Mutter bemühte sich lange Zeit, ihren Sprößling flott zu machen und fand dadurch ihren Tod. Fischer, die beide Tiere bemerkt hatten, zogen das junge vollends an das Land und verwundeten hierauf die Alte, die sich nicht von ihrem Kind trennen wollte, tödlich. Zwar gelang es derselben noch, die offene See zu gewinnen, allein am folgenden Tage fand man sie, drei Meilen von jener Stelle entfernt, entseelt am Strand liegen.
*
Die vierte Familie der Zahnwale ( Catodontida) vertritt der Pottwal oder Pottfisch der Deutschen, »Spermwhale« der Engländer, »Cachelot« der Franzosen, ( Physeter maorocephalus), Urbild der gleichnamigen Sippe ( Catodon), unzweifelhaft das ungeschlachteste und abenteuerlichste Mitglied der ganzen Ordnung, ausgezeichnet durch den ungemein großen, am Schnauzenende hoch aufgetriebenen und gerade abgestutzten Kopf, die getrennten, oft ungleichen, längsgerichteten Spritzlöcher sowie die absonderliche Bildung seines Unterkiefers, dessen Aste im größten Teile ihrer Länge sich aneinander legen und mit einer Reihe kegelförmiger, unter sich fast gleich langer Zähne besetzt sind, wogegen die Zahngebilde des Oberkiefers kaum noch den Namen von Zähnen verdienen. Erfahrene Walfischfänger behaupten, daß die verschiedenen Aufenthaltsorte und die hier reichlichere, dort spärlichere Nahrung nicht allein auf die Größe, sondern auch auf die Gestalt der Pottwale einen gewissen, unter Umständen sehr erheblichen Einfluß auszuüben vermögen.
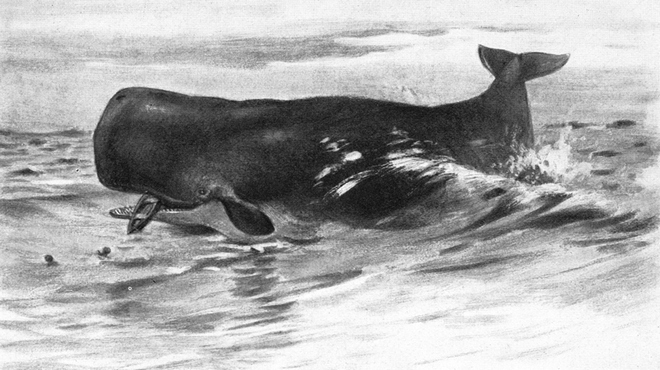
Pottwal ( Physeter macrocephalus)
Der Pottfisch steht beziehentlich seiner Größe keinem andern Wale nach; erwachsene Männchen sollen 20 bis 30 Meter an Länge und einen Leibesumfang von 12 Meter erreichen; die Weibchen dagegen höchstens halb so groß werden. Im Verhältnis zu dieser Größe ist die Brustfinne sehr klein. Bei einem 20 Meter langen Männchen war sie nur 1 Meter lang und 60 Zentimeter breit; die Schwanzfinne dagegen hatte eine Breite von 6 Meter. Der überaus lange, breite, fast viereckige, vorn gerade abgestutzte Kopf hat dieselbe Höhe und Breite wie der Leib und geht ohne merkliche Abgrenzungen in diesen über. Der Leib ist, von vorn gesehen, also im Querschnitte, auf der Rückenmitte etwas eingesenkt, oben seitlich fast gerade abfallend und von der Mitte an stark ausgebaucht, längs der Bauchmitte aber kielartig verschmächtigt, in den beiden vorderen Dritteln sehr dick, von da an bis zum Schwanz verschmächtigt. Im letzten Drittel erhebt sich eine niedere, höckerartige, schwielige, unbewegliche Fettflosse, die hinten wie abgeschnitten erscheint und nach vorn zu allmählich in den Leib übergeht. Die kurzen, breiten, dicken Brustflossen stehen unmittelbar hinter dem Auge und zeigen auf ihrer Oberseite fünf Längsfalten, die den Fingern entsprechen, während sie auf der Unterseite glatt sind. Die Schwanzfinne ist tief eingeschnitten und zweilappig, in der Jugend am Rande gekerbt, im Alter glatt. Kleine, höckerartige Erhöhungen laufen vom Ende der Fettflosse an bis zur Schwanzfinne herab. Das Spritzloch, eine S-förmig gebogene Spalte von 20 bis 30 Zentimeter Länge, liegt, abweichend von andern Walen, am Schnauzenrande, entsprechend der Nase der meisten übrigen Säugetiere, das kleine Auge weit nach rückwärts, das Ohr, eine kleine Längsspalte, etwas unterhalb des Auges. Der Mund ist groß; der Kiefer öffnet sich beinahe bis zum Auge. Der Unterkiefer ist beträchtlich schmäler und kürzer als der Oberkiefer, von dem er bei geschlossenem Mund umfaßt wird, und wie dieser mit wurzellosen, kegelförmigen Zähnen besetzt, deren Anzahl beträchtlich schwankt, weil im Alter manche ausfallen und andere von dem Zahnfleisch fast ganz bedeckt werden. Der Schädel selbst fällt wegen seiner Ungleichmäßigkeit, der Kopf wegen seiner Massigkeit und sich gleich bleibenden Dicke auf. Unter der mehrere Zentimeter dicken Specklage breiten sich Sehnenlagen aus, die einem großen Raum zur Decke dienen. Derselbe ist durch eine wagerechte Wand in zwei, durch mehrere Öffnungen verbundene Kammern geteilt. Der ganze Raum wird von einer öligen, hellen Masse, dem Walrat, ausgefüllt, das außerdem noch in einer vom Kopf bis zum Schwanz verlaufenden Röhre und in vielen kleinen, im Fleische und Fette zerstreuten Säckchen sich findet. Im Halse verschmelzen sechs Halswirbel; nur der Atlas bleibt frei. Vierzehn Wirbel tragen Rippen, zwanzig bilden den Lendenteil und neunzehn den Schwanz. Das Schulterblatt ist verhältnismäßig schmal, der Oberarm kurz und dick, mit dem noch kürzeren Unterknochen verwachsen. Das Fleisch ist hart und grobfaserig und von vielen dicken und steifen Sehnen durchflochten. Über ihm liegt eine mehrere Zentimeter dicke Specklage und endlich die kahle, fast vollkommen glatte, glänzende Haut, die trübschwarze, am Unterleibe, dem Schwanze und dem Unterkiefer stellenweise lichtere Färbung hat. Die Zunge ist mit ihrer ganzen Unterseite am Grunde des Unterkiefers festgewachsen, der Magen vierteilig, der Darm fünfzehnmal so lang wie der Leib, die Luftröhre in drei Hauptzweige gespalten. Außerdem verdient noch ein eigentümlicher, als Harnblase zu deutender Sack Beachtung. Er liegt über der Wurzel der Rute und steht mit einer durch diese verlaufenden Röhre und einer zweiten, die zu den Nieren führt, in Verbindung. Eine dunkle, orangefarbige, ölige Flüssigkeit füllt ihn, und zuweilen schwimmen in dieser kugelartige Klumpen von acht bis dreißig Zentimeter im Durchmesser und sechs bis zehn Kilogramm Gewicht umher, wahrscheinlich krankhafte Erzeugnisse, dem Harnsteine anderer Tiere vergleichbar; der bekannte, überaus hochgeschätzte Amber.
Der Pottfisch ist Weltbürger. Alle Meere der Erde beherbergen ihn, und wenn er sich auch in den Meeren rings um die Pole südlich und nördlich des 60. Grades der Breite nur selten findet, so darf man doch annehmen, daß er sich hier ebenfalls zuweilen einstellt. Als seine eigentliche Heimat betrachtet man die zwischen dem 40. Grade nördlicher und südlicher Breite gelegenen Meere, von denen aus, warmen Strömungen folgend, er nach Norden und Süden hin unregelmäßig wandert. Dahin steuern die Schiffer, die den Fang dieses Riesen betreiben, und von hier aus wandert derselbe, wie man annimmt, durch alle Meere der Erde. Auch an den europäischen Küsten gehört er nicht zu den Seltenheiten. Die Geschichtsbücher aller Länder, ebensowohl die älteren wie die neueren, berichten von Pottfischen, die an ihren Küsten strandeten. Nach Norden oder Süden hin zieht der riesige Wal nur so weit, als er offenes Meer findet; denn er meidet mit Sorgfalt alle Meeresteile, die zeitweilig mit Eis bedeckt werden. Aus diesem Grund begegnet man ihm, wie Brown ausdrücklich hervorhebt, auch keineswegs in den hochnordischen Meeren, insbesondere der Davisstraße und Baffinsbai, als man früher angenommen hat; er gehört im Gegenteil hier zu den seltensten Erscheinungen und darf höchstens als Irrling angesehen werden.
Nach Art der Delphine zieht der riesige Wal in enggeschlossenen »Schulen« oder Scharen von beträchtlich abändernder Stärke durch das Meer, die tiefsten Stellen desselben auswählend. Gern treibt er sich in der Nähe der steilen Küsten umher, ängstlich aber vermeidet er die ihm so gefährlichen seichten. Die Walfänger berichten, daß jeder Schule immer ein großes, altes Männchen, der »Schulmeister«, vorstehe, der den Zug leite und die Weibchen und Jungen, aus denen die übrige Herde bestehe, vor den Angriffen feindlicher Tiere schütze. Alte männliche Pottwale durchschweifen wohl auch einzeln die Flut oder scharen sich wenigstens nur in kleine Gesellschaften. Die Schulen bestehen meist aus zwanzig bis dreißig Mitgliedern; zu gewissen Zeiten sollen sich aber auch mehrere Herden vereinigen und dann zu Hunderten gemeinschaftlich ziehen. Scammon bestätigt im wesentlichen diese Angaben. Nach seinen Erfahrungen sieht man oft Herden von fünfzehn, zwanzig bis zu Hunderten beieinander, wenn auch die Männchen während des größten Teiles des Jahres einzeln angetroffen werden, mangelt es doch nicht an Fällen, daß sich mehrere der Ungetüme zusammenschlagen und nach und nach ebenfalls namhafte Gesellschaften bilden. In das Führeramt der aus männlichen, weiblichen und jungen Tieren zusammengesetzten Herden teilen sich in der Regel mehrere alte Männchen, vielleicht schon aus dem Grunde, als die Weibchen, die Junge haben, sich um nichts anderes als um diese bekümmern. Die jungen Männchen bilden zeitweilig besondere Herden, die sich möglicherweise bis zur Mannbarkeit nicht trennen.
Hinsichtlich seiner Bewegungen erinnert der Pottfisch mehr an die Delphine als an die Bartenwale. Er gibt den schnellsten Mitgliedern seiner Ordnung wenig nach. Schon bei ruhigem Schwimmen legt er drei bis vier englische Meilen in der Stunde zurück, erregt aber jagt er durch die Fluten, daß das Wasser brausend aufkocht und die ruhige See Wellen schlägt, die sich weithin verbreiten. Schon von fern erkennt man den Pottfisch an seinen Bewegungen. Bei ruhigem Schwimmen gleitet er leicht unter der Wasserfläche dahin, bei schnellerem schlägt er so heftig mit dem Schwanze auf und nieder, daß sein Kopf bald tief untersinkt, bald wieder hoch emportaucht. Gar nicht selten stellt er sich senkrecht in das Wasser, entweder den Kopf oder die Schwanzfinne hoch über den Spiegel emporhaltend und hierdurch von den meisten andern Walen sich unterscheidend; ja es kommt auch vor, daß er plötzlich mit großer Wucht über das Wasser emporschnellt, zwei-, dreimal hintereinander, und sich dann für längere Zeit tief in die Fluten versenkt. Erschreckt läßt er sich in fast wagerechter Stellung zu Boden fallen; wiederholt gestört und belästigt, nimmt er ebenfalls eine senkrechte Stellung an, hebt den Kopf hoch über das Wasser, um zu sichern und zu lauschen, oder dreht sich, wenn er auf der Oberfläche liegt, zu gleichem Zweck um sich selbst herum. Beim Spielen reckt er bald die eine, bald die andere Brustflosse in die Luft, schlägt hierauf mit großer Kraft gegen das Wasser und bringt die Wellen zum Schäumen, oder aber sinkt einige Faden tief unter die Oberfläche, wirft sich in mächtigem Schusse unter einem Winkel von etwa fünfundvierzig Grad über das Wasser heraus, fällt auf die Seite, daß man ihn weithin klatschen hört und bis zur Höhe einer Mastspitze ein Schwall emporsteigt, der an klaren Tagen zehn Seemeilen weit gesehen werden kann und erfahrenen Walfängern als erfreuliches Zeichen dient. In der Regel schreibt man diese absonderlichen Bewegungen dem Streben des Pottfisches zu, von einem ihn sehr quälenden Schmarotzer sich zu befreien. Die Mitglieder einer Gesellschaft ordnen sich gewöhnlich in eine lange Reihe, einer hinter dem andern, und tauchen zu gleicher Zeit auf und nieder, blasen zugleich ihre Wassersäulen in die Luft und verschwinden fast in demselben Augenblick unter den Fluten. Selten sind die Tiere ruhig; bloß wenn sie schlafen, liegen sie fast bewegungslos aus der Oberfläche des Wassers und lassen sich von der Dünung wiegen oder stecken den riesigen Kopf weit über die Wellen heraus, so daß man glauben möchte, »die Enden gewaltiger Baumstämme oder die Hälse ungeheuerer Flaschen zu sehen, die in der hebenden Flut leise auf und nieder schaukeln«. Unter allen Walen gibt es, laut Scammon, nicht einen einzigen, der so regelmäßig atmet wie der Pottfisch. Wenn derselbe auftaucht, läßt er zunächst die Gegend der Fettflosse sehen; hierauf erhebt er sein Haupt, wirft mit Macht einen nach vorne und links gerichteten, einfachen, sehr niedrigen, d. h. durchschnittlich nur meterhohen, aber sehr dicken und buschigen, bis aus drei oder vier Meilen Entfernung wahrnehmbaren Strahl in die Höhe und schöpft von neuem Atem; alles innerhalb eines Zeitraumes von etwa drei Sekunden. Ungestört bewegt er sich beim Atmen zuweilen nicht, zuweilen nur langsam, etwa zwei oder drei Seemeilen in der Stunde zurücklegend; wenn er aber von einem seiner Jagdplätze zum andern zieht, jagt er mit erstaunlicher Schnelligkeit durch die Wogen, dabei fortwährend Atem schöpfend. Unter diesen Umständen genügt ihm ein Augenblick zum Luftwechsel; der Kopf erscheint und verschwindet sofort wieder; jeder Wechsel aber geschieht mit der größten Regelmäßigkeit. Die Anzahl der mit Auswerfen von Wasser verbundenen Atemzüge hängt von der Größe des Tieres ab, da alte Weibchen und die Jungen beiderlei Geschlechts weit weniger Luft bedürfen als alte und große Bullen. Letztere atmen durchschnittlich alle zehn bis zwölf Sekunden einmal und wiederholen dies sechzig- bis siebzigmal nacheinander, verweilen also zehn bis zwölf Minuten an der Oberfläche des Meeres. Sobald sie zum letzten Male geblasen haben, tauchen sie köpflings zum Grund herab, »runden«, strecken die Schwanzflosse in die Luft und fallen, sowie sie eine mehr oder weniger senkrechte Stellung erlangt haben, mit großer Schnelligkeit in die Tiefe hinab, in der sie nunmehr von fünfzig Minuten bis zu fünf Viertelstunden verweilen können, bevor sie wieder auftauchen müssen. Kleinere und jüngere Pottfische dagegen bekunden nicht die gleiche Regelmäßigkeit im Atmen und verweilen über oder unter der Oberfläche, blasen auch weniger oft nacheinander und tauchen häufiger auf. Nach Scammons Beobachtungen halten sie sich gewöhnlich den vierten oder fünften Teil der Zeit, die die alten notwendig haben, über Wasser auf, atmen dreißig- oder vierzigmal und sind dann fähig, zwanzig bis dreißig Minuten unter Wasser zuzubringen. Geübte Walfischfänger versichern, daß sie durch das Gehör allein den Pottfisch von allen übrigen Walen unterscheiden können, weil sein Blasen ein ganz eigentümliches Geräusch verursacht, eine Verwechslung mit andern großen Seesäugern daher kaum möglich sein soll.
Unter den Sinnen des Tieres glaubt man dem Gefühl den ersten Rang einräumen zu dürfen. Die mit zarten Nervenwarzen besetzte Haut scheint befähigt zu sein, den geringsten Eindruck zur Wahrnehmung zu bringen. Das Gesicht ist ziemlich gut, das Gehör dagegen schlecht. Hinsichtlich seiner geistigen Fähigkeiten ähnelt der Pottfisch mehr den Delphinen als den Bartenwalen. Doch meidet er die Nähe des Menschen ungleich ängstlicher als der den Schiffern so befreundete Delphin, vorausgesetzt, daß er sich nicht verfolgt oder angegriffen sieht; denn dann tritt an die Stelle der Furchtsamkeit unbändiger Mut und eine Kampflust, wie wir sie bei andern Walen nicht wiederfinden. Man hat beobachtet, daß ein Rudel von Delphinen imstande ist, eine ganze Herde von Pottfischen überaus zu ängstigen und zu eiligster Flucht zu veranlassen, weiß aus Erfahrung, daß alte Bullen bei Annäherung eines Schiffes so schnell wie möglich entfliehen, und kennt Beispiele, daß eine Herde durch plötzliche Annäherung ihrer Feinde vor Schrecken bewegungslos, am ganzen Leibe bebend, an einer Stelle blieb, ganz ungeschickte, ja geradezu verwirrte Anstrengungen machte und dem Menschen hierdurch Gelegenheit gab, mehrere dieser Tiere zu bewältigen. Nach Scammons Erfahrungen betätigen verschiedene Weibchen hingebende Anhänglichkeit aneinander, sammeln sich, wenn eins von ihnen angegriffen wird, um das betreffende Boot und verweilen in der Regel geraume Zeit bei ihrem sterbenden Gefährten, obwohl auch ihnen unter solchen Umständen sicheres Verderben droht. Unter jungen Männchen bemerkt man ein so inniges Zusammenhalten nicht; sie verlassen den durch einen Wurfspeer verwundeten Genossen.
Verschiedene Arten von Kopffüßlern bilden die hauptsächlichste Nahrung des Pottfisches. Kleine Fische, die zufällig in seinen großen Rachen sich verirren, werden natürlich auch mit verschluckt; auf sie aber jagt unser Wal eigentlich nicht. Altere Seefahrer erzählten, daß er sich auch an Haifische, Robben, Delphine und selbst an Bartenwale wage, die neueren sorgsamen Beobachter haben jedoch hiervon nichts bemerkt. Von ihnen erfahren wir dagegen, daß der Pottfisch zuweilen Pflanzliche Nahrung genießt, wenigstens verschiedene Baumfrüchte, die durch die Flüsse in die See geführt worden waren, verschlingt. Dank seiner Begabung, länger als jeder andere Wal unter dem Wasser verweilen und dabei auch andern Ordnungsgenossen unzugängliche Höhlen oder doch Unebenheiten des Bodens untersuchen zu können, fehlt es ihm niemals an genügender Nahrung. Die Art und Weise, wie er seine flüchtige Beute gewinnt, kennt man noch nicht genau.
Zu allen Zeiten des Jahres hat man Mütter mit säugenden Jungen getroffen. Bennett, der hierüber am genauesten berichtet, hat die Säuglinge nur in den Monaten März, April, Oktober und November vermißt; doch beweist diese Angabe noch nicht, daß zu dieser Jahreszeit keine Jungen geboren würden. In der Regel bringt jedes Weibchen nach einer Tragzeit von etwa zehn Monaten sein einziges Junges oder höchstens deren zwei zur Welt. Die neugeborenen Pottwale haben etwa den vierten Teil der Größe der Alten und schwimmen lustig neben dieser her. Beim Säugen soll sich die Mutter auf die Seite legen und das Junge die Zitze mit dem Winkel, nicht aber mit der Spitze der Kiefern fassen.
Der Pottfisch wurde schon seit alten Zeiten, mit besonderem Eifer jedoch erst vom Ende des siebzehnten Jahrhunderts an von Walfischfängern verfolgt. Die Amerikaner rüsteten im Jahre 1677, die Engländer erst hundert Jahre später Schiffe zu seinem Fange aus. Seit Anfang unseres Jahrhunderts ist die Südsee der hauptsächlichste Jagdgrund dieser Schiffer, und heutzutage noch sind es fast nur die Engländer und Nordamerikaner, die sich mit dem Fange beschäftigen.
Die Jagd auf den Pottfisch ist mit weit größeren Gefahren verbunden als der Fang des Grönlandwales. Ausnahmsweise nur versucht ein Bartenwal seinem kühnen Feinde Schaden zuzufügen, während jener, wenn er angegriffen wird, sich verteidigt, mutig auf seinen Gegner losstürmt und beim Angriffe sich nicht allein seines Schwanzes, sondern auch seines furchtbaren Gebisses bedient. Daß er so gut wie ausschließlich mit den Zähnen sich verteidigt, geht aus verschiedenen Beobachtungen hervor; so erlegt man zuweilen alte Männchen mit gänzlich verstümmeltem Unterkiefer, die offenbar vorher einen Kampf mit ihresgleichen oder einem noch unbekannten Leviathan der Tiefe ausgefochten haben mußten. Wenn er von einer Wurflanze getroffen ist, bleibt er zuweilen einige Augenblicke wie gelähmt im Wasser liegen und gibt dann dem achtsamen Walfischfänger Gelegenheit, ihm noch eine oder mehrere Lanzen in den Leib zu schleudern und seinen Fang zu vollenden; in der Regel aber kämpft er verzweiflungsvoll um sein Leben und sucht keineswegs immer sein Heil in der Flucht, sondern erwidert die ihm angetane Unbill mit Wut und Ingrimm. Alle erfahrenen Seeleute wissen von Unglücksfällen zu erzählen, die durch ihn herbeigeführt wurden. Die Mannschaft des Schiffes Essex hatte einen Pottfisch verwundet, mußte aber zum Schiff zurückkehren, weil ihr Boot durch einen Schwanzschlag des harpunierten Tieres stark beschädigt wurde. Während die Seeleute beschäftigt waren, das Boot auszubessern, erschien ein anderer Wal derselben Art in geringer Entfernung vom Schiff, betrachtete es eine halbe Minute lang aufmerksam und verschwand in der Tiefe. Nach wenigen Augenblicken kam er wieder an die Oberfläche, eilte in voller Hast herbei und rannte mit dem Kopf so gewaltig gegen das Schiff, daß die Seefahrer glaubten, ihr Fahrzeug wäre in vollem Lauf auf ein Riff gestoßen. Das wütende Tier ging unter dem Schiffe weg, streifte den Kiel, drehte sich um und schwamm von neuem herbei. Der zweite Stoß schlug den Bug ein und brachte das Fahrzeug zum Sinken. Von der Mannschaft wurden nur wenige gerettet. Ein zweites amerikanisches Schiff, die Ann Alexander, wurde ebenfalls durch einen Pottfisch vernichtet; ein drittes, die Barke Cook, nur durch einen gutgezielten Kanonenschuß vom Untergange gerettet. Vier Monate nach dem Untergang des Schiffes Ann Alexander fing die Mannschaft der Rebekka einen ungeheuren Pottfisch, der sich ohne jeden Widerstand einbringen ließ. Man fand zwei Harpunen in seinem Körper, gezeichnet Ann Alexander. Der Kopf war stark beschädigt, und aus der fürchterlichen Wunde ragten große Stücke von Schiffsplanken hervor. Scammon zählt noch eine Reihe ähnlicher Angriffe des erbosten Wales auf. Man weiß selbst von Fällen zu berichten, daß Pottwale Schiffe ohne allen Grund herausforderten, angriffen und zerstörten. So geschah es mit dem Waterloo, einem mit Früchten beladenen britischen Fahrzeuge, das in der Nordsee durch einen Pottfisch zertrümmert wurde. Wie viele andere Schiffe noch durch das gewaltige Tier vernichtet worden sind, ist schwer zu sagen; Scammon aber zweifelt nicht, daß mehr als ein Schiff, das zum Walfange aussegelte und nicht zurückkehrte, durch Pottfische in den Grund gebohrt wurde.

Harpunenkanone für den Walfang
Mit den ernsten Gefahren, die der Pottfischfang zur Folge hat, steht der zu hoffende Gewinn, so groß er auch ist, kaum im Einklang. Außer dem Speck, der einen sehr guten Tran liefert, erzeugt der Pottfisch noch den Walrat und den Amber, beides Gegenstände von größtem Wert. Der Walrat ist im frischen Zustande flüssig, durchsichtig und fast farblos, gerinnt in der Kälte und nimmt dann eine weiße Färbung an. Je mehr er gereinigt wird, um so mehr erhärtet und trocknet er, bis er schließlich zu einer mehlartigen, aus kleinen Blättchen zusammengesetzten, perlmutterglänzenden Masse sich gestaltet. Man verwendet ihn ebensowohl in der Heilkunde wie zum Anfertigen von Kerzen, die allen übrigen vorgezogen werden. Wertvoller noch ist der Amber, über den man seit den ältesten Zeiten unendlich viel gefabelt hat; eine leichte und haltlose, wachsartige Masse von sehr verschiedener Färbung, die sich fettig anfühlt, einen höchst angenehmen Geruch besitzt, durch Wärme sich erweichen, in kochendem Wasser in eine ölartige Flüssigkeit umwandeln und bei großer Hitze verflüchtigen läßt. Man verwendet ihn hauptsächlich als Räuchermittel oder mischt ihn sogenannten wohlriechenden Ölen und Seifen bei. Schon die alten Römer und Araber kannten seine Anwendung und seinen Wert, und bereits bei den Griechen wurde er in der Arzneiwissenschaft als krampfstillendes, beruhigendes Mittel verwandt, hat sich auch bis zum vorigen Jahrhundert als solches in allen Apotheken erhalten. Lange Zeit war der Amber ein rätselhafter Gegenstand. Die alten Griechen betrachteten ihn ganz richtig als den Auswurfsstoff eines Tieres; später jedoch tauchten andere Meinungen auf. Erst Boylston erkannte im Jahre 1724 zufällig den wahren Erzeuger des kostbaren Stoffes. Häufiger als aus dem Leibe des Pottfisches gewinnt man den Amber durch Auffischen im Meere. Es wird erzählt, daß glückliche Fänger Klumpen von fünfundzwanzig Kilogramm aus dem Leibe großer Pottfischmännchen geschnitten hätten, und früher wurde behauptet, daß selbst Klumpen von fünfundfünfzig bis siebzig Kilogramm in dem Öle der betreffenden Blase umherschwämmen. Daß man wirklich Stücke von neunzig Kilogramm Gewicht, anderthalb Meter Länge und über einen halben Meter Dicke aufgefischt hat, unterliegt keinem Zweifel; doch ist es wahrscheinlich, daß so große Klumpen von den Wellen zusammengetrieben und vielleicht durch eine in der Sonnenhitze mögliche teilweise Schmelzung aneinandergeklebt wurden. Außer diesen drei wichtigsten Fettstoffen finden auch die Zähne des Pottfisches Verwendung. Sie sind hart, lassen sich leicht glätten und bearbeiten und würden dem Elfenbein an Wert gleichgeschätzt werden, wenn sie dieselbe reine Farbe besäßen.

Harpunierter Wal
*
Im Vergleich zu der ebenso mannigfaltigen wie artenreichen Abteilung der Zahnwale erscheint die Unterordnung der Bartenwale ( Mysticete) einförmig und arm. Die zu ihr gehörenden Wale kennzeichnen sich vornehmlich dadurch, daß beiden Kiefern die Zähne fehlen, Oberkiefer und Gaumen dagegen Barten tragen. Anderweitige Merkmale liegen in dem sehr großen, breiten Kopf, den getrennten, längsgerichteten Spritzlöchern, dem engen Schlund, den großen Felsenbeinen und dem Mangel an Tränenbeinen. Das bedeutsamste Kennzeichen sind und bleiben die Barten. Sie vertreten weder die Stelle der Zähne, noch ähneln sie ihnen hinsichtlich ihrer Anlage, ihrer Befestigung am Kiefer und ihrer Gestaltung. Bei ganz jungen Walen hat man in den Kiefern kleine, knochenartige Körperchen gefunden, die man als Zahnkeime deuten konnte; dagegen sitzen die später erscheinenden Barten gar nicht an den Kiefern, sondern am Gaumen und sind nicht unmittelbar an den Kopfknochen befestigt. Ihre Querstellung im Gewölbe der Mundhöhle erinnert an die Gaumenzähne der Fische. Die Barten, hornige, nicht knochige Oberhautgebilde, sind dreiseitige, seltener vierseitige Platten, an denen man eine Rinden- und Markmasse unterscheiden kann. Erstere besteht aus dünnen, übereinander liegenden Hornblättern; letztere bildet gleichlaufende Röhren, die am unteren Ende der Platte in borstenartige Fasern, zerschlissene Teile der Platte selbst, auslaufen. Gekrümmte Hornblätter verbinden die einzelnen Barten an deren Wurzel, mit der sie an der sie ernährenden, etwa zwei Zentimeter dicken, gefäßreichen Haut des Gaumengewölbes angeheftet sind. Jede einzelne Bartenplatte richtet sich quer durch das Rachengewölbe gegen das als Kiel hervortretende, nur mit Schleimhaut bekleidete Flugscharbein, in dessen Nähe sie verläuft; die längsten dieser Platten, deren man im ganzen zwischen zweihundertundfünfzig bis vierhundert zählt, finden sich in der Mitte des Kiefers, die kürzesten an der Spitze und an der Einlenkungsstelle desselben, da sie von der Mitte aus sich ziemlich gleichmäßig nach beiden Seiten hin verkleinern. Von vorne nach hinten steht eine dicht hinter der andern; nach hinten werden die Zwischenräume größer. Von der Seite gesehen, erinnert die gesamte Bartenreihe an einen Kamm, dessen Zinken die hier mit gerader Fläche endigenden Bartenplatten darstellen. Die gesamte Bebartung läßt sich mit einem Gewölbe vergleichen, von dessen Decke, den mittleren Kiel ausgenommen, unzählige biegsame, mehr oder minder lange Fasern herabhängen. Schließt der Bartenwal sein Maul, so nimmt der Unterkiefer den ganzen Oberkiefer in sich auf; die Fasern berühren, wenn nicht überall, so doch an den Rändern die Zunge, schließen damit die Gaumenhöhle vollständig nach außen ab und halten auch die kleinste und schlüpferigste Beute unentrinnbar fest.
Erwachsen können die Bartenwale eine Länge von zwanzig bis dreißig Meter und ein Gewicht von zwanzig- bis hunderttausend Kilogramm erreichen; sie sind demnach die größten aller Geschöpfe, die unsere Erde gegenwärtig beherbergt und jemals erzeugte.
Sie leben ziemlich einzeln; denn bloß zufällig, vielleicht durch reichliche Nahrung herbeigelockt, sieht man sie in Scharen beisammen. Die meisten wohnen im Eismeer und verlassen nur zuweilen die Buchten zwischen den Eisfeldern; andere ziehen südlicher gelegene Meeresteile vor. Sie halten sich nicht immer in einer Gegend auf, sondern wandern. Einige unternehmen regelmäßige Wanderungen von den Polen auch gegen den Äquator hin oder von Westen nach Osten und zurück. Ungeachtet ihrer ungeheuren Massigkeit bewegen sie sich im Wasser rasch und gewandt; ja, die meisten durchziehen die Flut fast mit der Schnelligkeit eines Dampfschiffes. Sie schwimmen geradeaus, aber in beständigen Bogenlinien fort, indem sie bald bis zur und teilweise bis über die Oberfläche des Wassers emporkommen, bald wieder unter ihr fortsegeln. Nach eigenen Beobachtungen tauchen sie, wenn sie sich ungestört bewegen, durchschnittlich alle vierzig Sekunden mit dem ungeheuren Kopfe und einem Teil des Rückens über den Meeresspiegel empor, um Luft zu schöpfen, treiben unter schnaubendem, hörbarem Geräusch das in die Nasenlöcher eingedrungene Wasser mit großer Kraft heraus, verschwinden, nachdem sie hinlänglich geatmet haben, in der Tiefe und können nunmehr hier unter Umständen sehr lange verweilen. Ungestört halten sie sich hauptsächlich an der Oberfläche auf, legen sich bisweilen auf den Wasserspiegel, bald auf den Rücken, bald auf die Seite, wälzen sich, stellen sich senkrecht und treiben andere Spiele, schnellen sogar manchmal mit halbem Leibe über den Wasserspiegel empor. Bei ruhiger See überlassen sie sich wohl auch dem Schlafe auf den Wellen, die sie hin und her tragen.
Die Nahrung der größten Tiere der Erde besteht aus kleinen, unbedeutenden Weich- und Schaltierchen, Kopffüßlern, Seerosen, Quallen und Würmern, unter denen sich viele Arten befinden, die dem bloßen Auge kaum sichtbar sind. Aber von diesen Geschöpfen nehmen sie Millionen mit einem Schluck zu sich. Den ungeheuren, weitgespaltenen Rachen aufgesperrt, streicht der Wal rasch durch die Flut, füllt das ganze Mundgewölbe mit Wasser und den in ihm schwimmenden und lebenden kleinen Tieren an und schließt, wenn das Gewimmel derselben seiner nicht unempfindlichen Zunge fühlbar wird, endlich die Falle. Alle Fasern der Barten stehen senkrecht nach unten und bilden so eine Reuse, durch die beim Schließen des Maules das Wasser zwar entweichen kann, die sämtlichen kleinen Geschöpfe aber zurückgehalten werden. Ein einziger Druck der plumpen, kaum beweglichen Zunge treibt hierauf die gallertartige Masse durch die Mundröhre hinab in den Magen.
Hinsichtlich der höheren Begabungen stehen die Bartenwale den früher beschriebenen Seesäugern ziemlich gleich. Gesicht und Gefühl sind ihre ausgebildetsten Sinne. Die geistigen Fähigkeiten scheinen schwächer zu sein als bei den Zahnwalen. Alle Bartenwale sind furchtsam, scheu und flüchtig und leben daher unter sich friedlich und harmlos und wohl auch mit den meisten andern Seetieren in Frieden. Wenn sie sich angegriffen sehen, erwacht allerdings zuweilen ihr natürlicher Mut, der selbst in Wildheit ausarten kann, und sie verteidigen sich dann mit Heftigkeit, nicht allzuselten auch wohl mit Erfolg; im allgemeinen aber fügen sie ihrem furchtbarsten Feinde wenig Schaden zu. Ihre Hauptwaffe ist der Schwanz, dessen ungeheure Kraft man sich vorstellen kann, wenn man erwägt, daß er das Werkzeug ist, vermittels dessen der Wal seinen massigen Leib mit Dampferschnelle durch die Wogen treibt. Ein einziger Schlag des Walfischschwanzes genügt, um das stärkste Boot in Trümmer zu schlagen oder in die Luft zu schleudern, ist hinreichend, schon ein sehr starkes Tier und somit auch den Menschen zu töten.
Über die Fortpflanzung der Bartenwale weiß man noch wenig, höchstens soviel, daß die Weibchen oder »Kühe« ein einziges oder zwei Junge zur Welt bringen, das sie lange säugen, sehr lieben, mit Mut und Ausdauer verteidigen, bei Gefahr unter einer der Finnen verbergen und so lange führen, bis der junge Wal selbständig geworden ist. Es ist wahrscheinlich, daß die Bartenwale verhältnismäßig schnell wachsen; dennoch gehört eine größere Reihe von Jahren dazu, ehe sie ihre volle Größe erlangen. Gegenwärtig trifft man selten vollständig erwachsene Bartenwale an; Speck, Tran und Fischbein sind so gewinnbringende Gegenstände, daß der Mensch kaum noch eines der gewaltigen Tiere sein volles Alter erreichen läßt.

Buckelwal ( Megaptera longimana)
Die Furchen- oder Röhrenwale ( Balaenopterida), die die erste der beiden Bartenwalfamilien bilden, erhielten ihren Namen von tiefen, neben- und hintereinanderliegenden, im ganzen gleichlaufenden Längsfurchen, die sich über die ganze Kehl-, Hals-, Brust- und einen Teil der Bauchfläche erstrecken. Hierher gehören zunächst die Langflossenwale ( Megapterina), die der Buckelwal ( Megaptera longimana), das Urbild der gleichnamigen Sippe ( Megaptera), vertritt. Dieser allverbreitete, in jedem Weltmeer vorkommende Wal erreicht eine Länge von 18 bis 23 Meter, seine Brustfinne bei etwa Meterbreite eine solche von 4 bis 5 Meter, die Schwanzflosse eine Breite von 5 bis 6 Meter. Er zählt zu den plumpesten Gliedern seiner Familie. Verglichen mit andern Röhrenwalen, ist er entschieden häßlich, sein Leib kurz und dick, längs des Rückens kaum merklich, auf der Unterseite schon vom Unterkiefer an sehr bedeutend gewölbt, der vordere Teil des Leibes überall ausgebaucht, der hintere gegen den Schwanz hin außerordentlich verschmächtigt, der Unterkiefer merklich länger und breiter als der obere, seine Brustfinne fast unverhältnismäßig lang und seine Schwanzfinne außerordentlich entwickelt. Auf dem Rücken erhebt sich im letzten Viertel der Gesamtlänge eine sehr verschieden gestaltete und ausgebildete Fettflosse, der Buckel. Die Färbung der übrigens glatten Haut ändert vielfach ab. Auf der Oberseite herrscht gewöhnlich ein mehr oder minder gleichmäßiges und tiefes Schwarz vor, wogegen die Unterseite des Leibes und der Brustfinnen eine weißliche Marmelzeichnung besitzt; einzelne Stücke sind oberseits einfach schwarz, unterseits rein weiß, andere oben und unten schwarz, wieder andere oben schwarz, unten weiß, ihre Brust- und Schwanzfinne aber unterseits dunkelaschfarben gefärbt.
Wenige Bartenwale zeigen sich dem Schiffer oder Walfänger öfter und in größerer Anzahl als der Buckelwal, der in allen Breiten zwischen dem Äquator und den eisigen Meeren des Nordens und Südens wie auf hoher See oder in der Nähe der Küste, auch in allen größeren Buchten und weiteren Sunden vorkommt und alljährlich regelmäßig von den Polen aus nach dem Äquator zu wandern scheint. Das Auftreten des Buckelwales ist übrigens fast immer ein unregelmäßiges, und dasselbe gilt für seine Bewegungen. Selten durchzieht er auf geradem Wege irgendwie erhebliche Strecken, gefällt sich vielmehr unterwegs, bald hier, bald dort mehr oder minder lange Zeit zu verweilen, ändert auch wohl seine Richtung. Ebenso bemerkt man ihn zuzeiten in zahlreichen Gesellschaften, die eine weitere Fläche des Meeres, als der Blick von der Höhe des Mastkorbes überschauen kann, einnehmen können, wogegen er zu andern Zeiten einzeln dahinzieht, sich aber gleichwohl gebärdet, als ob er von Hunderten seinesgleichen begleitet würde, indem er sich in allen Stellungen und Spielen seiner Familiengenossen gefällt. Bezeichnend für ihn sind die wellenförmigen Bewegungen, das starke Runden seines Leibes, das Hervorstrecken der einen oder andern Brustflosse und die Unregelmäßigkeit der Straße, die er zieht. Selbst wenn er unter dem Wasser dahinschwimmt, wirft er sich oft von einer Seite auf die andere und wiegt sich förmlich in seinem Element, ganz so wie ein Vogel in der Luft. Wenn er seine gewaltigen Lungen nach Behaglichkeit füllt und entleert, wirft er sechs-, acht-, zehn- und selbst fünfzehn- bis zwanzigmal nacheinander einen doppelten Strahl in die Luft, der bald schwach, bald stark sein, bald nur zu anderthalb bis zwei Meter, bald wiederum bis zu sechs Meter Höhe ansteigen kann. Seine Nahrung besteht vorzugsweise in kleinen Fischen und niederen Krebstieren.
Die Spiellust des Buckelwales erhöht sich während der Paarungszeit. Beide Geschlechter liebkosen sich in ebenso ungewöhnlicher wie unterhaltender Weise, versetzen sich nämlich gegenseitig liebevolle Schläge mit ihren Brustflossen, die zwar jedenfalls höchst zärtlich gemeint, immerhin aber so derb sind, daß man das Klatschen derselben bei stillem Wetter meilenweit hören kann. Nach solchen Kundgebungen ihrer Stimmung rollen sie sich von einer Seite auf die andere, reiben sich gegenseitig sanft mit den Finnen, erheben sich teilweise über das Wasser, wagen vielleicht auch einen Luftsprung und ergehen sich in andern Bewegungen, die sich leichter beobachten als beschreiben lassen. Die Trächtigkeitsdauer kennt man nicht, glaubt aber annehmen zu dürfen, daß dieselbe zwölf Monate nicht überschreite. Das neugeborene Junge, das etwa den vierten Teil der Größe seiner Mutter hat, wird in derselben Weise gesäugt, geliebt, erzogen und verteidigt wie der Sprößling anderer Wale.
Obwohl der Nutzen des gefangenen Buckelwales nicht unbeträchtlich ist, steht er doch weit hinter dem des Pott- oder des Grönlandwales zurück, weil sein Speck oder Fett unverhältnismäßig weniger Tran gibt, als man nach der Schätzung annehmen sollte. Vierzig Tonnen Tran gelten schon als gute Ausbeute.
*
Der Finnwal oder Finnfisch ( Balaenoptera physalus), ein Vertreter der gleichnamigen Sippe ( Balaenoptera), ist verhältnismäßig der schlankste und am längsten bekannte aller Wale. Er kann eine Länge von mehr als 30 Meter erreichen. Der nördlichste Teil des Atlantischen Weltmeeres und das Eismeer bilden den Aufenthalt des Finnwales. Besonders häufig zeigt er sich in der Nähe der Bäreninsel, Nowaja Semljas und Spitzbergens; aber auch in der Nähe des Nordkaps ist er nicht selten; auf einer drei Tage dauernden Reise von Vadsö nach Hammerfest sah ich fünf Wale, die von unserem kundigen Schiffsführer als Finnfische bezeichnet wurden, darunter einen außerordentlich großen, der sich im Porsangerfjord herumtrieb. Nach Browns Beobachtungen geht er im Norden des Eismeeres nicht über die Breite von Südgrönland hinaus. Mit Beginn des Herbstes wandert er in südlichere Gewässer herab, und somit begegnet man ihm auch in den Meeren des gemäßigten und heißen Gürtels, soll ihn sogar im südlichen Eismeer angetroffen haben.

Finnwal ( Balenoptera physalis)
Wie man schon aus der schlanken Gestalt schließen kann, ist der Finnwal in allen seinen Bewegungen ein rasches und gewandtes Tier. Bei ruhigem Schwimmen zieht er in gerader Richtung daher und kommt sehr oft, nach eigenen Beobachtungen durchschnittlich alle neunzig Sekunden, an die Oberfläche, um zu atmen. Das brausende Geräusch beim Ausatmen und bezüglich Auswerfen des Wassers vernahm ich schon in einer Entfernung von einer Seemeile; von dem widrigen Geruch dagegen, der dem ausgestoßenen Wasser anhaften soll, habe ich nichts verspürt. Das beim Blasen hörbare Geräusch ist kurz und scharf, der bis zu vier Meter Höhe ansteigende Strahl doppelt. Weniger scheu als andere Ordnungsverwandte, erscheint der Finnwal nicht selten in unmittelbarer Nähe segelnder Schiffe, umschwimmt dieselben oder folgt ihnen längere Zeit, manchmal stundenlang, getreulich nach. Bisweilen legt er sich auf der Oberfläche des Wassers auf die Seite und schlägt mit den Brustfinnen auf die Wellen, dreht und wendet sich, wirft sich auf den Rücken, taucht unter und scherzt überhaupt lustig im Wasser umher, schleudert auch den gewaltigen Leib durch einen mächtigen Schlag der Schwanzflosse über die Oberflächen empor und versinkt dann mit donnerähnlichem Gepolter in die Tiefe. Wie in seinen Bewegungen übertrifft er auch in seinem geistigen Wesen den Grönlandwal bei weitem, bekundet unter Umständen außerordentlichen Mut und soll, übereinstimmenden Berichten zufolge, wenn er gereizt wurde, an Wildheit und Kühnheit kaum hinter dem bösartigsten aller Wale zurückstehen. Nicht bloß Mutterliebe, sondern auch Anhänglichkeit an seine Genossen zeichnen ihn aus.
Der Finnfisch liebt kräftigere Nahrung als der Wal. Seine Beute besteht größtenteils aus Fischen, die er oft scharenweise vor sich hertreibt und in dem weiten Rachen auf einmal schockweise fängt. Wenn der Finnwal reiche Beute findet, verweilt er tage- und selbst wochenlang auf einer und derselben Stelle, so beispielsweise in Grönland, wo er, laut Brown, während der Laichzeit aus den Schellfischbänken bei Riskol, Holstenbork und andern Örtlichkeiten Südgrönlands sich umhertreibt und unglaubliche Mengen von Dorschen und andern Schellfischen verzehrt. Desmoulins berichtet, daß man sechshundert, Brown, daß man achthundert Stück dieser immerhin großen Fische in seinem Magen gefunden hat. Rechnet man das Gewicht jedes Dorsches nur zu einem Kilogramm, so ergibt sich, daß von solch einer Mahlzeit des riesigen Tieres zwölf- bis sechszehnhundert Menschen sich gesättigt haben könnten. Mit seinen nächsten beiden Verwandten, dem Riesen- und Schnabelwal, wandert der Finnfisch in Verfolgung der Dorsche und Heringe weit nach Süden herab, gelangt dabei an die europäischen Meere und sammelt sich hier zuweilen zu Scharen, die geraume Zeit gemeinschaftlich jagen. Eine Folge seiner Jagd auf scharenweise dem Lande zuschwimmende Fische ist, daß er öfter als jeder andere seiner großen Verwandten in unmittelbarer Nähe der gefährlichen Küsten jagt. Er ist es, der sich in den engen Fjorden Norwegens umhertreibt und die übrigen schmalen Buchten des Meeres besucht, er aber auch, der am häufigsten strandet. Man kennt allein vom Jahre 1819 an mehr als zwanzig Beispiele, daß Finnfische auf den Strand europäischer Küsten geworfen wurden und elendiglich umkamen.
Ein Finnwal, dessen Gerippe ich bei dem norwegischen Kaufmann und Naturforscher Nordvi in Vadsö liegen sah, hatte sich beim Besuchen des Varanger Fjords zwischen Scheren festgearbeitet und zuletzt so zwischen die Felsen gezwängt, daß er weder vorwärts noch rückwärts konnte. Einige lappländische Fischer eilten herbei und suchten sich nun des Ungeheuers zu bemächtigen. Sie besaßen keine andere Waffe als ihre großen Messer, säumten aber keinen Augenblick, mit diesen dem Tiere im buchstäblichen Sinne des Wortes auf den Leib zu rücken, erkletterten mühselig seinen glatten Rücken und schnitten und stachen so lange, bis der Wal seinen Geist aufgegeben hatte. Nicht besser erging es einem jungen Finnwal, der sich im Frühling des Jahres 1874, vermutlich Heringsschwärmen nachziehend, in die Ostsee verirrt und längere Zeit an den Küsten umhergetrieben, auch hier und da die Fischer erschreckt hatte, endlich aber, am 23. August, zu seinem Unheil auf der Danziger Reede angelangt war. Hier lagen gerade drei deutsche Kriegsschiffe vor Anker, und es war Sonntag. »Welchen angenehmeren Zeitvertreib«, schildert Zaddach, »konnte es für die Offiziere geben, als eine Waljagd? Man griff zu den Gewehren und begrüßte den unerfahrenen Fremdling mit Spitzkugeln; und als dieser unwillig den ungastlichen Ort verlassen wollte, sprang man in die Boote und ergötzte sich daran, wie jedesmal, wenn er auftauchte, die Kugeln von allen Seiten in seine dicke Haut einschlugen.« Fünfundsiebzig dieser Kugeln hatten, wie sich später ergab, getroffen und die Weichteile des Kopfes bis auf den Schädel durchbohrt, ohne jedoch in diesen einzudringen. Deshalb würde es auch dem Riesen gelungen sein, zu entfliehen, hätte er nicht von einem der Offiziere beim Untertauchen einen Degenstich in den Hinterleib erhalten, der eine große Schlagader durchschnitt und Verblutung herbeiführte. Sterbend fanden ihn am andern Morgen Fischer des Dorfes Heubude, zogen ihn mit vereinigten Kräften aller Pferde und Männer der Ortschaft an den Strand, zu nicht geringer Freude aller Bewohner der guten Stadt Danzig, die zu Tausenden herbeieilten, um ihn zu sehen, und freudig das geforderte Schaugeld in die harten Hände der betriebsamen, flugs zu Tierschaustellern gewordenen Fischer spendeten.
Gewöhnlich gibt der Finnwal wenig Tran, ein Tier von 27 Meter Länge nicht mehr als acht bis zehn Tonnen. Der Speck ist dünn, wässerig, bei jungen Tieren gallertartig und fast völlig tranlos. Die Barten sind kurz und brüchig. Fleisch und Knochen werden in der Regel nicht ausgenutzt, sondern den Tieren des Meeres überlassen.

Grönlandwal oder Walfisch ( Balaene Mysticu)
Mit dem Finnfisch hat man bis in die neueste Zeit einen andern riesigen Wal der hochnordischen Meere verwechselt, nämlich den Riesenwal ( Balaenoptera sibbaldi). Er steht hinter dem Finnwal an Größe nicht zurück, da man einzelne gefunden hat, die 31,5 Meter lang waren und fast 4 Meter lange Brustflossen hatten. Kopf, Rücken, Schwanz, Oberseite der Bauchflossen haben schwarze, die Unterseite der letzteren, Gurgel, Brust und Bauch glänzend weiße Färbung; es scheint aber, daß auch dieser Wal hinsichtlich seiner Färbung erheblich abändert.
Der bekannteste Vertreter unserer Familie jedoch ist der Zwerg- oder Schnabelwal ( Balaenoptera rostrata), das kleinste bekannte Mitglied seiner Gruppe, dessen Länge wohl kaum 1o Meter übersteigt. Bei einem von Scammon gemessenen Weibchen betrug die Gesamtlänge 8,2 Meter, die Länge der Brustflosse 1,25 Meter, deren Breite 35 Zentimeter, die Breite der Schwanzflosse 2,3 Meter. Der Leib ist verhältnismäßig sehr zierlich gebaut. Ein düsteres Schieferschwarz ist die Färbung der ganzen Oberseite, von der Spitze des Oberkiefers an bis zur Einlenkungsstelle der Brustflossen herab, sowie der Schwanzspitze, einschließlich der Schwanzflosse, ein mehr oder minder rötliches Weiß die der Unterseite; die Brustflossen haben oben die Farbe der Oberseite, in ihrer Mitte jedoch ein weißes Querband und sehen unterseits ebenso weiß aus wie der Bauch. Das Verbreitungsgebiet desselben erstreckt sich demnach über alle rings um den Nordpol gelegenen Meere. Von hier aus wandert er mit Beginn des Winters nach Süden hinab und kommt dann auch an den europäischen bzw. an den ost- und westamerikanischen und ostasiatischen Küsten vor. Daß er weite Wanderungen unternimmt, geht am besten aus den vielen Strandungen gerade dieses Wales an den verschiedensten Küsten Nord- und Westeuropas hervor. Unterwegs verweilt er, je nach Laune und Belieben, längere und kürzere Zeit an nahrungversprechenden Orten, unter Umständen auch während des ganzen Sommers schon an der norwegischen Küste, dringt in Busen und selbst in größere Flüsse ein und reist mit Beginn des Frühjahrs in nördlicher Richtung zurück. In ähnlicher Weise durchstreift er einen nicht unbeträchtlichen Teil des Großen Weltmeeres, von der Behringsstraße bis zur Küste von Mexiko hinab, kehrt im Laufe des Sommers wieder nach Norden zurück, jagt und fischt im Behringsmeer und durchschwimmt auch wohl von hier aus die Behringsstraße, um sich im nördlichen Eismeer eine Zeitlang aufzuhalten. In seinen Sitten und Gewohnheiten ähnelt er in vieler Hinsicht dem Finnwal, als dessen Junges er von den Walfängern angesehen zu werden pflegt. Gewöhnlich sieht man ihn einzeln, seltener paarweise und nur dann und wann einmal in größeren Gesellschaften, bald dicht unter der Oberfläche, bald in einer beträchtlichen Tiefe schwimmend, bald mit den bekannten Spielen sich vergnügend.
*
Die Glattwale ( Balaenida), die die letzte Familie der Ordnung bilden, sind ungleich plumper und ungefüger gebaut als sämtliche Röhrenwale und haben weder Rückenflosse noch Hautfurchen. Als Urbild dieser Familie haben wir den wichtigsten aller Wale anzusehen, den Grönlandwal, »Wal« oder »Walfisch« der Deutschen und Engländer ( Balaena mysticetus), ein unförmliches Geschöpf, das in allen Teilen und Gliedern Mißverhältnisse zeigt. Der dem Menschen angeborene Hang zur Übertreibung des Wunderbaren hat sich namentlich bei diesem von altersher berühmten Wale bekundet. In älteren Schriften und selbst noch in einzelnen von unwissenden Schriftstellern der Neuzeit zusammengestellten Beschreibungen wird behauptet, daß es in früheren Zeiten Walfische von fünfzig, sechzig, ja selbst hundert Meter Länge gegeben habe und daß dieselben nur durch die unablässigen Nachstellungen der Menschen auf ihre heutige Größe herabgesunken wären. Diese Angaben dürfen als vollständig irrige angesehen werden. Schon die Seefahrer, die vor mehr als drei- bis vierhundert Jahren auf den Fang auszogen, sprechen nur von Walen, die 60 Fuß oder 20 Meter lang gewesen seien, und Scoresby, der beim Fange von etwa dreihundertzwanzig Walfischen zugegen war, fand unter ihnen keinen, der mehr als 18 Meter lang gewesen wäre. Gleichwohl läßt es sich nicht leugnen, daß man in der Tat größere gefunden hat und noch heutigestags in abgelegenen Meeresteilen solche findet. Aber auch ein Wal von achtzehn Meter Länge ist und bleibt eine ungeheuerliche, staunenerregende Erscheinung. Der ungestaltete Kopf nimmt, wie aus den obigen Maßen hervorgegangen, drei bis vier Zehntel oder durchschnittlich ein Drittel der Gesamtlänge des Leibes ein; das Maul gibt Raum für ein mäßiges Boot mit seiner Mannschaft, da es bei fünf bis sechs Meter Länge drei bis vier Meter Breite hat. Dreihundert bis dreihundertsechzig (die Walfänger sagen, soviel wie Tage im Jahre) Fischbeinplatten bilden die Bebartung; die mittelsten erreichen eine Länge von etwa fünf Meter. Die Oberhaut ist verhältnismäßig dünn, fest, sammetweich, ölgetränktem Leder vergleichbar, die Lederhaut dagegen sehr mächtig, da sie die zwanzig bis vierzig Zentimeter dicke Specklage in ihren Zellen aufnimmt. Die Färbung scheint vielfach abzuändern. Auf der Oberseite des Kopfes herrscht, nach Brown, ein milchiges Grauweiß vor, das an der Spitze der Schnauze in einen etwa fünfzehn Zentimeter breiten, schwarzen Fleck übergeht; weiter nach hinten zeigt der ganze Leib so ziemlich dieselbe Färbung, ein mehr oder minder dunkles Blau, das bei den Alten ins Schwarze, bei den Jungen ins Lichtblaue spielt. Bei älteren Walen verbreitet sich die dunklere Färbung des Leibes auch auf die Kinngegend, während diese Teile bei jungen unregelmäßig weiß gefleckt zu sein pflegen. Zwei gleichgefärbte Flecken stehen gewöhnlich hinter dem Auge und Oberkiefer; etwas Weiß bemerkt man ebenso an den Augenlidern und einige weiße unregelmäßige Zeichnungen an der Wurzel des Schwanzes. Außerdem kommen verschiedene Spielarten vor: ganz weiße, gescheckte und einzelne mit weißen Flecken an den verschiedensten Stellen des Leibes; eine besondere Bedeutung darf man dem Vorhandensein oder Fehlen dieser Flecken jedoch nicht zusprechen. Die weiblichen Wale sind größer und fetter als die männlichen, ihre lichten Zitzen, die einem Kuheuter an Größe ungefähr gleichkommen, von einem weißen Hofe umgeben.
Der Walfisch bewohnt die höchsten Breiten des nördlichen Eismeeres und des großen Weltmeeres, ohne jedoch irgendwo einen bestimmten Aufenthalt zu nehmen. Sein Vorhandensein wie sein Kommen und Gehen steht unzweifelhaft in enger Beziehung zu der Beschaffenheit des Eises während dieser oder jener Jahreszeit. Alle genauen Beobachter meinen, daß er mehr als jeder andere an das Eis gebunden sei, freiwillig nur in unmittelbarer Nähe desselben sich aufhalte und nach Süden oder Norden hin wandere, je nachdem das Eis sich bildet oder schmilzt. Seine Vorliebe für das Eis geht so weit, daß er nicht allein eine Gegend sofort verläßt, in der das Eis geschmolzen ist, sondern auch zweifellos weite Strecken unter den Eisflötzen zurücklegen muß, weil man ihn inmitten ungeheurer Eisfelder angetroffen hat, woselbst er genötigt war, zu den wenigen durch die Ebbe und Flut gebildeten Sprüngen und Rissen zu kommen, um hier zu atmen. Nach Holböll, der zuerst ausführlicher über seine Wanderungen berichtet, zieht der alte Walfisch in der Davisstraße niemals südlicher als bis an die Zuckerspitze unter dem 63. Grade nördlicher Breite, und auch die jungen, beweglicheren, mehr und weiter umherschwärmenden Tiere werden jenseits des 64. Grades nicht gefunden. Zwischen dem 66. und 69. Grade zeigen sich Junge wie Alte regelmäßig nur in den Monaten Dezember und Januar, auf der ganzen zwischenliegenden Strecke ungefähr gleichzeitig aus westlicher und nordwestlicher Richtung her erscheinend und nunmehr längs der Küste teils süd-, teils ostwärts gehend. Bei Holsteinborg nimmt der Grönlandwal von jener Zeit ab bis zum Monat März einen beständigen Aufenthalt zwischen den Buchten und Inseln, bekundet aber auch jetzt noch seine Vorliebe für das Eis, indem er sich entweder an den westlichen, zurzeit bis in die Davisstraße sich erstreckenden oder in der Nähe der in den Buchten liegenden Eisflötze aufhält. Wenn er die Küste verläßt, was im Süden der angegebenen Strecken im Monat März, im Norden im Anfang des Juli geschieht, zieht er nach Norden hinauf; hier in den nördlichsten Teilen der dänischen Ansiedlungen, unter dem 71. bis 75. Grade nördlicher Breite, beobachtet man ihn ausschließlich im Sommer, nicht aber im Herbst und Winter. Im Stillen Weltmeer ziehen die Walfische ebenfalls nicht weiter nach Süden hinab, als im Winter die Eisfelder reichen. Hier findet man sie im Ochotzkischen Meere und seinen Buchten bei Beginn der Eisschmelze und unter Umständen sogar bis gegen den Sommer hin, dann aber nicht mehr. Daß sie vom Großen Weltmeer nach dem nördlichen Eismeer wechseln, also die Behringsstraße bei ihren Hin- und Herwanderungen wiederholt durchziehen, unterliegt für Scammon keinem Zweifel.
Auch der Grönlandwal ist gesellig. Gewöhnlich findet man ihn allerdings nur in kleinen Trupps von drei oder vier Stück etwa; bei seinen größeren Wanderungen aber schart er sich unter Umständen zu zahlreichen Herden. So erfuhr Brown von Dr. James Mac Bain, daß vor ungefähr dreißig Jahren eine außerordentliche Menge jener Wale südlich von der Pondsbai wandernd angetroffen wurde. Zu mehreren Hunderten vereinigt zogen die Tiere in ununterbrochenen Schwärmen nordwärts auf demselben Wege, auf dem wenige Tage später noch größere Herden von Walrossen dahinschwammen. Wie erfahrene Walfänger festgestellt haben, vereinigen sich gewöhnlich Wale von gleichem Alter, so daß also die jüngeren und älteren besondere Trupps bilden.
Die Bewegungen der Tiere sind unregelmäßiger Art, jedoch keineswegs langsam und schwerfällig. »So plump der Leib des Wales auch ist«, sagt Scoresby, »so rasch und geschickt sind seine Bewegungen. Ein Walfisch, der, ohne sich zu rühren, auf der Oberfläche ruht, kann in fünf oder sechs Sekunden außer dem Bereich seiner Verfolger sein. Doch hält so große Schnelligkeit nur wenige Minuten an. Bisweilen fährt er mit solcher Heftigkeit gegen die Oberfläche des Wassers, daß er ganz über dieselbe herausspringt; bisweilen stellt er sich mit dem Kopfe gerade niederwärts, hebt den Schwanz in die Luft und schlägt auf das Wasser mit furchtbarer Gewalt. Das Getöse, das dabei entsteht, wird bei stillem Wetter in großer Entfernung gehört, und die Kreise verbreiten sich auf eine ansehnliche Weite. Von einer Harpune getroffen, schießt er, wenn auch nur wenige Minuten lang, wie ein Pfeil fort, mit einer Geschwindigkeit, daß er sich bisweilen die Kinnladen durch das Aufstoßen auf den Boden zerbricht.« Alle Wale sind imstande, weite Strecken mit großer Schnelligkeit zurückzulegen. So wurde ein Wal am Eingange vom Scoresbysund an der Ostküste von Grönland harpuniert und verloren, am andern Tage jedoch am Eingange des Omenakfjords an der Westküste getötet und mit Bestimmtheit an der in seinem Leibe steckenden Harpune erkannt; er mußte also das Vorgebirge Farewell umschwommen und eine Strecke von mindestens fünfhundert Kilometer zurückgelegt haben. Ungestört, beispielsweise wenn er sich auf seinen Futterplätzen jagend umhertreibt, durchschwimmt er vier bis fünf Seemeilen in der Stunde. Unter diesen Umständen nähert er sich etwa alle zehn bis fünfzehn Minuten der Oberfläche, verweilt hier zwischen einer und drei Minuten, um zu atmen, und nimmt dann rasch nacheinander vier- bis sechsmal Luft ein. Der Strahl, den er auswirft, steigt nicht selten bis sechs Meter in die Höhe und kann somit auf eine Entfernung von einer oder anderthalb Seemeilen gesehen werden. Seefahrer vergleichen die Strahlen einer Herde von Walfischen mit den rauchenden Schornsteinen einer Fabrikstadt, lassen aber dabei freilich ihrer Einbildungskraft völlig freien Spielraum. Scoresby gibt an, daß der Wal, auch wenn er auf Nahrung ausgeht, fünfzehn bis zwanzig Minuten, wenn er verwundet, aber sogar eine halbe bis beinahe eine ganze Stunde unter Wasser verweilen könne, und daß ein solcher, der etwa vierzig Minuten lang unter Wasser blieb, wahrscheinlich infolge des ungeheuren Wasserdrucks, den er in der Tiefe des Meeres aushalten mußte, ganz erschöpft wieder an die Oberfläche komme. Unter gewöhnlichen Umständen bringt ein alter Wal, laut Brown, freiwillig niemals mehr als eine halbe Stunde unter Wasser zu, und nur bei jungen beobachtet man, daß sie die Atmung etwa drei Viertelstunden unterdrücken. Scammon kennt nur einen einzigen Fall, daß ein alter, verwundeter Wal, der bis zum Boden herabgetaucht sein mußte, weil er mit schlammbedecktem Kopf wieder erschien, eine Stunde und zwanzig Minuten unter Wasser verweilt hatte und noch lebend, wenn auch sehr erschöpft, wieder zur Oberfläche emporkam. Die Tiefe, zu der sie hinabtauchen, läßt sich nicht genau bestimmen. Viele ziehen, nachdem sie harpuniert worden waren, bei fast senkrechtem Hinabtauchen nur etwa hundert Faden Leine nach sich, andere freilich auch so viel, daß die abgewickelte Länge einer Seemeile gleichkommt; im letzteren Falle schwimmen sie jedoch zweifellos unter einem sehr flachen Winkel nach dem Boden herab.
Über die höheren Begabungen des Grönlandwales ist nicht viel zu vermelden. Unter den Sinnen scheinen nur Gesicht und Gefühl ziemlich ausgebildet zu sein; doch nimmt man an, daß die Sinneswerkzeuge, solange das Tier unter Wasser ist, ihm genügende Dienste leisten und nur in der Luft diese versagen. So soll der Wal andere seinesgleichen in erstaunlicher Entfernung wahrnehmen können; über Wasser dagegen soll sein Auge nicht weit reichen. Das Gehör ist so stumpf, daß er, nach Scoresby, einen lauten Schrei, selbst in der Entfernung einer Schiffslänge, nicht vernimmt; dagegen macht ihn bei ruhigem Wetter ein geringes Plätschern im Wasser aufmerksam und spornt ihn zur Flucht an. Unter seinen geistigen Eigenschaften darf vor allem seine Anhänglichkeit an andere seinesgleichen und die auch bei ihm in bemerkenswertem Grade vorhandene Mutterliebe hervorgehoben werden. Von andern Anzeichen des Verstandes hat man nicht viel beobachtet.
Bei gutem Wetter hat man auch den Wal während seines Schlafes beobachtet. Er liegt dann wie ein Leichnam auf der Oberfläche des Wassers, ohne sich zu rühren, hebt die Spitze seines Kopfes über die Wellen empor, atmet ruhig, ohne einen Strahl auszuwerfen, und hält sich durch die Brustflossen im Gleichgewicht.
Bei seinen Jagdzügen ebenso wie bei längeren Reisen schwimmt der Wal gewöhnlich gegen den Wind. Seine Nahrung besteht vorzugsweise in kleinen Krebstieren, namentlich in verschiedenen Arten von Spaltfüßlern und Weichtieren, insbesondere Ruderschnecken, die auf den olivengrünen Stellen des Meeres massenhaft gefunden werden. Gedachte Stellen werden hervorgerufen durch unschätzbare Mengen von Diatomeen, zwischen denen die genannten Tiere sich in großer Menge bewegen. Abgesehen von kleinen Arten, die sich zufällig in das weite Maul des Wales verirren und mit hinuntergeschluckt werden, verzehrt dieser schwerlich Fische in erheblicher Menge und in keinem Falle große, da der Durchmesser seiner Speiseröhre höchstens zehn Zentimeter beträgt. Die Menge kleiner Seetiere, die ein Wal zu sich nimmt, um sich zu sättigen, entzieht sich jeder Berechnung. Die Losung ist rot gefärbt.
Über die Fortpflanzung des Grönlandwales mangeln noch ausreichende und eingehende Beobachtungen. Nach den übereinstimmenden Berichten der erfahrenen Walfänger Scoresby und Brown fällt die Zeit der Paarung in die Monate Juni, Juli und August. Beide Geschlechter bekunden währenddem lebhafte Erregung und gefallen sich in allen Spielen und Künsten, die man bei Walen überhaupt beobachtet. Die Paarung selbst geschieht in aufrechter Stellung, wobei beide ihre Brustflossen gegen den Leib des andern drücken und das Männchen das Wasser durch heftige Bewegung seines Schwanzes aufbrausen läßt. Die Tragzeit schätzt Brown, im Einklange mit Scoresby und andern, auf zehn Monate, erklärt auch ausdrücklich die Meinung, daß der Grönlandwal nur alle zwei Jahre gebäre, für irrtümlich, ohne jedoch die Schwierigkeit einer bestimmten Beobachtung hierüber in Abrede zu stellen. In der Regel bringt das Weibchen ein einziges, in seltenen Fällen zwei Junge zur Welt. Die Geburt erfolgt im März oder April; in letzterem Monat erlegte ein Walfänger einen Jungen mit noch anhängender Nabelschnur. Das Junge saugt lange Zeit, vielleicht ein ganzes Jahr, und zwar ganz in der bereits beschriebenen Weise, indem sich die Alte etwas auf die Seile neigt, um ihm die Zitze zu bieten. Nach Scammon ist die Größe des neugeborenen Jungen sehr verschieden; durchschnittlich mag der zur Welt kommende Säugling eine Länge von drei bis fünf Meter erlangt haben. Das Wachstum geht außerordentlich rasch vor sich, so daß das Junge bereits während seiner Saugzeit eine Länge von mindestens sechs Meter bei einem Umfange von vier Meter und ein Gewicht von sechstausend Kilogramm erreichen kann. Nach den übereinstimmenden Beobachtungen aller Berichterstatter liebt die Mutter ihr Junges in hingebender Weise. Man fängt letzteres, das die Gefahr nicht kennt, mit leichter Mühe, hauptsächlich zum Zwecke, die Alte herbeizulocken. Sie kommt dann auch gleich dem verwundeten Kinde zu Hilfe, steigt mit ihm an die Oberfläche, um zu atmen, treibt es an fortzuschwimmen, sucht ihm auf der Flucht behilflich zu sein, indem sie es unter ihre Flossen nimmt, und verläßt es selten, solange es noch lebt. Dann ist es gefährlich, sich ihr zu nähern. Aus Angst für die Erhaltung ihres Kindes setzt sie alle Rücksichten beiseite, fährt mitten in die Feinde und bleibt um ihr Junges, wenn sie schon von mehreren Harpunen getroffen ist.
Eine der genaueren Schilderung würdige Beobachtung führt Fitzinger nach einer mir unbekannten Quelle an. »Bei einem jungen harpunierten Walfisch erschien die Mutter augenblicklich, ungeachtet der Nähe des Bootes, von dem aus die Harpune geworfen worden war, ergriff das Junge mit einer ihrer Brustflossen und riß es mit ausdauernder Gewalt und Schnelligkeit mit sich fort. Bald kam sie aber wieder empor, schoß wütend hin und her, hielt inne oder änderte auch plötzlich die Richtung und gab alle Zeichen der höchsten Angst deutlich zu erkennen. So fuhr sie eine Zeitlang fort, beständig von den Booten bedrängt; endlich kam eins von diesen so nahe, daß eine Harpune nach ihr geworfen werden konnte; sie traf zwar, blieb jedoch nicht stecken. Eine zweite wurde geworfen; doch auch diese drang nicht ein, und erst die dritte blieb im Leibe fest. Trotz der erhaltenen Verwundungen versuchte die Alte nicht, zu entfliehen, ließ auch die andern Boote nahekommen und bot somit den übrigen Verfolgern Gelegenheit, ihr drei Harpunen in den Leib zu schleudern. Nach einer Stunde war sie getötet.
Solche Beweise der edelsten Mutterliebe rühren den Walfänger nicht im geringsten, weil derselbe einzig und allein seinen Vorteil im Auge behält und diesem wie der Robbenschläger jedes menschliche Gefühl aufopfert. Über den Fang selbst brauche ich nach dem Vorhergegangenen mich nicht weiter auszulassen. Er geschieht in der allgemein bekannten und von mir auch genügend geschilderten Art und Weise. Der Nutzen des erlegten Tieres ist sehr bedeutend; ein Walfisch von 18 Meter Länge und einem Gewicht von 70 000 Kilogramm gibt etwa 30 000 Kilogramm Speck, aus dem man 24 000 Kilogramm Tran gewinnt und annähernd 1600 Kilogramm Fischbein. Nachdem man den getöteten Wal seiner Barten und seines Speckes beraubt hat, läßt man den Leichnam schwimmen, da das Fleisch in der Regel von Europäern nicht gegessen wird. Als ungenießbar darf man es nicht bezeichnen, und französische Schiffsköche haben es, laut Brown, sehr wohl zu verwenden gewußt. Die hochnordischen Völkerschaften essen es ohne Bedenken, verzehren auch den Speck und trinken selbst den Tran mit einer gewissen Leidenschaft. Hier und da benutzt man vielleicht noch die Rippen, um daraus Hütten zu bauen, oder die kleineren öldurchtränkten Knochen zur Feuerung.
Unbedrängt von Menschen, erreicht der Grönlandwal wahrscheinlich ein sehr hohes Alter. Außer dem Menschen greift den lebenden Walfisch wahrscheinlich einzig und allein der furchtbare Schwertfisch an. Mehrere Haiarten füllen sich den Bauch mit Fleischstücken getöteter Wale, wagen es aber wohl kaum, die lebenden anzufallen. Zwar erzählt man, daß insbesondere der Drescherhai den Walfisch oft hart bedränge, weil er ihn in Scharen verfolge und durch furchtbare Schläge mit seiner mächtigen Schwanzflosse bis zur Bewußtlosigkeit ermatte; es scheint jedoch, als ob man diesen Raubfisch mit dem erwähnten Butskopf verwechselt und dessen Rückenfinne für die Schwanzflosse des Haies angesehen hat. In hohem Grade lästig mögen dem Grönlandwal verschiedene zu den Krebsen gehörige Schmarotzer werden, die sich auf seinem Leibe festsetzen. Die sogenannte Walfischlaus, ein Flohkrebs, bürgert sich oft zu Hunderttausenden auf ihm ein und zerfrißt ihm den Rücken so, daß man vermuten möchte, eine bösartige Krankheit habe ihn befallen. Auch Meereicheln bedecken ihn nicht selten in großer Menge und bilden wieder für mancherlei Seepflanzen geeignete Anhaltspunkte, so daß es Wale gibt, die eine ganze Welt von Tieren mit sich herumtragen müssen.