
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Fast eine Stunde von Hamburg liegt ein freundliches Haus. Seine Mauern sind weiß angeworfen, und alle Fenster der einen Seite von Weinlaub umrankt; an der andern steht eine alte, dicke Weide, von unten bis oben mit Epheu umwunden. Hinten im Garten breitet eine schon mehr als hundertjährige Eiche ihre knorrigen Äste weithin aus. Im Garten sind viele Bäume und Blumen, auch Rasenplätze und Lauben und Bänke. Hinter dem Hause ragen sechs hohe Pappeln hervor, und links vor der Hausthür steht ein großes Hundehaus. Wenn Du ins Haus hinein gehen willst, dann springt der Sultan heraus und bellt gewaltig; aber geh' nur ruhig zu, er beißt Dich nicht; er bellt nur, damit die Leute kommen und Dir die Thür öffnen. Trittst Du nun ins Haus, so gucken gewiß gleich zwei freundliche Gesichter aus der Thür, die rechts ins Wohnzimmer führt, und das sind Mariechen und Karl, die Dich neugierig anblicken oder vielleicht auch fragen werden: »Wer bist Du? Wie heißt Du? – Was willst Du?«
Karl und Marie sind aber die Kinder, die hier im Hause wohnen mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester Elisabeth und mit Trina und Martha, die das Haus rein machen und kochen und für die kleine Elisabeth sorgen, wenn Mama etwas anderes zu thun hat. – Der alte Jakob gehört auch mit ins Haus; der sorgt für den Garten, säet und pflanzt und trägt die Früchte ins Haus, die im Garten reif geworden sind. – Marie ist sechs Jahr alt und Mamas liebes, folgsames Töchterchen; sie kann schon ein bißchen nähen und stricken und fängt an, lesen zu lernen. Karl ist ein wilder Bursche von vier Jahren, zuweilen unartig, wie alle Kinder sind, will ein Soldat werden oder ein Kutscher und in seinem Leben nichts lernen, ich glaube aber, das sagt er nur, weil er noch so klein ist; wenn er ein oder zwei Jahr älter geworden ist, wird er gewiß ebenso fleißig werden, wie Schwester Marie. Elisabeth ist ein kleines, holdes Schwesterchen, welches die beiden andern Kinder sehr lieb haben und dem sie gern alles zu Gefallen thun. Vorigen Sonntag ist sie ein Jahr alt geworden und trampelt schon immer mit ihren Füßchen, weil sie gern laufen möchte, spricht auch schon vielerlei, was freilich noch niemand verstehen kann. Nur abends, wenn, sie ihre Hände faltet, und Mama mit ihr betet, dann spricht sie ihr »Amen« so deutlich, daß es jedermann verstehen kann.
Die drei Kinder sind immer sehr fröhlich, wenn sie morgens bei Mama lernen, oder wenn sie im Garten spielen, oder wenn sie spazieren gehen, oder wenn sie ihr Mittags- und Abendbrot verzehren, oder wenn Papa ihnen etwas erzählt, aber ganz besonders vergnügt sind sie, wenn Mama mit ihnen kleine Lieder singt, und ihr Lieblingslied heißt:
Wir Kinder, wir leben
Wie die Vöglein so froh,
Weil der Vater im Himmel
Uns alle liebt so.
Was wir Gutes nur haben,
Das hat Er uns geschenkt;
Mit den herrlichsten Gaben
Er uns täglich bedenkt.
Wenn die Sonn' uns am Morgen
Aus dem Schlummer aufweckt,
Steh'n wir auf ohne Sorgen,
Kennen nicht, was uns schreckt.
Wenn wir müde am Abend
Uns legen zur Ruh',
Schließen sorglos vorm Dunkel
Unsre Augen wir zu.
O, wie gut und wie selig
Kann's doch haben ein Kind,
Wär'n wir immer so fröhlich,
Als wir jetzt es noch sind.
*
Am Freitag Nachmittag, als Mariechen ihre Zahl fertig gestrickt hat, und die Sonne nicht mehr so heiß scheint wie am Vormittag, spricht die Mutter zu den Kindern: »Kommt, wir wollen zusammen ins Feld gehen und uns freuen über Gras und Blumen und das viele Schöne, was uns der liebe Gott geschenkt hat.« Karl und Marie springen fröhlich mit zur Hausthür hinaus, durch den Garten und den Berg hinunter, der ans grüne Feld grenzt, welches mit tausend Blumen herrlich geschmückt ist. »Wie heißt diese Blume?« fragt Karl, setzt sich ins Gras und zeigt sie der Mutter. »Gänseblümchen,« erwidert sie; Karl aber lacht und sagt: »Ach was, ich nenne sie Kringelkranzblümchen. Siehst Du, alle die rot und weißen Blätter sind Kinder, die tanzen rundum.« »Und die großen grünen Blätter da unten, tanzen die nicht mit?« fragte Marie. »O nein,« sagt Karl, »das sind ihr Vater und ihre Mutter, die passen auf, daß kein Kind fällt.« »Das ist hübsch,« meint Marie, »soll ich viele davon pflücken und einen Kranz machen?« »Nein, ja nicht,« ruft Karl, »sie wollen ja noch tanzen!« Marie findet noch andere Blumen, die nicht weiß und rot sind, und fragt die Mutter: »Sind diese gelb, oder sind sie blau?« »Blau,« sagt die Mutter. »Siehst Du noch etwas, was blau ist?« Marie schaut umher. – Karl aber ruft dazwischen: »Der Himmel! Diese Blume heißt gewiß Himmelsblümchen, – ich gebe sie ihm wieder!« Und er pflückt die Blume ab und schleudert sie hoch in die Luft; sie fällt aber immer wieder herunter auf seinen Hut, und die Mutter sagt: »Sieh, der Himmel will sie Dir schenken, und sie soll Dir sagen: Vergißmeinnicht! denn so heißt sie.« »Vergiß mein nicht!« wiederholt Karl nachdenklich. »Wen soll ich denn nicht vergessen?« »Das Blümchen kommt vom Himmel und soll's Dir sagen: wer hat's ihm wohl aufgetragen?« fragt die Mutter. »Ich weiß schon, gewiß der liebe Gott,« meint Karl, »denn er ist im Himmel.« »Hier bei uns ist er auch,« sagt Marie, »Mama hat neulich erzählt: Er ist überall.« »Aber im Himmel wohnt er doch«, erwidert Karl. Da läuft die Schwester auch und pflückt sich eine Blume, rot sieht sie aus; die Mutter nennt sie Hungerblume, weil das Korn verdirbt, wenn zuviel solcher Blumen dazwischen stehen, und der Landmann dann Hunger leiden muß. – »Mama, die Blume weint,« ruft Marie betroffen, »eben hab' ich es selbst gesehen.« »Sie weint wohl nicht, ich glaube, sie hat gerade getrunken, als Du sie pflücktest,« sagt die Mutter. »Aber wann trinkt sie denn, und wer bringt ihr zu trinken?« fragen die Kinder weiter. »Ganz früh morgens, wenn Ihr schlaft, wenn die Sonne aufgeht, da kommen die Englein und bringen den Blumen zu trinken.« »Weißt Du was, Marie,« flüstert Karl ihr zu, »wenn die kleine Schwester heute Nacht weint, und Mama ihr zu essen giebt, dann wollen wir aufstehen und so lange ausgucken, bis die Engel kommen.« – Nun laufen die Kinder noch viel umher, und die Mutter zeigt und nennt ihnen manch Blümchen und Kräutchen, was sie noch nicht gekannt haben. Auch die bunten Käferchen, Schmetterlinge, Wasserjungfern und andere Tierchen machen ihnen viel Freude; aber sie greifen nicht nach ihnen, denn die Mutter sagt, daß man den kleinen Geschöpfen gar leicht Schmerz verursache, und daß sie nur sehr kurze Zeit leben.
Nachdem sie beinahe zwei Stunden umhergespielt haben, gehen sie wieder nach Hause. Trina steht schon vor der Hausthür mit der kleinen Elisabeth, die der lieben Mama ihre Händchen entgegenstreckt. Die Mutter nimmt sie auf den Arm und geht mit den drei Kindern ins Haus. Auf dem Tische in der Wohnstube steht schon das Abendbrot für die Kleinen: Schöne, warme Grütze mit frischer Milch darüber und für jedes Kind noch ein Stück Brot dabei. Nachdem sie ihre Hüte weggelegt haben, setzen sie sich um den Tisch und falten die Hände, auch die kleine Elisabeth auf der Mutter Schoß sitzt ganz, ganz stille, und Marie betet: »Diese Speise segne uns Gott, unser Vater im Himmel! Amen!« Dann essen sie, und es schmeckt ihnen trefflich. Als sie satt sind, sagt die Mutter: »Gott sei Dank für die Speise!«, küßt die Kinder und spielt ihnen dann noch ein Tänzchen und ein Liedchen. Sie springen noch eine Viertelstunde herum, dann singen sie mit Mama:
Gute Nacht, gute Nacht!
Hab' mich doch so müd' gemacht,
Will mich nun ins Bettlein legen,
Lieber Gott, gieb Schutz und Segen
Und der Engel heil'ge Wacht!
Gute Nacht, gute Nacht!
Gute Nacht, gute Nacht!
Vater, Dir sei Dank gebracht,
Daß so freundlich Du mir heute
Gabst Gesundheit, Speis' und Freude,
Heut' in Lieb' auch mein gedacht.
Gute Nacht, gute Nacht!
Darauf gehen sie mit Mutter und Trina hinauf, um zu Bett gebracht zu werden. Sie bestellen noch einen Gruß und Kuß an den lieben Papa, der in der Stadt ist und arbeitet; dann falten sie ihre Hände und knien um der Mutter Schoß, und jedes Kind dankt Gott für alles Gute, was es am Tage empfangen, und bittet um das, was es wohl haben oder behalten möchte; und was die Kinder noch nicht zu sagen wissen, das betet Mama in ihrem Namen. Darauf steigen sie in ihre kleinen Betten, thun die Augen zu und schlafen geschwind ein. Karl aber denkt noch an die Engel, die er am andern Morgen belauschen will.
*
Vier hat eben die Uhr geschlagen, da wacht die kleine Elisabeth weinend auf; Mutter wiegt sie freilich und singt:
Schlafe, Kindlein, hold und süß,
Wie im Engelparadies!
Schlaf' in stiller, süßer Ruh',
Thu' die lieben Äuglein zu.
Draußen stehn die Lilien weiß,
Schlank und schön zu Gottes Preis;
Droben in der lichten Höh'
Stehn die Englein, weiß wie Schnee.
Kommt, ihr Englein weiß und fein!
Wiegt mir mein lieb' Kindelein;
Wiegt sein Herzchen fromm und gut,
Wie der Wind der Lilie thut!
Schlafe, Kindlein, schlafe nun!
Sollst in Gottes Frieden ruhn;
Denn die frommen Engelein
Wollen Deine Wächter sein!
Aber sie will nicht wieder einschlafen und weint lauter. Sie bekommt Zähne, daher thut ihr der Mund so weh und ist so heiß, daß sie durstiger wird, als gewöhnlich. Die Mutter steht nun auf und macht ein Getränk zurecht für die Kleine; aber bis das fertig ist, schreit das ungeduldige Kindchen so laut, daß Karl erwacht. Erst reckt und streckt er sich etwas unmutig auf seinem Lager; als das Schwesterchen aber fort und fort schreit, und er muntrer wird, die Augen aufmacht und den anbrechenden Morgen durch die Vorhänge schimmern sieht, da fällt ihm wieder ein, was er sich gestern vorgenommen hatte. Sachte kommt er in die Höhe, guckt über die Bettlehne und zupft Mariechen bei der Nase. »Du, geschwinde, geschwinde,« flüstert er ihr zu, »ich glaube, die Engel sind nun da!« Marie steigt schnell über die Lehne in Karls Bett, das unten ans Fenster stößt. Sie biegen die Vorhänge zurück und schauen hinaus. Ei! wie wunderschön ist's draußen! Viel tausend goldrote Wölkchen fahren am Himmel umher. »Das sind gewiß die Wagen, darinnen die Engelein herunterfahren mit ihren Milcheimern,« meint Karl, »nun wollen wir schon aufpassen, wenn sie einsteigen!«, und Mariechen ruft, weil sie gar nicht kommen:
»Englein, Englein, kommt geschwinder,
Tränkt die lieben Blumenkinder,
Jedes hebt empor sein Köpfchen,
Wartet auf ein kleines Tröpfchen,
Englein, Englein, Flügel auf!
Seht, die Blümlein warten drauf!«
Aber die Englein kommen doch nicht, und die Kinder freuen sich einstweilen an den hohen Pappeln vor dem Fenster, die sich im Morgenwinde wiegen. »Diener! Diener! Diener!« sagen die Kinder und machen den Bäumen die Bewegung nach. »Warum die Bäume wohl so viel Diener machen?« fragt Karl. »Sie sagen dem lieben Gott guten Morgen und danken ihm für die süße Ruh',« sagt die Mutter; »ich glaube, daran habt Ihr noch gar nicht gedacht, nicht wahr?« Die Kleinen schweigen betroffen, dann faltet Mariechen die Hände, sieht in den goldnen Morgenhimmel hinein und betet: »Lieber Gott, ich danke dir, daß du uns alle hast schön schlafen lassen, mach' auch Elisabeth ihr Zahnweh bald wieder besser und hilf mir, daß ich heute ein artiges, gutes Kind bin, und behüte uns alle vor allem Bösen! Amen!« »Amen,« wiederholt Karl, zeigt dann auf die Schwalben und sagt: »Die grüßen wohl auch den lieben Gott? Aber die schreien 'mal laut dabei.«
Die Schwalben rufen: »Die Sonne kommt! Die Sonne kommt!« erwidert die Mutter und zeigt mit der Hand nach Osten. Siehe, da kommt sie herauf, wie ein feuriger Ball, und die Fenster des Kirchturms erglühen, wie im Feuer. Die Kinder stehen stumm mit offenem Munde da und staunen die Herrlichkeit an, bis die Strahlen sie so blenden, daß sie die Augen zuthun und wegwenden müssen. »Wenn die Sonne aufgeht, kommen ja die Engel!« ruft Karl plötzlich und sieht schnell in den Garten hinunter. Siehe da! Kraut und Büsche, Gras, Blumen und Bäume, alles blitzt von den tausend Tautröpfchen, die in der Morgensonne flimmern. »Sie sind schon dagewesen,« sagt Marie; »grade so sah gestern meine Blume aus, als Mama sagte, sie habe getrunken.« »Und alle goldenen Wagen sind weg,« klagt Karl, als er zum blauen Himmel aufschaut; »wie sind sie nur so schnell und leise bei uns vorbeigeflogen, und warum haben wir sie nicht gesehen?« »Wir Menschen können sie gar nicht sehen; sie sind viel zu zart für unsre Augen,« sagt Mama. »Aber wenn wir einmal gestorben sind,« sagt Marie, »dann können wir sie sehen, nicht wahr, Mama? und den lieben Bruder Edmund auch, und dann sind wir selbst Engel und können zusammen spielen in dem großen blauen Himmel, beim lieben Gott und beim Christkind.«
»Möchtest Du denn wohl sterben, daß Du auch im Himmel wärest?« so fragt Karl. »Ja gern!« antwortet Marie, »da ist auch immer ein Weihnachtsbaum mit viel tausend Lichtern und so schöne Blumen und Sterne und unser lieber Edmund!«
Karl ist ein bißchen nachdenklich, dann sagt er: »Ich möchte doch eigentlich lieber, Bruder Edmund käme wieder zu uns, dann könnten wir hier im Garten zusammen Pferd spielen, und er könnte von mir das Klettern lernen – – Kommt er vielleicht einmal wieder hierher, Mama? – Ich meine nur vielleicht.« – »Lege Du Dich nun wieder auf Dein Ohr und schlafe,« sagt die Mutter, »dann kommen vielleicht alle Engel mit Bruder Edmund und besuchen Dich im Traume.« »Das thue ich,« sagt Marie und steigt wieder über die Lehne in ihr Bett. Karl aber zieht die Mutter zu sich und flüstert heimlich: »Weißt Du was? Ich thue, als ob ich schliefe, und wenn die Engel dann kommen, dann reiß' ich die Augen schnell weit auf, dann seh' ich die Engel doch und Bruder Edmund auch, und den halt' ich dann fest?« Nun drückt er den Kopf ins Kissen und macht die Augen fest zu. In der Stube ist's nun so dämmerig und so still, und die Mutter singt wieder so sanft und so süß:
Wenn die Kinder schlafen ein,
Wachen auf die Sterne,
Und es steigen Engelein
Nieder aus der Ferne;
Halten wohl die ganze Nacht
Bei den kleinen Kindern Wacht.
Karl und Marie gähnen eins ums andere, und als die Uhr halb fünf schlägt, da schlafen beide schon wieder so fest, als wären sie gar nicht wach gewesen. –
*
Die Kinder schlafen heute etwas länger als gewöhnlich, Papa und Mama trinken schon lange Kaffee im Gartenzimmer, als Karl und Marie noch angezogen werden. Beide sind aber sehr froh über die schöne Frühstunde, die sie verlebt haben, und erzählen den ganzen Tag von der Herrlichkeit der aufgehenden Sonne.
Nach dem Frühstück zieht Karl die Glocke drei-, viermal, und darauf kommen alle Hausgenossen zusammen. Sie setzen sich in einen Kreis. Trina hat die kleine Elisabeth auf dem Schoß, und Mama geht ans Klavier; sie spielt, und alle singen das schöne Lied von Paul Gerhardt:
Wach' auf, mein Herz und singe
Dem Schöpfer aller Dinge,
Dem Geber aller Güter,
Dem treuen Menschenhüter.
Dann liest der Vater einen Abschnitt aus der Bibel und erklärt, was vielleicht dem einen oder dem andern unverständlich sein könnte. Darauf betet der Vater, und zuletzt betet Marie das Vaterunser. Dann spricht Papa mit dem Gärtner und giebt an, was im Lauf des Tages gearbeitet werden soll. Mama geht in Küche und Keller und macht ihre Anordnungen. Die Mädchen beginnen ihre Arbeiten, und die Kinder laufen und spielen noch ein Stündchen im Garten und Hause umher. Um neun Uhr ruft Mama die Kinder, und nun fängt der Unterricht an. Karl nimmt seine Rechentafel, Marie ihr Strickzeug. Nachher schreibt Marie. Darauf lesen die Kinder wechselsweise die schöne Geschichte vom kleinen David und vom Riesen Goliath. Karl kann freilich nur buchstabieren, aber Marie liest es dann, und so wird es ihm doch so verständlich, daß er nachher die Geschichte ganz gut wieder erzählen kann. Als sie damit fertig sind, holt Mama ein hübsches Bild und erzählt den Kindern davon. Auf dem Bilde sind an der linken Seite eine Menge kleiner, weißer Kügelchen; dabei ist ein Räupchen, so klein, wie eine halbe Stecknadel; daneben liegt ein Johannisbeerzweig, und auf dem einen Blatte sitzt eine wunderschöne Raupe, die macht einen hohen Buckel. Dort ist auch ein kleines Ding, schwarz sieht es aus und ist länglichrund; an der einen Seite hat es eine Spitze, mit der es an einem Blatte hängt, an der runden Seite aber fünf bis sechs goldgelbe Ringe. Dann folgt ein schöner, bunter Schmetterling, weiß mit vielen gelben und schwarzen Punkten und Strichen. »Davon will ich Euch ein Märchen erzählen,« sagte die Mutter, und die Kinder klatschen in die Hände und sehen erwartungsvoll zu ihr hinauf.
»Seht Ihr die weißen Kügelchen da? Das sind Eier,« beginnt die Mutter, »da drinnen sitzen freilich keine jungen Hühner, kleine Küchlein, wie Ihr sie habt so goldgelb und federweich im Hofe laufen sehen. Nein, dazu wären die Eier zu klein; aber doch ein Tierchen sitzt darin, dem es beim Sonnenschein zu eng und zu warm in dem kleinen Häuschen wird; drum reckt und streckt es sich, bis der liebe Gott das Häuschen öffnet, und es hinaus schauen kann in die schöne, liebe Gotteswelt. – Ei, und wie gefällt es ihm! Besonders der schöne, grüne Strauch, auf dem es sitzt. Es versucht nun mit dem kleinen Mäulchen die zarten, grünen Blätter zu benagen, und, siehst Du, es geht. Es frißt und frißt ein Blatt nach dem andern, bis es sich endlich in ein paar Tagen so dick gefressen hat, daß ihm sein Kleid überall drückt und kneift. Da wird es still und traurig und frißt nicht mehr und klagt und stöhnt und regt sich und dehnt sich, bis mit einem Male, knack! sein Kleid auf dem Rücken entzwei platzt. Da freut sich das Räupchen und drängt und zieht sich immer mehr, bis es endlich glücklich aus dem engen Kleide heraussteigt.« – »Aber geht es nun nackend?« fragt Marie. »O nein doch,« sagt die Mutter; »denk' nur, unter dem alten Kleidchen hat der liebe Gott ihm schon ein wunderschönes, neues, weites angezogen, viel schöner, als das erste: weiß, mit vielen kleinen schwarz und gelben Strichelchen und Punkten. Darin hat das Tierchen nun Platz zu wachsen, und siehe in wenigen Stunden ist's schon so groß geworden, wie eine Stecknadel. Vorn hat es zwei Beinchen und hinten vier, und zieht es nun beim Gehen die Beinchen zusammen, dann macht es solch hohen Thorweg, wie Ihr es hier auf dem Bilde seht. Die Menschen nennen solche Art Raupen Spanner.« – »Fängt die Raupe nun wieder an zu fressen?« fragt Karl. »Das will ich meinen,« erwidert die Mutter, »nun frißt sie noch dreimal mehr, als vorhin, aber es geht ihr auch wieder ebenso. Nach fünf oder sechs Tagen hat sie sich wieder so voll gefressen, daß das neue Kleid auch nicht mehr paßt, und sie wird immer dicker. Ihr schönes, buntes Kleid ist vom Fressen ganz schmutzig und schlecht geworden, und sie denkt: Ach hätte ich ein neues Kleidchen, ich wollte auch nimmermehr wieder so viel fressen! Nun wird sie so ängstlich und klagt und stöhnt und dehnt sich, und knacks! siehe, noch einmal hat ihr der liebe Gott ein neues buntes Kleid geschenkt, reichlich weit und groß, daß das Tier drin wachsen und sich recken kann. In einigen Stunden ist's Räupchen so groß wie diese Nähnadel. Da ist's froh und kriecht so vergnügt auf dem Strauch umher, als wäre es ihm noch niemals angst und bange gewesen. Gar schnell aber hat es sein Vornehmen vergessen, es schaut rechts, es schaut links, und dann fängt es wieder an zu fressen nach Herzenslust. Der Strauch aber wird immer kahler und trauert darüber und klagt's dem lieben Gott, daß das Räupchen doch wieder so viel fresse und ihm alle seine Blätter stehle. Und der liebe Gott spricht zur Raupe: Friß nicht so viel, denn du bekommst kein neues Kleid mehr; wird dir dies zu eng, und machst du's wieder schmutzig, dann steck' ich dich in einen Sarg, darin magst du dann liegen bleiben. Dann kannst du nicht laufen und nicht sehen und nicht fressen und mußt den Strauch schon in Ruhe lassen. Aber das Räupchen dünkt sich klug und meint: der liebe Gott macht nur Spaß; wenn mein Kleid platzt, giebt er mir wohl noch ein neues! Aber o weh, o weh, es geht der Raupe, wie allen, die dem lieben Gott nicht glauben wollen und lieber essen und trinken mögen, als das thun, was der liebe Gott ihnen sagt. Als nach sieben Tagen das Kleid wieder so eng, so eng geworden ist, daß die Raupe nicht mehr fressen mag und nicht mehr von der Stelle kann, da wird ihr doch bange und sie denkt: O Jemine! wenn ich nun wirklich in den Sarg müßte! Und ganz still hängt sie sich an ein Zweiglein fest und meint, sie will da hängen bleiben, bis sie wieder dünner wird. Aber es ist zu spät. Kaum hat sie ein Stündchen da gehangen, da sagt's Kleidchen knacks! und fällt ihr von den Schultern und vom Leibe und von den Beinchen. Die Raupe aber liegt im Sarge, kann nicht kriechen, denn sie hat keine Beine, kann nicht sehen, denn es fehlen die Äuglein, kann nicht mehr fressen, denn sie hat kein Mäulchen. So hängt sie da und kann nur den Oberkörper ein klein wenig rechts und links drehen, und das ist alles, alles! – So hängt sie da, lange, lange, sie weiß nicht, wie viel Tage und Nächte; denn sie sieht nicht Morgen, nicht Abend, nicht Sonne, nicht Mond. Aber die Zeit wird ihr lang, und sie fängt an, nachzudenken, wie verkehrt und wie unrecht es von ihr gewesen, daß sie des lieben Gottes Wort nicht gehört und beachtet hat. Das macht sie sehr traurig, und sie bittet Tag und Nacht den lieben Gott um Verzeihung und bittet ihn, er wolle sie wiederum erlösen aus ihrem Gefängnis und wolle ihr einen andern Sinn und ein anderes Werk geben, daß sie nicht mehr so gierig und gefräßig sei. Den lieben Gott aber dauert das Räupchen, weil es so gar tief und ernstlich betrübt ist, und er giebt ihr, was sie bittet. Noch einmal springt ihr Kleid, welches sie so fest eingeschlossen und gefangen hält, und das Tierchen guckt wieder heraus mit seinen hellen Äuglein in die weite Gotteswelt. Es reckt sich – und streckt sich und kann sich gar nicht denken, daß es wirklich wahr ist. Es zieht ein kleines schlankes Füßchen heraus, noch eins und noch vier. Da steht es auf seinen sechs Beinen – wundert sich – und schämt sich und freut sich – und schaut zum lieben Gott hinauf, möchte hin zu ihm, so gern, so gern, und bei ihm sein – und ihm danken. Es denkt gar nicht an Essen und Trinken, und meint: Ich will's versuchen, hinaufzusteigen in die hohe, helle, klare Luft. Und sieh, es geht. Statt des engen Kleidchens hat es ein weites Flügelgewand bekommen, und das trägt es hinauf, weit über Blumen und Bäume zum schönen, blauen Himmel. – Der liebe Gott aber sieht es freundlich an und sagt: »Du sollst nicht mehr Raupe heißen, ich nenne dich Schmetterling!«
»Das ist ein hübsches Märchen,« sagt Karl, »geht es aber wirklich allen Raupen so, daß sie erst in den Sarg müssen und dann Schmetterlinge werden?« – »Ja, allen,« erwidert die Mutter. »Erst fressen alle so viel, dann kommen sie in den Sarg, das nennt man: sie verpuppen sich, und dann kommen sie mit Flügeln wieder heraus und leben von Blumenduft und Sonnenschein.« – »Das muß aber schön sein,« sagt Marie, – »ich möchte auch wohl Flügel haben und zum Himmel fliegen können!« – »Dir wird's auch einmal so gehen,« erwidert die Mutter, »wenn Du den lieben Heiland bittest, dann wird er Dich auch vom Tode aufwecken und sagen: Du sollst nicht mehr klein Töchterchen heißen, Du sollst Engel sein.«
»Hat Bruder Edmund denn auch Flügel?« fragt Karl. »Das werden wir sehen, wenn wir zu ihm kommen,« erwidert die Mutter und singt dann mit den Kindern:
Die schmalen Leute haben
Mein Brüderchen begraben
Wohl in die Erde tief;
Ich wollt' es munter küssen,
Doch hab' ich's lassen müssen,
Weil's gar zu fest noch schlief.
Allein vom Himmel kommen
Die Engelein, die frommen,
Die wecken's fröhlich auf;
Und fliegen dann geschwinde
Mit unserm lieben Kinde
Zum Himmel hoch hinauf!
Nun legen die Kinder ihre Arbeiten wieder an Ort und Stelle und gehen in den Garten. Karl harkt die Wege, Mariechen jätet das Unkraut aus, Mama pflückt Erbsen zum Mittagessen, und Trina läßt die kleine Elisabeth hinter dem Kinderwagen gehen, den sie langsam, ganz langsam vorwärts zieht, damit das kleine Mädchen nicht falle. Nachher schoten die Kinder mit der Mutter die Erbsen aus und singen dabei:
Juchhei, Blümlein, dufte und blühe,
Recke alle Blättchen aus,
Wachse bis zum Himmel 'naus!
Juchhei, heididi, Blümlein, blühe!
Juchhei, Lüftlein, hauche und wehe!
Hell der Himmel über dir,
Bunt die Erde unter dir.
Juchhei, heididi, Lüftlein, wehe!
Juchhei, Bächlein klein, rausche und brause,
Brause hin durch Berg und Thal,
Grüß' die Lieben allzumal!
Juchhei, heididi, Bächlein, brause!
Juchhei, Vöglein, klinge und singe,
Blütenhain und Sonnenschein,
Sonnen, tanzt in bunten Reih'n!
Juchhei, heididi, Vöglein, singe!
Juchhei, Menschenherz, klinge und springe!
Wolltest du das letzte sein,
Da sich alle Wesen freu'n?
Juchhei, heididi, klinge und springe!
Dann bringen sie die leeren Schoten nach der großen Wiese zu der schönen braun und weiß gefleckten Kuh, und die freut sich und brüllt laut. »Hört Ihr's wohl?« sagt Trina, »die Kuh sagt auch: Danke! danke!«
*
»Guten Morgen, liebe Kinder!« ruft am andern Tage früh sechs Uhr der Vater den Kindern zu, die sich halb schlafend im Bette wälzen und gähnen. »Denkt Ihr auch daran, daß heute Sonntag ist?« »Ah, Sonntag, Sonntag!« rufen beide und springen schnell auf. »Heute bleibst Du bei uns und gehst nicht in die Stadt«, sagt Karl und küßt den lieben Papa. »Das ist richtig,« sagt dieser, »und wenn Papa und Mama nun in der Kirche gewesen sind und Ihr Eure Bibelverschen gut gelernt habt, dann – dann –« »Na, Papa, was dann?« fragen die Kinder und klatschen schon vor Freuden in die Hände. »Dann – – nun ratet einmal,« sagt der Vater. »Dann zeigst Du uns die Bilderbibel und erzählst uns Geschichten?« fragt Marie. »Nein,« erwidert der Vater, »von den Bildern will Euch Trina heut' erzählen.« – »Dann spielst Du mit uns Pferd?« meint Karl. – »Nein, noch Schöneres.« – »Dann pflücken wir Blumen und machen für Bruder Edmund einen Kranz?« fragt Marie wieder. »Nein, nein, nein, das alles nicht,« sagt der Vater, »dann kommt ein großer Wagen mit zwei lebendigen Pferden!« – – »Wir fahren aus! wir fahren aus!« jubeln die Kinder. Schnell springen sie aus den Betten, ziehen Strümpfe und Schuhe an und erzählen der kleinen Elisabeth in der Wiege die wunderschöne Neuigkeit. Lisbethchen lacht auch dazu, als ob sie es wirklich verstände. Nun lassen die Kinder sich nett waschen und mit kaltem Wasser begießen, damit sie stark werden. Dann ziehen sie ihre Sonntagskleider an: Marie und Elisabeth ganz weiße Kleider und Karl weiße Hosen und einen blau und weiß gestreiften Kittel. Jedes Kind bekommt aber einen Überzug über sein Zeug, damit es sich nicht beim Frühstück beschmutze. Vor dem Frühstück liest ihnen der Vater das zehnte Kapitel aus dem Evangelium des Marcus vor und zeigt ihnen ein Bild. Da sitzt Jesus auf einem großen Stein, und viele Kinder stehen um ihn her und sitzen auf seinem Schoß; und Jesus spielt mit ihnen und sieht so freundlich, so freundlich aus, daß Karl und Marie gar nicht aufhören mögen, das Bild zu besehen. Nach dem Frühstück befestigt der Vater das Bild an die Tapete und geht dann mit der Mutter zur Kirche. Die beiden Kinder lernen in der Zeit bei Trina die Geschichte auswendig, ganz genau mit den Worten, wie sie der Evangelist Marcus in seinem 10. Kapitel, im 13., 14. und 16. Verse erzählt: »Und sie brachten Kindlein zu ihm, daß er sie anrührte; die Jünger aber fuhren die an, die sie trugen. Da es aber Jesus sah, ward er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.« Dann besehen sie die Bilder in der großen Bibel und lassen sich von Trina erzählen, was sie nicht wissen.
*
Um elf Uhr, als die Eltern wieder nach Hause gekommen waren, und Karl und Marie die Geschichte wiederholt hatten, da geht es: roll, roll, roll! Vor die Thür fährt ein großer Wagen, und die Pferde stampfen und schnauben, als wenn sie bei dem schönen Wetter gar nicht stehen, sondern lieber schnell weiter laufen möchten. Die Köchin bringt einen großen Korb, der in den Wagen gesetzt wird. Karl hat aber an der einen Seite ganz flink hineingeguckt und hüpft nun herum, klopft sich auf die Brust, zieht die Schultern in die Höhe und ruft: »Ah, wie schön! ah, wie schön!« Marie folgt ihm, freundlich mit den Augen fragend, was er gesehen? Da faßt er sie um und sagt ihr leise ins Ohr: »Weißt Du was, wenn's regnet, ist es naß!« und springt lachend wieder fort. Marie sagt: »Ich will es gar nicht wissen!«, schmiegt sich an die Mutter und läßt sich in den Wagen heben, wo sie zwischen Papa und Mama ihren Platz bekommt. Trina, Elisabeth und Karl sitzen gegenüber. Martha, die Köchin, macht den Wagen zu, während die Kinder ihr: Adieu! sagen und Kußhand zuwerfen. Karl ruft noch: »Ich bringe Dir etwas mit!«, da knallt der Kutscher, und fort geht's in schnellem Trabe zum Garten hinaus.
Beinahe zwei Stunden fahren sie fort und fort; bald auf der Landstraße, bald zwischen Feldern; bald durch Gehölz zwischen hohen Tannen, Fichten, Buchen und Eichen. Die Sonne scheint warm, und die Vögel zwitschern ihnen einen freundlichen guten Morgen entgegen. Im Gehölz steigen Karl und Marie ein Weilchen mit dem Vater aus und suchen Blumen und Erdbeeren, die sie nachher der Mutter und der kleinen Elisabeth und Trina bringen wollen, dabei singen sie:
Wie hab' ich doch die kleinen
Waldvögelein so gern!
Sie hüpfen in den Zweigen
Und loben ihren Herrn.
Gott sorgt für sie auch treulich
Bei Tage wie bei Nacht.
Hat jedem in den Bäumen
Ein Bett zurecht gemacht.
Drin können sie sich wiegen,
Von Blättern zugedeckt,
Bis sie zu neuer Wonne
Der Morgen wieder weckt.
Und dieser Gott im Himmel
Will auch mein Vater sein,
Und hat mich noch viel lieber
Als tausend Vögelein.
»Vater! Vater! Karl!« ruft Marie plötzlich, »ach seht doch da oben auf dem Baume das kleine, süße Tierchen! Seht nur den dicken Schwanz! Ach, und nun legt es den Schwanz auf den Kopf; nun sieht es aus, als wenn es einen Helm aufhätte.« »Ach, wenn es doch einmal herunter käme! Komm, Tierchen, komm!« ruft Karl und lockt es mit der Hand. Aber das Tierchen will nicht kommen, es läuft und springt noch höher bis in des Baumes Spitze. »Kennt Ihr denn das Tier nicht?« fragt der Vater, »es ist doch in Eurem Bilderbuch. Denkt einmal an die Seite, über welcher E steht; was für Tiere sind darauf?« Marie besinnt sich und sagt: »Eber, Elster, Ente, Eichhorn! Eichhorn! Ja, das ist recht, es ist ein Eichhorn. Sieh, Karl, ebenso braun ist es und so niedlich, und sieh nur die schwarzen, klaren Augen!« Lange freuen sich die Kinder an dem niedlichen Tierchen, dann laufen sie weiter, um den voranfahrenden Wagen wieder einzuholen. Um ein Uhr kommt die Familie in einem Dorfe an. Nicht weit von der Kirche hält der Wagen still, und alle steigen aus und gehen in ein kleines Häuschen. Trina lacht und ist sehr vergnügt, denn in dem Hause wohnen ihre Eltern: Vater Martin und Mutter Anna. Die beiden Alten kommen auch schon heraus und grüßen freundlich die Ankommenden. »Nun, was sagst Du dazu, Anna, da sind wir alle zusammen und wollen bis Abend bei Dir bleiben!« So spricht die Mutter zu der alten Bauersfrau. »Ei, das freut mich gar sehr,« sagt diese. »Wenn Sie nur vorlieb nehmen wollen mit dem, was ich geben kann: schöne Milch, frische Eier und allenfalls einen Pfannekuchen.« »Ei, das ist ja vortrefflich,« sagt die Mutter, »Schinken habe ich noch dazu mitgebracht, da wollen wir's uns gut schmecken lassen.« Die Kinder laufen nun erst in den Hof und Garten, in Scheune und Kuhstall, besehen die Hühner, Gänse und Enten, und Trina nimmt die frischgelegten Eier mit ins Haus. Das Mittagsessen ist bald bereitet und verzehrt. Dann gehen Karl und Marie mit den Eltern spazieren. Trina aber mit der kleinen Elisabeth bleibt bei ihren alten Eltern und erzählt ihnen, wie gut sie es bei ihrer Herrschaft habe, und die Alten ermahnen sie, daß sie immer fromm und fleißig und freundlich sein solle, damit die Herrschaft niemals über sie klagen müsse. Trina erkundigte sich auch nach allen früheren Bekannten, und wie es sonst im Dorfe zustehe, und die Alten erzählen ihr von allem.
*
Nach einer Stunde kommen die andern wieder, und die alte Anna macht nun Kaffee. Da flüstert Karl der Mutter etwas leise ins Ohr. Diese nickt bejahend, und Karl läuft zum Stall, wo der Kutscher mit Wagen und Pferden steht. Karl läßt sich den großen Korb geben und bringt ihn triumphierend ins Zimmer. Ein großer Kuchen ist darin. Die Mutter legt ihn auf eine Schüssel, welche die alte Anna bringt, giebt dieser den Korb und sagt: »Was noch drin ist, das haben wir für Dich und Vater Martin mitgebracht.« Anna nimmt das Papier heraus, worauf der Kuchen gelegen, und findet darunter ein schönes warmes Leibchen, was die Mutter gekauft und Trina genäht hat, und für Vater Martin ein Paar wollene Strümpfe, die Trina gestrickt hat, und ein Predigtenbuch. »Sieh, das Buch habe ich dabei gelegt, daß Du drin lesen kannst, wenn Du wieder einmal so viel Gicht in den Füßen hast, daß Du nicht zur Kirche gehen kannst,« sagt der Vater. Martin und Anna bedanken sich schön und freuen sich herzlich über die Geschenke. Nun wird Kaffee getrunken und Kuchen gegessen nach Herzenslust. Der Kutscher spannt dann die Pferde vor den Wagen. Alle nehmen Abschied und versprechen, bald wieder zu kommen, steigen in den Wagen und fort geht's wieder nach Hause.
Es ist schon nach sieben Uhr, als sie zu Hause ankommen. Karl und Marie plaudern unterwegs viel von allem, was sie gehört und gesehen haben; aber Lisbethchen schläft ganz süß in der Mutter Arm, die sie mit ihrem Tuche ganz zugedeckt hat, damit der Wind sie nicht kalt mache. Als der Wagen still hält, wird die Kleine wach und sieht sich verwundert um. Trina geht dann schnell mit ihr oben in die Schlafstube, zieht sie aus und legt sie in die Wiege, wo sie bald wieder einschläft. »Das war ein schönes Vergnügen!« sagt Marie zu Karl, als auch sie zu Bette wollen, und beide Kinder danken den Eltern, daß sie sie mitgenommen haben.
*
Nach einigen Tagen fangen die Kinder an zu husten, erst Karl, dann Elisabeth und ein paar Tage später auch Marie. Mama meint, sie müssen sich am Sonntag wohl erkältet haben. Sie bekommen abends Kamillenthee mit Kandis zu trinken, dürfen am Tage nur wenig essen und nur in den Mittagsstunden, wenn das Wetter ganz warm ist, im Garten spielen. Aber der Husten will nicht besser werden. Bald kommt auch der Schnupfen dazu, so stark, daß allen Kindern die Augen thränen. Das Spielen will gar nicht recht gehen. Karl ist sehr verdrießlich, und Mariechen und Elisabeth weinen auch oft und wissen nicht recht warum. Am nächsten Sonntag, als Mama Karl anziehen will, sind seine Arme und Beine, die Brust und das Gesicht ganz rot. Mama deckt ihn warm wieder zu und schickt zum Doktor; der erklärt: Karl hat die Masern, und Marie und Elisabeth werden sie auch wohl bald bekommen! So ist's auch. Zwei Tage später sind die kleinen Mädchen auch am ganzen Körper rot, und müssen die drei fröhlichen Kinder still im Bette liegen und dürfen sich gar nicht viel rühren. Die ersten Tage geht das nun ganz gut, da fühlen sich die Kinder matt und müde und liegen ganz gern im Bette. Aber wie das Fieber nicht mehr so stark ist, und den Kleinen nichts weh thut, da gefällt es ihnen gar nicht, still zugedeckt im Bette zu liegen. Vor allen der ungeduldige Karl ist sehr unruhig und verdrießlich, er möchte gar zu gern umherlaufen und spielen, denn er meint, er sei ganz gesund. Mama ist immer bei den Kindern, Tag und Nacht. Tante Emilie, Papas Schwester, wohnt jetzt ganz bei ihnen und sorgt für alles, was im Hause geschehen muß, damit Mama den ganzen Tag für die Kinder sorgen und mit ihnen spielen könne. Oft erzählt Mama den Kleinen Geschichten oder liest ihnen vor; sie lernen auch ein kleines Liedchen, das heißt:
Ich liege im Bett und bin so krank,
Muß nehmen den gelben salzigen Trank,
Die Mutter sieht so betrübt mich an,
Daß ich immer nicht aus dem Bette kann.
Ach, lieber Vater im Himmel mein,
Laß mich doch bald wieder besser sein.
Karl aber, der ist ein Schelm, der sagt immer: »Ich liege im Bette und bin gar nicht krank!« Mariechen ist so folgsam und gut, daß sie Mama gar nicht viel Mühe macht; sie meint auch: »Ich mag wohl ein bißchen krank sein, dann sitzt meine liebe Mama immer bei mir und hat gar nichts anderes zu thun, das ist wunderschön!« Karl ist aber nicht so folgsam, er wirft oft die Decke ab und weint, wenn er Medizin einnehmen soll. Mama muß zuweilen ein sehr ernstes Gesicht machen und sagen: »Karl, sei folgsam, Mama will es!«, ehe er das thut, was er thun soll. Einmal, als Mama auf einen Augenblick das Zimmer verlassen, und Trina bei Elisabeth zu thun hat, da steigt der böse Karl ganz leise aus dem Bette, läuft mit seinen kleinen nackten Beinen zur Wiege und ruft: »Piep! Elisabeth!« Trina erschrickt sehr, ebenso Mama, die gerade wieder ins Zimmer tritt. Sie straft Karl, steckt ihn ins Bett und sagt: »Karl, der liebe Gott wird Dich noch lange krank lassen, weil Du nicht folgen willst!« Mama sieht dabei so traurig aus, daß Karl bitterlich darüber weinen muß und verspricht, nie wieder so unfolgsam zu sein. Abends thut ihm sein Kopf weh und sein Leib, und er ist ganz blaß, und alle Röte von seinem Körper ist ganz weg. Papa und Mama sind sehr betrübt. Der Doktor wird wieder geholt, und Karl muß nun braune, bittere Medizin einnehmen. Er thut es auch ganz freundlich und sieht nur immer nach Mamas Augen, und wenn er Thränen drin erblickt, dann bittet er: »Mama, Du mußt nicht weinen, ich kann das nicht aushalten, ich will auch gewiß immer ein gutes Kind sein!« Karl ist nun acht Tage lang sehr krank; er denkt nicht an Aufstehen, kann nicht spielen, nicht singen. Die beiden kleinen Mädchen sitzen schon im Bette und spielen mit Puppen und kleinen Stühlen, Tischen, Betten, Häuschen und Tieren, die Mama ihnen von Papier ausgeschnitten und auf ein Theebrett gestellt hat, welches die Kinder auf ihrer Bettdecke stehen haben. Ja, zwei Tage später dürfen sie sogar schon eine Stunde aus dem Bette sein und können an ihrem kleinen Tische spielen; Karl muß aber noch immer im Bette sein, und Mama erinnert ihn oft daran, daß das nicht würde nötig sein, wenn er folgsam gewesen wäre; er verspricht auch immer aufs neue, er wolle von nun an sehr gehorsam sein.
Nach vierzehn Tagen endlich darf Karl mit den Schwestern wieder in die Wohnstube gebracht werden, und acht Tage später, als die Sonne einmal recht warm ins Zimmer scheint, da erlaubt der Doktor ihnen, in den Garten zu gehen, erst nur eine halbe Stunde, den andern Tag eine ganze, und acht Tage später, da spielen die Kinder wieder im Garten, als wären sie gar nicht krank gewesen, und singen abends:
Wir danken dir, du lieber Gott,
Du hast uns errettet von Krankheit und Tod,
Und schneller, als wir es selbst gedacht,
Hast du uns wieder gesund gemacht.
Wir spielen und essen und trinken dazu
Und schlafen des Nachts in süßer Ruh';
Wir sind nicht mehr krank, nicht im Bette mehr,
Das danken wir dir und freuen uns sehr.
*
»Es ist heut' so schönes Wetter, und ich habe Zeit, wollt Ihr mit mir ins Gehölz gehen?« fragt der Vater eines Morgens, als die Sonne freundlich ins Fenster scheint. »Ja gern, ja gern!« rufen beide Kinder. »Geht Mama auch mit?« »Ihr müßt sie drum bitten,« antwortet der Vater. Mama nickt freundlich, Packt ihr Nähzeug zusammen, klingelt, damit Trina die kleine Elisabeth nehme, und macht sich fertig. Lisbeth zeigt freilich ein etwas traurig Gesichtchen und sagt: »Mi auch mit.« Als Mama aber den bunten Hampelmann aus dem Schrank nimmt und sagt: »Sieh, Lisbeth! Der will mit Dir tanzen!«, da lacht die Kleine, greift nach dem Hampelmann, und Trina singt: »Es tanzt ein bunter Hampelmann in unsrer Stube rum, und dreht sich mit Lisbethchen im Kreise.« Die ist ganz fröhlich und wirft Papa und Mama und den Geschwistern freundlich Kußhändchen zu, als sie aus der Hausthür und dem Gehölze zugehen. O, wie hoch sind da die Bäume! Karl und Marie springen, aber sie können nicht an die Blätter kommen, nicht einmal der Papa. Auf der Erde liegen schon viele Blätter, die der Wind abgeweht hat, die sind ganz gelb, und es raschelt: rusch, rusch, rusch, wenn man drin geht. Die Bäume sehen jetzt gar nicht so grün aus, wie im Frühling: einige haben gelbe Blätter, einige braune, andere ganz brennend rote und noch andere grüne. Das kommt, weil die Sonne so lange darauf geschienen hat, den ganzen Sommer lang; die hat die grünen Blätter so bunt gemalt; es ist wunderhübsch anzusehen. »Ich suche Erdbeeren!« ruft Karl, läuft zwischen die Büsche und sieht auf den Boden, wie er im Sommer so oft gethan, aber er findet keine. »Es ist ja keine Erdbeerenzeit,« sagt Mama, »aber such' 'mal an den kleinen Büschen, vielleicht findest Du schwarze Brombeeren, die schmecken auch süß und schön. Aber eßt nichts, was Ihr mir nicht gezeigt habt, denn hier im Gehölz wachsen auch Giftbeeren, und wer die ißt, der bekommt davon viel Schmerzen im Leibe und wird sehr krank.« Bald finden Karl und Marie Brombeeren, hier einige und dort einige und immer noch mehr. Sie legen alle in Mariens Körbchen, um sie nachher mit Papa und Mama aufzuessen. – »Hör' einmal!« sagt Marie, »ich glaube, da weint ein Kind.« Sie gehen dahin und richtig: da steht ein kleines Mädchen und weint, und ihr Kleid und ihre Schürze sind ganz voll roter Flecken. Zu ihren Füßen liegt ein Korb, und die Erde ist bedeckt mit einer Menge Brombeeren. »Was fehlt Dir?« fragt Karl. »Ach,« sagt das Mädchen, »ich hab' den ganzen Morgen Brombeeren gesucht, die wollte ich in der Stadt verkaufen, damit ich meiner kranken Mutter Geld bringen könnte: nun bin ich über die Baumwurzel gefallen; alle Brombeeren sind schmutzig, und wie sieht mein Zeug aus! Ach, ach, nun kann ich gar nicht in die Stadt gehen!« – So klagt das arme Kind und weint noch lauter. »Weine nicht,« sagt Marie, »wir wollen Dir unsere Brombeeren alle schenken und wollen mit Dir suchen, bis Dein Korb wieder voll ist.«
*
»Wie heißt Du, mein Kind?« fragt der Vater, der auch herzugetreten ist. »Lotte Bendel,« antwortet das Mädchen, und giebt sich Mühe, nicht mehr zu weinen. Der Vater spricht noch länger mit ihr, und sie erzählt, ihr Vater sei ein Fischer gewesen: im Frühjahr habe der Sturm in der Nacht das Boot, worin er gewesen, umgeworfen; so sei er ertrunken. »Nun bin ich mit der Mutter allein,« fährt sie fort. »So lange sie gesund war, da hat sie immer viel gewaschen und genäht und mich in die Schule geschickt; aber seit zwei Monaten ist sie krank, nun kann ich nur abends zur Schule gehen. Morgens muß ich bei der Mutter bleiben und sehen, ob ich nicht hier und da ein paar Schillinge verdienen könne, und wenn unser Doktor nicht so gut wäre und uns oft etwas zu essen schickte, da müßten wir wohl oft hungrig zu Bette gehen. Ach, unser Doktor ist so gut! Er sagt immer, wir sollen nicht traurig sein, wir sollen nur den lieben Gott bitten, der werde uns gewiß helfen. Ach, ich hab' ihn schon viel gebeten, er solle meine liebe Mutter wieder gesund machen; aber sie wird alle Tage kränker und sagt so oft: Ich gehe gewiß bald zum lieben Herrn Christus, wo der Vater ist. Ach, dann bin ich ganz allein!« klagt Lottchen und weint wieder lauter. »Aber wenn die Mutter Dir auch genommen würde, so bleibt der liebe Gott doch bei Dir und wird Dich nicht verlassen!« tröstet die Mutter und streichelt dem weinenden Mädchen die Locken. »Wo wohnst Du denn und wie alt bist Du?« »Als der Vater starb, war ich gerade elf Jahr, und wir wohnen auf den Kajen Nr. 134,« sagt Lottchen. Der Vater greift in die Tasche und giebt dem Mädchen acht Schilling. Sie trocknet schnell die Augen, sieht ihn an und sagt: »Ich habe nicht gebettelt. Mutter sagt, ich solle nie betteln!« »Das ist auch gut, mein Kind,« erwidert der Vater; »Du hast auch nicht gebettelt: aber dies schickt Dir der liebe Gott durch mich für Deine kranke Mutter und für die verlorenen Brombeeren, das darfst Du annehmen. Höre nur nicht auf, den lieben Gott zu bitten, und Du sollst sehen, er wird auch helfen!« »Ich danke, so vielmal ich kann!« sagt Lottchen, und die Thränen laufen ihr über die Backen. Karl und Marie hätten das Mädchen gern mit sich genommen, aber sie sagt, sie müsse zu ihrer kranken Mutter, und eilt weiter. – Vater und Mutter sprechen viel mit einander und sehen ganz ernst aus, auch die beiden Kinder sind noch ein Weilchen still und denken an das traurige Lottchen. Bald aber finden sie neue Blümchen und Brombeeren und bunte Käfer, und die Waldvögel pfeifen ihnen so lustige Liedchen vor, daß sie fröhlich mit ihnen singen:
Tireli, Tirela, Tireli, Tirela!
So singen die Vögel im Walde ja,
Und alles tanzt und hüpft und springt,
Weil's gar zu wunderlieblich klingt.
Tireli, tirela, tireli, tirela,
So singen die Vögel im Walde ja.
Tireli, tirela, tireli, tirela,
So singen die Vögel im Walde ja,
Die Blättlein tanzen allzumal,
Im hohen grünen Waldessaal.
Tireli, tirela, tireli, tirela,
So singen die Vögel im Walde ja.
Tireli, tirela, tireli, tirela,
So singen die Vögel im Walde ja,
Im Bächlein tanzen die Wellen all',
Vergoldet vom hüpfenden Sonnenstrahl.
Tireli, tirela, tireli, tirela,
So singen die Vögel im Walde ja.
Tireli, tirela, tireli, tirela,
So singen die Vögel im Walde ja,
Hirsch, Rehlein, Eichkätzchen und Häschen im Busch,
Sie springen und klettern und rennen husch, husch!
Tireli, tirela, tireli tirela,
So singen die Vögel im Walde ja.
Tireli, tirela, tireli, tirela,
So singen die Vögel im Walde ja.
Dem Menschen klopft hüpfend das Herz in der Brust,
Er kann es nicht lassen, er jauchzet vor Lust.
Tireli, tirela, tireli, tirela,
So singen die Vögel des Waldes ja.

Nach zwei Stunden kommen sie wieder im Hause an, Karl und Marie waren müde geworden, ruhen sich aus und zeigen Lisbeth die hübschen Blumen und Beeren, die sie gepflückt haben: Papa und Mama gehen aber nach Tische noch einmal zur Stadt und kommen erst abends wieder nach Hause. Sie sind nach den Kajen gewesen und haben Lottchens Mutter besucht und getröstet. Frau Bendel ist sehr krank, und obgleich ihr der Doktor viel Medizin giebt, so wird sie doch immer kränker.
*
Nach einigen Wochen wird das Wetter sehr rauh und unfreundlich. Die liebe Sonne verkriecht sich, und Wind und Regen schlagen an die Fenster, daß es gar nicht mehr angenehm auf dem Lande ist. Darum schickt der Vater einen großen Blockwagen aus der Stadt, auf den werden alle Sachen gepackt, die im Hause sind; dann setzt Mama sich mit den Kindern in eine große Kutsche, und alle fahren zur Stadt, um den Winter über in dem Hause zu bleiben, wo des Vaters Comptoir ist. Das Haus hat dicke Mauern, doppelte Fenster und Öfen, darin man tüchtig einheizen kann, daß die Zimmer gut warm werden. Die Kinder freuen sich an dem vielen Neuen, was sie hier zu sehen bekommen, und an dem vielen Fahren und Gehen auf der Straße, was sie vom Fenster aus sehen können. Nach vierzehn Tagen wird es noch viel unruhiger, als es bisher gewesen ist. Da fahren mehrere beladene Wagen vorbei. Frauen gehen dahin mit Körben, Männer mit Trachten. Alles zieht nach dem großen Marktplatz, der an dem einen Ende der Straße ist. Mariechen und Karl sind viel am Fenster und freuen sich über die vielen Spielsachen, die auch vorbei getragen werden. Sie wollen auch gern zur Hausthüre hinaus, um alles genauer besehen zu können; aber Mama leidet es nicht, sie sagt: »Es geht nicht, es ist draußen zu voll, da könnte Euch leicht ein Unglück begegnen. Wenn Ihr artige Kinder seid, will ich morgen mit Euch hingehen, da sollt Ihr die Herrlichkeiten recht nahe besehen.«
Karl und Mariechen gehen recht früh zu Bett, damit bald morgen kommt. Wie nun morgen da ist, da arbeiten sie ganz fleißig und sehen immer zwischendurch einander an und lächeln. Als sie fertig sind, sehen sie die Mama freundlich an, und die fragt: »Na? Was wollen wir nun?«
Karl. »Nun, gehen wir mit Dir aus!«
Mutter. »Ja, wirklich?«
Marie. »Ja wirklich, Mama, Du hast es uns versprochen!«
Mutter. »Nun wenn ich es Euch versprochen habe, da muß ich wohl Wort halten. So geht und holt Eure Hüte, und dann geht unten ins Schreibzimmer und sagt Eurem Papa, daß Mama mit Euch nach dem Jahrmarkt gehen will.« Eins, zwei, drei, laufen die Kinder fort, machen sich fertig und gehen zum Papa. Der ruft ihnen entgegen: »Sieh da! Wollt Ihr aus? Wo soll denn die Reise hingehen?«
Karl. »Mit Mama nach dem Jahrmarkt.«
Vater. »Ei, das ist ja eine freundliche Mama! Was wollt Ihr denn da?«
Karl. »Alle die schönen Sachen sehen.«
Vater. »Da muß ich der Marie wohl vier Schillinge schenken, damit sie auch etwas von den schönen Sachen kaufen kann.«
Marie. »Ja gern! Aber Karl bekommt doch auch Schillinge?«
Vater. »Der Karl ist ja noch so klein, der braucht wohl noch keine.«
Marie. »Ach ja doch, Papa, wenn er sich auf die Zehen stellt, ist er beinahe ebenso groß, wie ich.«
»Ja gewiß,« sagt Karl, faßt sich am Schreibpult an und hebt sich, so hoch er kann, »ich kann auch sogar schon reiten auf meinem Schaukelpferd, das kann Marie nicht.«
Marie. »Ach, ich könnte das auch wohl, ich thue es nur nicht, weil ich ein Mädchen bin.«
Vater. »Nun, wenn der Karl schon so ein großer Held ist, da muß ich ihm auch wohl zwei Schillinge geben.«
Marie. »Dann geb' ich Dir noch einen von meinen, dann haben wir jeder drei, das ist am besten.« Die Kinder küssen darauf den Vater, bedanken sich und springen jubelnd zur Thür, an der Mama schon steht und sie erwartet.
Nun gehen sie hin nach dem Marktplatz. O, wie viele Buden stehen da, eine bei der andern, die Kinder können sie gar nicht zählen, und es ist ein Spektakel! Der Eine ruft, der Andre schreit, der Dritte schnurrt, der Vierte pfeift, der Fünfte trompetet. Die Kinder sind erst ganz verstummt und wissen nicht, wohin sie zuerst sehen sollen.
Da ist eine Bude ganz voll Schuh und Stiefel, dann eine mit Kuchenwerk, in der nächsten werden Bilderbücher verkauft, hier Spielsachen, da hölzerne Eimer, Butten, Tonnen, kleine Wasserwagen, Schiebkarren und hölzerne Pferde, da lauter blanke Zinnsachen, ein bißchen weiter kleine Tiere: Ochsen, Kühe, Pferde, Schafe, Schweine, auch Netze, Hirsche und Hasen, sogar ein großer Elefant steht dazwischen und ein Kamel mit zwei Höckern, und dem sitzt ein Äffchen auf dem Hals. Daneben ist eine Bude mit Bildern. Dabei steht wieder ein Tischchen mit lauter kleinen Hähnen und Hühnern, viel kleiner als die Sperlinge, ganz ordentlich mit Klauen und einem Schnabel und einem roten Kamm auf dem Kopf und mit wirklichen Federn, wie die lebendigen Hühner haben, nur krähen und gackern können sie nicht. Ein Tisch ist auch da mit Schafen, die ein wirkliches weißes Fellchen haben und ein buntes Band um den Hals. Ach, es ist alles gar zu niedlich! Die Kinder müssen immerwährend Ach! und Oh! rufen.
Nun stehen sie vor einer Spielzeugbude, und Marie bedauert sehr, daß Schwester Lisabeth nicht mit ist, um aß' die hübschen Puppen zu sehen. Auf einmal fällt ihr ein, daß sie drei Schilling hat, und sie denkt, sie will der kleinen Schwester eine Puppe mitbringen. »Kann ich wohl die große Puppe kaufen, die das rote Kleid an hat mit Gold besetzt?« fragt sie die Frau. »Ja gern, mein liebes Mamsellchen,« antwortet diese und hält Marien die Puppe hin. »Aber wie viel Geld kostet sie, ich habe nur drei Schillinge,« sagt Marie. Die Frau lacht und erwidert: »Dafür kannst Du die Puppe nicht kaufen, die kostet 30 Mal mehr; aber ich habe auch niedliche Sachen zu drei Schillinge. Sieh hier, eine alte Ente mit zwei Jungen, die kann ordentlich quack, quack sagen, und hier einen kleinen Mann, der tanzt, und der Kasten macht Musik dazu; und hier einen bunten Kuckuck, der ruft seinen Namen, und hier ein ganzes Schächtelchen mit weißen Schäfchen und einem Hirten dabei.« – Marie sucht und sucht, bis Mama zu ihr tritt, die in der Zeit mit Karl gesprochen hat, und sagt: »Nimm Du diesen bunten Hampelmann, der mit seinen Armen und Beinen so possierlich um sich schlägt, wenn man an dem Faden zieht. Du weißt wohl, Lisbethchen hatte früher schon einen und spielte so gern damit, nun hat sie ihn neulich auf einem Spaziergang verloren.« Das thut Marie. Sie giebt ihr Geld hin, nimmt den Hampelmann und läßt ihn tanzen. Karl hat sich indes eine Peitsche gekauft, die prächtig knallt, und Mama geht noch an eine Kuchenbude und nimmt eine große Tüte voll Pfeffernüsse mit. Nachdem sie sich nun wohl eine Stunde lang umgesehen haben, gehen sie wieder nach Hause. O, wie freut Elisabeth sich über den närrischen Hampelmann, und wie freut Marie sich über die fröhliche Elisabeth. Karl sieht das und sagt: »Oh weh, daran habe ich gar nicht gedacht, sonst hätte ich Lisabeth auch was mitgebracht. Na, sie kann zuweilen mit meiner Peitsche spielen, und ich will ihr wunderschön was vorknallen.« Nach Tische giebt Papa den Kindern Rätsel und Rechenexempel auf, und wer es rät oder ausrechnet, bekommt eine Pfeffernuß aus der großen Tüte. Bringt es aber keiner von ihnen heraus, so bekommen Papa und Mama jeder eine. »Einige müssen wir auch nachlassen für Elisabeth und Trina und Martha,« erinnert Mariechen. »Ach ja,« sagt Karl, »laß mich ihnen welche hinbringen.« Mama legt ihm zwölf Stück in ein Körbchen und sagt: »Da hast Du sechs für Trina und sechs für Martha. Lisbethchen kann noch keine essen, die hat noch nicht genug Zähne.« »Dann wollen wir welche für sie aufheben, bis sie sie essen kann,« sagt Karl, läuft hinaus und verteilt seine Schätze.
*
Seit die Familie wieder in der Stadt wohnt, geht die Mutter jeden Morgen nach den Kajen und besucht die kranke Frau Bendel. Wenn das Wetter gut ist, begleitet Marie sie zuweilen, dann bringen sie der armen Kranken Suppe oder Gemüse oder Früchte oder einen kleinen Fisch oder eine Weintraube. Dafür sind Lottchen und ihre Mutter sehr dankbar, denn sie können sich so schöne Sachen nicht kaufen. Mariechen freut sich, wenn sie mit Mama gehen darf, denn Lottchen ist immer so freundlich und erzählt ihr so mancherlei, sie hat das Mädchen sehr lieb und möchte nichts lieber, als daß es mit ihrer Mama ganz zu ihnen ins Haus ziehen könnte, dann sollte Frau Bendel ein besseres Bett und eine freundliche Stube haben, und Lottchen sollte immer mit ihr zusammen sein. Mama sagt aber: »Das geht nicht! Frau Bendel ist so krank, daß sie auch nicht einmal in einem Wagen durch die Straßen gefahren werden kann.« Eines Tages, als die Mutter die Kranke besucht, weint Lottchen und sagt: »Ach, meine Mama schläft so lange und so fest, und die Nacht hat sie mir wohl sechsmal die Hand gedrückt; sie wacht gewiß gar nicht wieder auf.« »Sie wacht im Himmel wieder auf, und da ist's wunderschön!« sagt Mariechens Mutter. »Sei ruhig, Lottchen, Du sollst auch nicht allein bleiben, ich will jetzt Deine Mutter sein, und Karl und Marie sollen Deine Geschwister werden.« Nach einigen Tagen wird Frau Bendel begraben, und Lottchen wohnt von der Zeit an mit Karl und Marien in einem Hause. Die freuen sich sehr über die neue große Schwester, die nun auch wieder in die Schule geschickt wird und Nachmittags bei der Mutter näht und den kleinen Geschwistern Geschichten vorliest.
*
Einige Wochen später kommt einmal ein Leiterwagen vor das Haus gefahren, und auf den Strohbündeln, die drin liegen, sitzen der alte Vater Martin, Mutter Anna, ihr Enkel, der Sohn des Dorfschulmeisters, ein kleiner fröhlicher Bursche von sechs Jahren. Trina freut sich, ihre alten Eltern zu sehen und den kleinen Knaben, den sie zur Taufe gehalten hat. Alle drei steigen aus und gehen ins Haus. Die Mutter bringt ihnen Frühstück, und die Kinder sind sehr froh über den kleinen Spielkameraden, der vielleicht bis zum andern Morgen bei ihnen bleiben soll. Vater Martin hat Kartoffeln mitgebracht zum Wintervorrat, vier große Säcke und zwei kleine, die trägt er, nachdem er sich erquickt hat, mit Trina und Martha in den Keller. Die beiden kleinen Säcke müssen sie aber stehen lassen; denn der Alte hat extra zwei so kleine genommen, damit Karl und Peter, der kleine Bauerjunge, jeder einen Sack in den Vorratskeller tragen können. Das geschieht auch. Die Mutter bezahlt dem Martin dann die Kartoffeln, und dieser geht darauf fort, um verschiedene Dinge in der Stadt zu besorgen. Mutter Anna plaudert mit Trina, und die Kinder spielen mit einander. Ehe es aber dunkel wird, giebt Mama Lottchen vier Schillinge, damit sie für den kleinen Peter einen Drachen kaufe, den er sich sehr wünscht, und der ganz in der Nähe zu haben ist. Marie, Karl und Peter gehen voll Freude mit Lottchen zu der Frau, die an der andern Seite der Straße einen kleinen Laden hat. Eine Menge kleiner Drachen hängen an der Wand und vor den Fenstern. In der Mitte prangt ein einziger großer von rot, schwarz und gelbem Papier. Er ist wunderhübsch, und im mittelsten roten Felde glänzt ein prächtiges weißes hamburger Wappen. Lottchen fragt nach dem Drachen, bezahlt die vier Schillinge und giebt ihn dem kleinen Peter. Der aber schüttelt den Kopf und sagt: »Den nicht, das ist ja ihr einziger großer Drache, den mußt Du ihr nicht wegnehmen, dann wird sie ja traurig.«
Lottchen. »Ich nehme ihn nicht weg, sieh, die Frau giebt ihn mir, und ich gebe ihr Schillinge dafür.«
Peter. »Ja, was helfen ihr die Schillinge, sie hat ja dann doch keinen großen Drachen mehr.«
Lottchen. »Sie will aber lieber vier Schillinge haben, als den großen Drachen.«
Peter. »Die kann sie ja auch gern behalten, aber wir wollen einen von den kleinen Drachen mitnehmen.« – –
Die Frau mußte endlich zu Hilfe kommen, dem Kleinen eine Menge buntes Papier zeigen und ihn versichern, sie werde sich denselben Abend drei große, neue Drachen machen, wozu er selbst das Papier aussuchen könne. Das thun Peter und Karl, und die Frau verspricht ihnen noch, jeder Drache soll in der Mitte ein hamburger Wappen oder ein Hansakreuz haben. Nun erst fängt Peter an, sich gewaltig über sein Geschenk zu freuen, schnallt es auf dem Rücken fest, und alle vier wandern wieder nach Hause. Indessen ist es aber dunkel geworden, und der Leuchtenanstecker ist schon beschäftigt, die Straßenlaternen anzuzünden. Das ist etwas ganz neues für Peter. »O,« sagt er ganz verwundert, »Ihr habt hier Laternen, damit Ihr auf der Straße sehen könnt? Wißt Ihr, was wir haben? Einen ganzen Himmel voll Sterne!« – »Ach, Sterne haben wir auch,« sagt Karl, »sie sind nur nicht recht hell. Aber sieh die Laternen einmal recht an, dann schießen sie auf Dich, jede Laterne mit fünf Pfeilen. Kannst Du es sehen? Sieh, so mußt Du die Augen zudrücken, dann kommen die Pfeile.« Peter und Marie machen Karl das Kunststück nach, lachen über die langen Strahlen und laufen ins Haus. Mama steht schon in der Thür und erwartet sie, weil sie so lange weggeblieben sind, und erzählt ihnen, daß Vater Martin noch immer nicht von seinen Besorgungen zurück sei, daß er also auch nicht mehr aufs Dorf fahren könne, sondern in der Nacht in der Stadt bei ihnen bleiben müsse. Das ist eine neue Freude für die Kinder. Sie tragen nun mit Mama Bettzeug hinunter in die Vorstube und machen da ein Lager zurecht für die drei Landleute. Vater Martin kommt erst gegen 8 Uhr zurück, Pferd und Wagen hat er anderswo untergebracht, und alle legen sich recht früh zur Ruhe, denn am nächsten Morgen fünf Uhr müssen sie wieder von Hamburg fortfahren.
*
Lottchen ist nun schon mehrere Wochen in der Schule. Ihre Gespielinnen haben sie alle sehr lieb, denn sie ist immer freundlich und gefällig, und ihr Lehrer ist auch mit ihr zufrieden, weil sie aufmerksam zuhört, fleißig arbeitet und daher auch gute Fortschritte macht. Zum Zeichen seiner Zufriedenheit schenkt der Lehrer ihr einmal ein hübsches Bild, was sie voll Freuden mit nach Hause bringt und den Geschwistern zeigt. Es ist darauf ein großes Wasser dargestellt, worin viel Schilf wächst. Auf der einen Seite stehen viele schön geputzte Frauen, auf der andern sieht ein Mädchen hinter einem Baume aufmerksam nach dem Wasser hin. Mitten im Schilf schwimmt ein Binsenkorb, und da drin liegt ein kleiner Knabe in Windeln gehüllt und macht ein Gesicht, als wolle er weinen.
Das ist eine Freude für alle Kinder! Karl meint, er möchte wohl auch einmal so in einem Körbchen auf dem Wasser schwimmen, und Marie will gern wissen, warum das Mädchen wohl so hinter dem Baume stehe und immer ins Wasser gucke. Lottchen verspricht ihnen alles zu erzählen, wenn der Mittag vorüber sei. Kaum ist abgedeckt, so fragen die Kinder auch: »Erzählst Du nun?« – Da befestigt Lottchen das Bild mit vier Nadeln an die Tapete, holt Mariechens Strickstrumpf und ihren eignen und erzählt dann: »Es giebt ein Volk in der Welt, das heißt die Ebräer. Das hat der liebe Gott sehr lieb. Es wohnte vor langer, langer Zeit einmal in Egypten. Der König dieses Landes mochte aber das fremde Volk nicht leiden und wollte es darum vertilgen. Er wollte auch gar nicht glauben, daß es einen lieben Gott gebe, der ihn für seine bösen Thaten strafen werde. Nun denkt einmal, was der böse König that! Er wollte alle kleinen Knaben tot machen lassen. Da waren alle Leute sehr traurig und weinten über die vielen Kinder, die sterben mußten. Es war nun aber eine Frau, die hatte einen kleinen Sohn und wollte so gern, daß er lebendig bliebe. Darum machte sie von Schilf und Binsen einen Korb, beschmierte ihn mit Pech, damit kein Wasser durch könne, setzte ihn aufs Meer mitten in das Schilf und bat den lieben Gott, daß er das Kindlein schützen möge gegen die bösen Egypter. Seht Ihr das kleine Kind hier in dem Körbchen im Schilf? Das Mädchen hier unter dem Baume das ist seine Schwester, die steht da und paßt auf, was aus dem kleinen Knaben werde.« »Na? und da?« fragt Karl, »kommen da die geputzten Damen und finden ihn?« »Ja, denk' nur,« fährt Lottchen fort, »die schönste, das ist die Tochter vom König Pharao, das ist eine Prinzessin; die andern sind ihre Freundinnen oder ihre Dienerinnen. Die Königstochter hat sich gerade baden wollen; als sie aber das Körbchen da schwimmen sieht, da schickt sie eine von den Mädchen hin, es aus dem Schilf zu holen. Als sie darauf gar den kleinen weinenden Knaben sieht, da vergißt sie Baden und alles andere, sieht ihn immer wieder an und sagt: Das ist gewiß einer von den ebräischen Knaben; aber er soll nicht sterben, er soll mir zugehören, soll mein kleiner Sohn sein, und er soll Moses heißen. Der kleine Moses kann aber nichts essen, weil er noch keine Zähne hat, er muß noch aus der Brust trinken, darum fragt die Königstochter, ob da nirgends eine Frau sei, die dem Kinde die Brust geben wolle. Als Moses' Schwester, Mirjam, das hört, da kommt sie hinter dem Baume hervor und sagt: Ich kenne eine Frau, die das gern thut, soll ich sie holen? Ja, thu' das, mein Kind, antwortet die Prinzessin, ich will der Frau auch Geld dafür bezahlen. Mirjam läuft schnell hin und holt Moses' Mutter. Ach! die hat sich gefreut, als sie ihren kleinen Knaben wieder hatte. Da ist er sieben Jahr bei ihr geblieben, aber nachher hat er bei der Königstochter gewohnt.« – »Ach, ist die Geschichte schon aus?« fragt Marie, als Lottchen still schweigt. »Nein,« antwortet Lottchen, »noch lange nicht; mein Lehrer sagt, die sei niemals aus; ich weiß aber noch nicht mehr davon. Wenn ich erst mehr weiß, dann erzähle ich Euch wieder etwas davon.« Nun wird das Bild in die Schieblade gelegt. Lottchen und Marie stricken ihre Zahl fertig; denn beim Erzählen haben sie ein bißchen langsam gestrickt, und Karl lernt noch ein Verschen, das heißt:
Zwölf Monat sind im Jahr
Und wie viel Tage gar!
Da mußt du lange zählen,
Wenn keiner soll dran fehlen.
Nun merke, liebes Kind:
So viel der Tage sind,
So viel hat Gott auf dich gesehn,
Läßt seine Engel mit dir gehn,
Damit dir soll kein Leid geschehn.
Als sie damit fertig sind, werden alle Arbeiten an die Seite gelegt, und die Kinder wollen spielen. Da schallt es mit einem Mal auf der Straße: Träng! Träng! Taräng! Taräng! und alle laufen ans Fenster, um zu sehen, was es da gäbe.
*
Ei, was steht denn da vor der Hausthüre? Ein großer Wagen mit vier Pferden davor, und auf dem einen Pferde sitzt der Postillon mit rotem und gelbem Rock und bläst noch immer, was er nur blasen kann: Träng! Träng! Aus dem Wagenfenster guckt aber eine alte, freundliche Frau und ein alter und ein junger Herr, die nicken und rufen: »Gott grüß' Euch! Da sind wir!« Vater und Mutter und die Kinder sind schnell vom Fenster weg, die Treppen hinunter vor die Hausthüre gelaufen und rufen den lieben Leuten, die da im Wagen sitzen, ein fröhliches »Willkommen!« entgegen. Es ist des Vaters Bruder, Onkel Meiler mit seiner Frau und seinem ältesten Sohn, die im Wagen sitzen. Sie kommen aus Berlin, um ihre lieben Freunde zu besuchen. Adolf, der Sohn, soll bei Karls und Mariens Vater aufs Comptoir, damit er da lerne, was ein Kaufmann wissen muß, und wird mehrere Jahre da bleiben und mit ihnen zusammen wohnen. Das ist eine Freude! Nun wird ausgestiegen und begrüßt und ausgepackt alles, was im Wagen ist, an Koffern und Kisten und Kasten und Schachteln. Die ganze Stube oben wird voll von ihren Sachen. Nach und nach werden alle Sachen oben hinauf in zwei Zimmer gebracht, welche die Mutter schon für Meilers zurecht gemacht hat. Onkel und Tante und der neue Vetter, den die Kinder noch gar nicht kennen, erzählen viel von Berlin und von den kleinen Kindern, die zu Hause geblieben sind, und von dem guten König, der in Berlin wohnt, und noch vielerlei. Die Zeit vergeht dabei so schnell, daß die Kinder es gar nicht glauben können, es sei schon sieben Uhr, als Trina mit dem Abendbrot ins Zimmer tritt. –
Am andern Morgen, als der Vetter seinen Koffer auspackt, und die Kinder hören, daß er ganz bei ihnen bleiben wird, da werden sie doppelt froh, und nun gar, da er ihnen ein großes Bilderbuch schenkt, welches er für sie mitgebracht hat, und noch dazu verspricht, ihnen von den Bildern schöne Geschichten vorzulesen und zu erzählen, – da klatschen sie in die Hände und rufen: »Ach, Lottchen erzählt uns auch oft hübsche Geschichten, und Du nun auch, das ist wunderschön!«
Nach einigen Tagen reisen Onkel und Tante wieder weg, der Vetter aber bleibt da und arbeitet mit dem Vater. Nachmittags aber geht er zuweilen mit den Kindern spazieren oder spielt mit ihnen, und Karl und Marie und Lottchen und selbst die kleine Elisabeth haben den Vetter sehr lieb.
*
Nach und nach fallen nun auch die letzten Blätter von den Bäumen. Der Wind weht rauh, und in den Zimmern muß eingeheizt werden. Bald fällt auch Schnee und immer mehr Schnee vom Himmel. Die Sonne läßt sich selten sehen und bald liegt der Schnee so hoch, daß an kein Spazierengehen mehr zu denken ist. Selbst Vetter Adolf ist seit acht Tagen nicht spazieren gewesen, wie er sonst täglich zu thun pflegte. Eines Sonntags aber sieht es draußen wunderschön aus. Es ist der allerblaueste Himmel, und die Sonne scheint so goldig und so warm, daß man Mantel und Pelz abnehmen muß, obgleich es so stark friert, daß die Knaben auf den Gassen glitschen können. Adolf wird das Zimmer zu eng. »Tante,« sagt er, »ich mache einen Spaziergang ins Gehölz, ich muß doch einmal sehen, wie die bereiften Bäume im Sonnenlicht glänzen.« »Thu' das, Adolf,« sagt die Mutter »um drei Uhr essen wir erst zu Mittag, Du hast bis dahin lange Zeit.« Adolf geht. Aber die Uhr wird drei, wird vier, und kein Adolf läßt sich sehen. Karl und Marie fragen einmal über das andere: »Wo bleibt der Vetter?«, aber immer ist der Vetter noch nicht da. Endlich ein bißchen nach fünf ruft Lottchen: »Da kommt er, da kommt er!« Alle eilen an die Thür und sehen ihn gar eilig und schnell die Treppe heraufkommen. Nun steht er in der Stube. »Ei,« ruft er, »wie ist es mir ergangen! Ich habe gedacht, ich wisse hier in der Umgegend schon ganz gut Bescheid, und nun habe ich mich so verirrt, daß ich glaubte, ich hätte nimmer wieder mich nach Hause gefunden, wenn mir nicht Leute begegnet wären, die mich auf den rechten Weg brachten, nachdem ich schon über eine Stunde ratlos umhergewandert war. Ich mußte recht an mein Eichhörnchenabenteuer denken, was ich im vorigen Jahre auf Onkel Eduards Gute in Mecklenburg erlebte.« »Ach erzähle, erzähle!« bitten die Kinder. »Ja, ich will auch,« erwiderte Adolf, »aber erst muß ich mich umkleiden, ich bin gar zu naß und schmutzig geworden.« »Und hungrig doch auch?« fragt die Mutter; »mach' nur, daß Du fertig wirst! Das Mittagessen erwartet Dich.«
*
Sobald Adolf mit Umkleiden und Essen fertig ist, erzählt er: »Es war damals ein ganz ähnliches Wetter wie heut'. Ich ging um zwölf Uhr vom Hause und dachte: Ich will einmal so recht weit in den Winter hineinspazieren, und ging auf der Spur eines Wagens zum Dorfe hinaus, die Landstraße hinunter und gerade auf das Gehölz zu. Die großen Eichen und Buchen sahen herrlich aus und warfen mit ihren schneebeladenen Zweigen ordentlich Schatten auf die blendend weiße Schneedecke der Felder. Jedes Zweiglein hatte seine Last zu tragen. Wie still es war, könnt Ihr Euch kaum denken, man konnte beinahe den Schnee hören, der von den Zweigen herunterflatterte, wenn ihn ein Sonnenstrahl hinabgestoßen hatte. Ich ging auch ganz leise, als ob es unrecht wäre, die feierliche Stille zu brechen. Da sah ich rechts einen Fußpfad, der tief ins Gehölz hinein zu führen schien. Einige Fußtritte waren darauf zu sehen. Ich dachte: Den möchte ich einmal gehen! wohin er wohl führt? wenn nur der Schnee nicht zu tief ist! Genug, ich ging dem Fußsteig nach, der aber bald ganz aufhörte. Da sah ich mit einem Male ungefähr zwanzig Schritte vor mir ein kleines Eichhörnchen; das saß auf einem niedern Strauche und schälte mit seinen weißen Zähnchen blitzgeschwind einen langen Zweig ganz ab, und steckte die dann abgeschälte Rinde unters Kinn, um sie damit festzuhalten. Es hatte sich so schon eine ganze Menge Stroh und dünne Zweiglein gesammelt und trug sie alle zwischen Kinn und Brust, um sich daraus sein Nest zu bessern. Ich wollte gern sehen, wie es dies machte, und meinte, das Nest möchte wohl nicht fern sein, drum ging ich auf das Tierchen zu. Schnell sprang es nach einem großen Baume. Als ich dahin kam und meinte, daß es wohl auf dem Baume wohne, sprang es nach einem zweiten und so immer weiter, und neckte und lockte mich immer tiefer hinein in den Wald. Ich hatte schon lange Weg und Steg verloren. Da fiel ich plötzlich bis über die Ohren in eine tiefe Schneegrube, und als ich mich da herausgearbeitet hatte, war das kleine Eichhörnchen verschwunden. Nun wollte ich wieder an die Rückkehr denken, aber ich war so kreuz und quer dem Tierchen nachgelaufen und hatte in meinem Eifer ganz und gar nichts anderes gedacht, und meine Zeit war so kurz, daß ich dachte: Ich will jetzt nur lieber gradeaus laufen, so komme ich am ersten wieder auf den Weg. Aber, o weh, ich hatte den verkehrten Weg eingeschlagen. Immer tiefer kam ich in den Wald, stolperte einmal übers andere in Schneelöcher hinein und über Baumwurzeln. Dabei stand mir, weil ich lief, der Schweiß vor der Stirn, denn ich wollte gern zu gewisser Zeit zu Hause sein, weil ich zu Mittag essen sollte und auch hungrig war. Aber es wollte sich kein Weg zeigen. Ich merkte wohl, daß ich auf dem verkehrten Wege war, allein den rechten wußte ich damit noch nicht, und wohin sollte ich mich wenden? Ich dachte also: Geh' du nur immer gradeaus; am Ende muß der Wald doch ein Ende nehmen. Wenn nur die Sonne nicht vorher untergeht! Ich sah noch mehrere Eichhörnchen vor mir auf den Zweigen herumspringen, aber ich kümmerte mich gar nicht mehr um sie, und es kam mir überdies vor, als lachten sie mich aus, daß ich großer, kluger Mensch den Weg nicht wisse und so ratlos umherirre, während sie so gut Bescheid wußten. Endlich, endlich wurde es heller zwischen den Bäumen. Das Gehölz hatte ein Ende; ich stand am Rande. Aber damit war ich noch nicht zu Hause. Vor mir lag nun ein großes weißes Schneefeld; da mußte ich nun durch, so müde meine Beine auch schon waren vom weiten Marschieren. Es ging indes besser, als ich dachte. Der Schnee war gar nicht so tief. In einer Viertelstunde war ich am Dorfe und zehn Minuten später in Onkels Hause.« »Nun!« sagt die Mutter, »das hätte Dir eine Lehre sein müssen, daß Du ein ander Mal auf gebahntem Wege bleibst und Dich nicht von Eichkätzchen oder sonst was auf Nebenwege locken läßt! Das ist immer etwas gefährlich.« »Ach, Tante,« sagte Adolf, »foppe mich nur nicht noch hinterdrein, ich habe damals genug Mühe und Angst gehabt.« »Ja,« sagt Karl, »und wenn nun am Ende gar ein Löwe gekommen wäre, was hättest Du dann gemacht?« Die anderen lachen, und Adolf belehrt den Kleinen, daß man hier nicht nötig habe, sich vor Löwen zu fürchten. »Aber,« setzt er hinzu, »wenn ich hätte die Nacht im Gehölze bleiben müssen, da wäre ich doch vielleicht vor Kälte und Nässe gestorben oder wenigstens krank geworden; denn als die Sonne schlafen gegangen war, da war es recht rauh und unfreundlich draußen.«
*
Die Kinder müssen nun alle Tage im Zimmer bleiben, aber sie sind doch sehr fröhlich und haben einander gar viel zu erzählen. Abends, wenn die kleine Elisabeth zu Bette ist, dann erzählt ihnen die Mutter immer etwas von der Weihnachtsgeschichte, und sie lernen und singen viel Weihnachslieder. Jeden Abend kommt ein neues Bild an die Tapete, und die Kinder wissen es schon, wenn alle vierundzwanzig Bilder an der Tapete hängen, dann ist Weihnachten da. Da sehen sie auf den Bildern das Christkindlein, wie es ganz klein ist und in der Krippe liegt, und den Engel Gabriel, den der liebe Gott zu der Jungfrau Maria schickt, um ihr zu sagen, daß sie einen Sohn haben solle – und Joseph und Maria – und Zacharias und Elisabeth – und die Stadt Bethlehem – und die große Königsstadt Jerusalem – und die Weisen, die aus dem Morgenlande kommen, das Kindlein anzubeten und die frommen Hirten – und wie Joseph und Maria mit dem heiligen Kinde nach Egypten flüchten, und noch viel, viel mehr schöne Dinge sehen sie auf den Bildern. Morgens stricken Charlotte und Marie viel fleißiger als sonst, denn die großen Strümpfe, daran sie stricken, sollen noch fertig werden bis Weihnachten; die soll der liebe Papa geschenkt bekommen. Karl lernt ein Lied aus dem Fabelbuch, ein ganz langes. Jeden Tag lernt er vier Reihen, damit er zur rechten Zeit damit fertig werde. Auch Vetter Adolf sitzt oftmals des Abends, wenn der Papa noch schreibt, auf seinem Zimmer und zeichnet an einem großen Bilde, was er Mariens Eltern zu Weihnachten schenken will. Aber mehr als alle hat die liebe Mama zu thun, die näht und packt und kramt und geht aus und wenn sie wieder nach Hause kommt, dürfen die Kinder niemals sehen, was sie gekauft hat. An den letzten drei Abenden vor Weihnachten ist aber die noch größte Freude; da werden alle Spielsachen zusammengeholt und nachgesehen, was davon an die Armen verschenkt werden soll. Marie bringt ihre Puppe, Karl viele Soldaten, Elisabeth eine kleine Küche, Lottchen ein Nähkästchen. Außerdem finden sich noch Kegel, kleine Reiter, vielerlei Bilder und mancherlei kleine Spielereien, mit denen Kinder erfreut werden können. Manches ist schadhaft, das wird noch ausgebessert: genäht, geklebt, genagelt, gemalt, wie es gerade not thut. Man bringt noch möglichst viele alte Kleidungsstücke dazu. Als nun alles beieinander ist, da finden sich genug Sachen, um sechs arme Kinder zu beschenken. Am Abend vor Weihnachten wird alles in einer kleinen Stube neben dem großen Saale aufgeziert. Die Sparbüchsen der Kleinen müssen auch noch manchen Schilling hergeben; dafür werden Rüben, Wurzeln, Reis und Pflaumen gekauft, und Vetter Adolf schenkt noch einen großen Thaler, um für jedes Kind zwei Pfund Fleisch zu kaufen, was sie am Weihnachtstage mit ihren Eltern und Geschwistern verzehren sollen. Da werden denn die Tische der Armen ganz voll guter Dinge, und Karl meint: »Ich möchte wohl ein armes Kind sein, wenn ich so schöne Sachen zu Weihnachten haben soll!« – Zuletzt werden noch viele Netze und Ketten und Blumen geschnitten von ganz dünnem farbigem oder auch von stärkerem Gold- und Silberpapier. Nüsse, Eier, Äpfel und Kartoffeln werden mit Gold oder Silberschaum überklebt; und die Kleider und Finger und Gesichter der Kinder haben alle ein bißchen abbekommen von dem glänzenden Schmuck, und Mariechen bittet: »Wasch' es nicht ab, Mama, wasch' es nicht ab, das sind lauter kleine Weihnachtssterne!«
*
Am 24. Dezember früh sechs Uhr kann kein Kind mehr schlafen. Erst flüstern Karl und Marie ein Weilchen miteinander. Als es aber im Nebenzimmer noch immer ruhig bleibt, obgleich Lisbethchen schon erzählt: »Dede und dada und Papa und Mama und Lili,« da steigen beide aus den Betten, ziehen ihre Pantoffeln an, laufen zu Papa und Mama in die Schlafstube und rufen: »Weihnachten ist da!« Papa meint: sie irren sich, und Mama will es auch gar nicht glauben; aber es hilft nichts; Karl und Marie lassen ihnen keine Ruhe mehr, sie haben so viel zu erzählen und zu erinnern und zu bitten, daß die Eltern nur schnell aufstehen, sich ankleiden und die Kinder treiben, sich auch fertig zu machen, damit um sieben Uhr alle zur Morgenandacht versammelt seien. »Aber, Papa, heute betest Du doch was von Weihnachten, nicht wahr?« fragt Karl. »Ja gewiß,« antwortet der Vater, »und wir singen dann alle ein Weihnachtslied dazu. Denkt nur nach, welches das schönste ist.« Die Kinder gehen, kleiden sich an und beraten sich dabei. »O du selige?« Nein das geht nicht, das muß am Abend gesungen werden. »Alle Jahre wieder kommt das Christuskind« – das ist gar zu kurz. »Wenn ich in Bethlehem wär', du Christuskind« – dabei müssen die Bilder sein, und die hat Mama schon alle in die Weihnachtsstube getragen.
Ach und nun will Trina den Karl waschen: nun kann er gar nicht sprechen. Und nun müssen sich die Kinder so sehr freuen, nun können sie gar nicht denken. – Ach, und nun klingelt der Papa schon, weil es sieben Uhr ist. Die Kinder laufen mit Lottchen hinunter und singen auf der Treppe, ohne es zu wissen und zu wollen: »Mir ist so froh, ich weiß nicht wie, möcht' immer jubeln und singen!« – »Das habt Ihr gut ausgewählt,« sagt Papa. Mama setzt sich ans Klavier und alle singen:
Mir ist so froh, ich weiß nicht wie,
Möcht' immer jubeln und singen,
Und wie eine süße Melodie
Hör' ich's im Herzen klingen.
Es flimmert mir vor den Augen klar,
Als schwirrten die Sterne hernieder,
Mir ist, als hört' ich der Engel Schar,
Der frommen Hirten Lieder.
O lieber, treuer Heiland mein,
Du hast mir den Jubel gegeben,
Weil Du geworden ein Kindlein klein
Im armen Erdenleben.
Du hast ja in diese Winternacht,
In dieses Stürmen und Toben,
So reichen Frühling hineingebracht
Vom lichten Himmel droben.
Du hast so leuchtende Freude heut'
Gestreut in unser Leben,
Mit vollen Händen weit und breit
Deine holden Gaben gegeben.
Und wo Du, lieber Heiland, bist,
Muß Licht und Freude blühen,
Und wo Deine treue Liebe ist,
Muß Weinen und Klagen fliehen.
Drum klopft mein Herz mir in der Brust,
Daß Du ein Kind geworden,
Und hast mit ewiger Liebeslust
Geschmückt den Kinderorden!
Darauf liest der Vater die Weihnachtsgeschichte aus dem zweiten Kapitel des Evangelisten Lucas, und alle danken zum Schluß dem lieben Heiland, daß er auf Erden gekommen ist, um uns selig zu machen.
Aber nun müssen die Kinder wieder hinauf und den ganzen Tag oben bei Trina bleiben. Unten wird geschurrt und geschoben und geklappert und geknittert, das klingt gar wunderlich. Um drei Uhr wird in der Kinderstube zu Mittag gegessen. Papa und Mama und die Kinder sehen so freundlich aus, sind gewiß recht gesund, aber keines ist recht hungrig, und wie Karl betet: »Komm, Herr Jesus, sei unser Gast!«, da meint er: »Das Christkind kommt eigentlich erst heute abend, wenn alle Lichter brennen, daher können wir auch gar nicht recht essen.« Elisabeth, die sonst bis vier Uhr schläft, hat heute schon um drei Uhr fertig geschlafen und sitzt ordentlich mit zu Tische. Als sie abgegessen haben, gehen die Eltern hinunter, und die Kinder waschen sich Hände und Gesicht, binden reine weiße Überzüge vor und – – warten.
*
Die Kinder singen viel Lieder, Trina erzählt mancherlei, und so vergeht die Zeit. Da geht die Thür. Alle Kinder springen auf; aber der Vater ist's noch nicht, wenigstens nicht der Vater, auf den die Kinder warten; es ist der alte Martin und Mutter Anna mit dem kleinen Peter. Dieser ist einer von den sechs Gästen, die sich die Kinder eingeladen haben. – Wieder geht die Thür. Noch nicht der Vater! Gesa ist es, die Tochter der Scheuerfrau, mit ihren beiden Brüdern, Hans und Adolf. Alle lauschen – dann geht was auf der Treppe! Ob es wohl der Vater ist? Nein, noch nicht, es sind die letzten beiden kleinen Gäste: Mathilde und Jette. Da schlägt es fünf Uhr! Und nun – – und nun – – unten geht die Thür, es kommt die Treppe herauf – – die Stubenthüre wird aufgemacht und – – »Kommt, das Christkind ist da!« ruft der Vater. Alle eilen hinunter. Die Thüre ist noch zu, aber durch die Ritzen und durchs Schlüsselloch da glitzert und strahlt es, daß man sich gar nicht denken kann, wie wunderhell!
Nun ordnet der Vater sie nach der Größe; die kleinsten der Kinder voran, die größern dahinter und zuletzt Martha, Trina, Martin und Anna. In der Stube spielt Mama: »O du selige, o du fröhliche, freudenbringende Weihnachtszeit! Welt ging verloren, Christ ward geboren, freue dich, o Christenheit!« Alle stimmen schon draußen vor der Thür das schöne Weihnachtslied an, und während sie singen, macht der Vater langsam die Thüre auf, daß sie hineinsehen und hineingehen können. Ach wie schön, wie schön ist's drin! Das ganze Zimmer ist von oben bis unten mit Tannenzweigen geschmückt, daß es aussieht, wie ein Platz mitten im Walde. Geradeaus, auf einem niedrigen Tischchen, steht eine allerliebste Hütte von Binsen und Schilf und Moos gemacht und mit Tannenzweigen besteckt. In der Mitte der Hütte steht eine Krippe; darin liegt das liebe Jesuskindlein und sieht gar hold und freundlich aus. Bei der Krippe kniet die Jungfrau Maria, Jesu Mutter, und hat die Hände gefaltet, als bete sie; bei ihr steht Joseph, der Zimmermann, und betet auch. Auf der andern Seite der Krippe knien zwei Hirten, und ein dritter steht hinter den beiden, und alle schauen auf das heilige Kindlein und sehen dabei sehr fromm und selig aus. Vor der Krippe stehen Körbchen mit Blumen und Früchten, und ein paar Lämmchen liegen dabei. Das alles haben die Hirten für das Christkindlein zum Geschenk mitgebracht. Sonst sieht es aber in der Hütte gerade so aus, wie in einem Stall. Da liegt Heu und Stroh umher; an der Wand hängen Nester mit brütenden Hühnern, es stehen und liegen da allerlei Gerätschaften, und aus einer zweiten Krippe, die weiter nach hinten steht, fressen zwei Kühe und ein Esel. Aber rund um die Hütte her da sieht es gar nicht aus, wie sonst um einen Stall. Am Eingange stehen zwei himmlische Engel mit lichten Flügeln, die schauen mit gefalteten Händen hin auf das heilige Kind. Und hoch über ihnen da strahlt ein Stern herab auf das Hüttlein, so groß und so leuchtend, daß man wohl sieht, er habe was Besonderes zu bedeuten. Die Tannenzweige, die das Zimmer schmücken, sind aber auch nicht kahl und dunkel. Darin hängen alle die bekannten Weihnachtsbilder, und eine zahllose Menge von goldenen Netzen und Ringelketten und Ringelstreifen und leuchtenden Glaskugeln und bunten Blumen. Alles ist so blendend hell, daß die Kinder es beinahe nicht in den Augen aushalten können, und doch sehen sie kein einziges Licht; sie können gar nicht begreifen, wo die Helligkeit eigentlich herkommt.
Wohl eine Stunde lang stehen alle vor der Hütte und können sich nicht satt sehen an dem lieblichen Bilde. Immer findet der eine dies, der andere das, was er bisher noch nicht gesehen hatte und nun den andern voll Freuden zeigt. Dazu spielt die liebe Mama alle Weihnachtslieder, eins nach dem andern. Nun verstehen die Kinder erst recht, was sie gelernt haben, und singen mit einer Lust, wie nie zuvor.
*
Nun werden die sechs kleinen Gäste zu ihren Geschenken geführt, und ihnen wird gezeigt und erklärt alles, was die Kinder für sie bereitet haben. Die Freude dabei ist so groß, daß die Kinder die Geschenke, die sie selbst noch erwarten, ganz vergessen und es auch nicht merken, daß Papa sich fortgeschlichen hat. Mit einem Male fängt es im großen Saale an zu klingeln und zu trommeln. Die Thüren werden aufgestoßen, und drinnen strahlt es noch heller, als im kleinen Zimmer. Da steht ein großer Tannenbaum, wohl mit fünfzig brennenden Wachslichtern und ganz behängt mit goldenen und silbernen Äpfeln, Nüssen, Mandeln, Eiern und mancherlei Zuckerwerk. Rechts und links steht ein Tischchen bei dem andern, und alle sind mit Geschenken bedeckt. Für Vetter Adolf liegt da eine Schreibmappe, ein Tintenfaß, ein Spazierstock, ein Fernglas und einige hübsche Bilder; für Lottchen: ein Nähkasten, ein Strickkörbchen, ein hübsches Lesebuch mit vielen Bildern und mehrere Kleidungsstücke; für Marie: eine Wiege mit einer Puppe darin, die ebenso gekleidet und eingewickelt ist, wie die Schwester Elisabeth am vorigen Weihnachtsabend. Neben der Wiege steht ein kleiner Warmkorb und darauf liegt ein vollständiger Nachtanzug für die Puppe. Dabei steht auch ein kleiner Stuhl, auf dem Marie sitzen soll, wenn sie das Püppchen an- und ausziehen oder wiegen will. Mehrere Zinnsachen und verschiedenes Steinzeug für ihre kleine Küche sind auch noch auf dem Tische, ein Bilderbuch mit schönen Geschichten und noch manche Dinge zum Spielen und zum Anziehen. Karl bekommt einen bunten Ball, einen großen Ochsen mit goldenen Hörnern, eine Schaufel und eine Harke, eine Trommel und einen Soldatenhut, einige Schachteln mit Bleisoldaten und eine Rechnentafel mit goldenen und silbernen Griffeln dabei. Für Lisbethchen ist da ein kleiner Korbwagen, eine Puppe, ein Kuckuck, ein Sägemann und ein kleines Theezeug von weißem Holze. Martha und Trina bekommen jede Zeug zum Kleide, ein buntes Mützenband, ein Buch, etwas Geld, um sich kaufen zu können, was sie sonst noch nötig haben, und eine Menge Äpfel, Nüsse und Kuchen. – Die Kinder stehen erst ein Weilchen und staunen den glänzenden Baum an. »Seht!« sagt der Vater, »eh' das Christkind auf Erden gekommen war, da hatte man kein Weihnachten und noch weniger einen Weihnachtsbaum. Da kannte man wohl einen Baum, der den Menschen viel Leid gebracht hatte, aber keinen, über den man sich freuen konnte. Kennt Ihr wohl den Baum der die Menschen so unglücklich und traurig gemacht hat?« – »Du meinst wohl den Baum im Paradiese?« fragt Lottchen. »Ja wohl, den meine ich,« antwortet der Vater. »Als Adam und Eva von dem Baume gegessen hatten, von dem sie nicht essen sollten, da jagte Gott sie aus dem schönen Paradiese, und sie kamen in viel Leid und Trübsal. Da waren Adam und Eva traurig über den Baum, und alle Menschen, die nach ihnen lebten, auch. Als aber Gott sich ihrer erbarmte und ihnen seinen Sohn schickte, damit der die Menschen wieder ins Paradies zurückbringe, da wurden alle Traurigen getröstet. Um jedoch nie zu vergessen, wie unglücklich sie durch ihren Ungehorsam geworden, stellten sie alle Jahre einen Baum auf ihren Weihnachtstisch; um aber auch immer daran zu denken, wie liebevoll und gnädig Gott sich uns zeigt, indem er uns seinen eingebornen Sohn schenkt, schmückt man den Baum mit glänzenden Sachen und strahlenden Lichtern. Und so wie wir mehr von dem Glanz, als von dem Baum sehen, so ist auch die Gnade Gottes größer, als alle Sünde, wenn wir's nur glauben und annehmen wollen.« So spricht der Vater. Dann führt er jedes Kind an sein Tischchen, und Jubel und Freude und Zeigen und Erzählen und Danken will gar kein Ende nehmen. Jeder meint, er habe doch die schönsten Sachen erhalten und viel mehr, als er erwartet. Trina nimmt darauf ihre alten Eltern mit nach oben in die Kinderstube. Da hat sie auch einen kleinen Baum für sie aufgeziert und mancherlei gekaufte und gearbeitete Sachen herumgelegt. Die gute Mama hat noch zehn große Tüten dazu gethan mit Reis und Grütze und Mehl und wer weiß, was alles für schöne Eßwaren.
Nachdem die Kinder noch ein paar Stunden gespielt und sich gefreut haben, ruft Mama sie zum Abendbrot. Das war auch sehr niedlich. Im Bethlehemsstübchen war ein kleiner Tisch gedeckt für neun Persönchen. Lottchen soll schon mit den großen Leuten um zehn Uhr Karpfen und Kartoffeln essen; die Kinder bekommen aber um acht Uhr gebratene Küken, Spinat, Kartoffeln und gekochte Früchte, und zum Nachtisch goldene Äpfel und Nüsse und Zuckerwerk vom Weihnachtsbaum. O, das ist eine Freude! So etwas Schönes haben die sechs armen Kinder noch niemals gegessen; es schmeckt ihnen wunderschön. So sehr ihnen das aber auch alles gefällt, lieber als beim Abendbrot und lieber als bei den Geschenken sind sie doch bei der Bethlehemshütte, und Papa muß immer für neue Lichter sorgen, damit sie hell erleuchtet bleibe, so lange die Kinder noch wach sind.
*
Als das neue Jahr herankommt, wird viel davon gesprochen, daß Karl und Marie nun auch zur Schule gehen sollen, um in den Morgenstunden zu lernen: Marie ist bald sieben, Karl aber über fünf Jahre alt. Mama hat im Hause viel zu thun; so ist es denn am besten, daß die beiden Kinder bei der freundlichen Tante lernen, die alle Morgen eine Menge kleiner Knaben und Mädchen bei sich hat. Am vierten Januar werden sie also zum ersten Male hingebracht. Der liebe Papa thut das selbst und ermahnt die Kinder, daß sie ja recht folgsam und freundlich sein sollen. Das versprechen sie auch; aber es ist ihnen doch erst ein bißchen bange ums Herz, als Papa weggeht, und sie nun zwischen den vielen fremden Kindern stehen. Den zweiten und dritten Tag werden sie aber schon bekannter, und am vierten können sie sogar im Hause erzählen, wie die Schulweise ist, und womit sie sich beschäftigen. Wenn morgens neun Uhr die kleinen Schulkinder alle versammelt sind, dann stellen sie sich nämlich erst an den Tisch, falten die Hände und hören andächtig zu, wie die Lehrerin für sie betet, und dann singen sie mit ihr ein Lied. Zuweilen singen sie:
Wir bitten Dich, du lieber Gott,
Schenk' heut' uns Deinen Segen,
Behüt' uns vor Gefahr und Not
Auf allen unsern Wegen.
Hilf Du uns fromm und fleißig sein
Und jede Unart ernstlich scheu'n,
Hilf uns, Du lieber Vater!
Zuweilen auch:
Gieb uns an diesem neuen Tag,
Du lieber Jesus Christ,
Ein Herz, das Dich erkennen mag,
Wie Du so heilig bist.
Du sitz'st im Himmel auf dem Thron,
Allein Du bist auch hier,
Erleuchte unsre Augen schon,
Daß wir Dich merken hier!
Dein guter Geist, der warne uns,
Daß wir nicht Sünde thun,
O Herr, erbarm' Dich über uns,
Dein Licht laß in uns ruh'n!
Nach dem Gebet setzen alle Kinder sich auf ihre Plätze und nehmen ihre Tafeln. Darauf werden Zahlen geschrieben; wer aber nicht sauber und richtig schreibt, dem werden die Zahlen wieder ausgewischt. Nachher schreiben sie Buchstaben in ihre Schreibbücher, und wer es kann, der schreibt kleine Geschichten aus dem ersten Lesebuche ab. Wer nun mit seiner Arbeit früher fertig ist, als die andern, der darf auf seine Tafel zeichnen, was er will: ein Haus oder eine Mühle oder einen Blumentopf oder Kreuze oder Nullen. Wenn er es lieber mag, so kann er auch das große Bilderbuch besehen oder Perlen aufziehen, oder wenn er ganz leise ist, von Bauhölzern Etwas aufbauen. Nur herumlaufen dürfen die Kinder nicht, und das thut dem wilden Karl immer sehr leid. In der dritten Stunde erzählt ihnen die Lehrerin schöne Geschichten aus der Bibel: von dem frommen Abraham und Isaak und Joseph, vom Riesen Goliath, vom Propheten Elias und vor allem von Gottes Sohn, dem heiligen Jesuskinde, wie er von den Engeln verkündigt und im Stalle geboren, nachher umhergegangen ist und wohlgethan hat und am Ende von den Menschen ans Kreuz geheftet und für sie gestorben, aber auch vom Vater wieder erweckt und gen Himmel gefahren ist. Dabei zeigt sie ihnen schöne Bilder und lehrt sie eine Menge kleiner Verse, von denen sie auch manche singen, z. B.:
Immer muß ich wieder lesen
In dem alten heil'gen Buch,
Wie Er ist so sanft gewesen,
Ohne List und ohne Trug.
Wie Er hieß die Kindlein kommen,
Wie Er hold sie angeblickt
Und sie auf den Arm genommen
Und sie an sein Herz gedrückt.
Wie Er Hülfe und Erbarmen
Allen Kranken gern erwies
Und die Blöden und die Armen
Seine lieben Brüder hieß.
Wie Er keinem Sünder wehrte,
Der bekümmert zu ihm kam,
Wie Er freundlich ihn bekehrte,
Ihm den Tod vom Herzen nahm.
Immer muß ich wieder lesen,
Les' und weine mich nicht satt;
Wie Er ist so treu gewesen,
Wie Er uns geliebet hat.
Hat die Herde sanft geleitet,
Die sein Vater ihm verlieh'n,
Hat die Arme ausgebreitet,
Alle an sein Herz zu zieh'n.
Laß mich knien zu Deinen Füßen,
Herr, die Liebe bricht mein Herz,
Laß in Thränen mich zerfließen,
Selig sein in Wonn' und Schmerz!
Kinder, laßt zur Schul' uns gehen!
Von dem Turme schlägt es schon.
Laßt uns nicht mehr müßig stehen!
Strafe ist der Faulheit Lohn.
Denn zur Arbeit hat gegeben
Gott die Hände uns und Leben,
Darum laßt uns fleißig sein!
Trägheit wird uns später reu'n.
Sind auch klein noch unsre Hände,
Darum dürfen sie nicht ruh'n.
Schnell geht uns der Tag zu Ende,
Wenn wir etwas Gutes thun.
Schreiben, zeichnen, sticken, nähen
Kann durch unsre Hand geschehen,
Und vor allem zählen wir
An den kleinen Fingern hier.
Beide Hände in die Höhe,
Zählen wir von eins bis zwei,
Und an jedem einzeln sehe
Ich zwei Finger und noch drei,
Und zusammen machen's zehen.
Laß ich zwei dann wieder gehen,
Bleiben mir noch zweimal vier;
Und so weiter zählen wir.
So kann unsre Hand vollbringen
Manche Kunst und manches Spiel,
Und Gott wünscht vor allen Dingen,
Daß man gut sie brauchen will,
Darum laßt uns träg' nicht stehen
Oder auf den Gassen gehen!
Oft schon war wohl angewandt
Thät'ge Hülfe kleiner Hand.
Anfangs gehen beide Kinder gar gern zur Schule, aber nach einiger Zeit meint Karl, es sei doch besser, im Hause zu lernen und dann herumzulaufen und Pferd zu spielen, als jeden Tag drei ganze Stunden zu lesen, zu buchstabieren, zu lernen, zu rechnen, zu schreiben oder doch stille zuzuhören. Das hilft nun freilich nichts; Karl muß alle Morgen zur Schule, wenn er auch einmal ein trauriges Gesicht macht. »Wer nicht arbeitet, darf auch nicht essen,« sagt die Mutter, »sieh', da hätte ich kein Frühstück, kein Mittag-, kein Abendbrot für Dich; geh' Du lieber freundlich zur Schule und lerne fleißig, da sollst Du einmal sehen, wie froh Du nachher sein wirst.« Dann geht Karl freilich mit ziemlich freundlichem Gesichte hin; aber so froh wie Marie ist er nie. Mit der ist es ganz anders: die kann des Morgens die Zeit kaum abwarten, bis es so weit ist, daß sie zur Schule gehen kann, und weil sie so fröhlich ist, wird ihr das Lernen ganz leicht. Vater und Mutter freuen sich über die schnellen Fortschritte, die ihr Töchterchen macht.
*
In der Schule ist Marie immer fleißig und freundlich, und alle haben sie sehr lieb. Zuweilen besuchen sie auch einige ihrer Schulkameraden und spielen mit ihr. Eines Sonntags kommt sogar ein kleines Mädchen, die am andern Ende der Stadt wohnt, mit ihrem Bruder in einem kleinen Wagen angefahren. Alle Kinder können sich nicht genug an dem kleinen Fuhrwerk freuen. Es ist auch gar zu niedlich! Ein ordentlicher kleiner Stuhlwagen, grün angemalt, mit weichen Polstern auf den Stühlen, und ein lebendiger Esel mit langen Ohren ist davorgespannt, der zieht den Wagen so ruhig und so nett, daß der Bruder von Mariens Freundin, der freilich auch schon zehn Jahr alt ist, ihn ganz gut regieren kann. Karl ist ganz außer sich, er vergißt Essen und Trinken und Spielen und ist immer im Waschschauer und besieht und bewundert den Wagen und das Geschirr und die Peitsche und den Esel. Ach ja, der lebendige Esel, das ist doch das Schönste von allem. »Mein lieber, süßer Papa,« bittet Karl am andern Morgen, »ach bitte, bitte, schenke mir doch einen Esel zu meinem Geburtstag!« »Dir einen Esel?« fragt der Vater. »Ei, Junge, Du bist ja selbst ein kleiner Esel, bist wohl gar noch fauler, als der vierbeinige, magst nicht zur Schule gehen, magst nicht arbeiten; was willst Du mit einem Esel?« – »Ach, Papa, ich will auch gewiß ganz fleißig werden und immer ganz vergnügt zur Schule gehen, schenke mir nur einen Esel, daß ich auch reiten und fahren kann; dann fahre ich zur Schule, wenn es schmutzig ist, und Schwester Marie und Lottchen nehme ich auch mit. Ach bitte, bitte, mein süßer Papa!« So bittet Karl und küßt seinen Papa ein über das andere Mal. »Nur ruhig, nur ruhig,« sagt der Papa. »Fürs Erste bist Du noch viel zu klein, fürs Zweite bist Du noch viel zu faul. Wenn Du erst so groß bist, daß Du mit der Nase an diesen Knopf stoßest und so fleißig, daß Du in zehn Wochen kein schlechtes Zeugnis mit nach Hause bringst, dann – dann wollen wir einmal weiter darüber sprechen. – Aber, was seh' ich? Du willst weinen? O weh, o weh, da bist Du wohl noch ein ganz kleines Kind, da wirst Du noch länger warten müssen!« Karl schluckt schnell die Thränen nieder, macht ein freundlich Gesicht und verspricht, artig zu sein. Von dem Tage an nimmt Karl sich zusammen, geht freundlich zur Schule, lernt fleißiger, und wenn er einmal wieder faul und unlustig bei der Arbeit sein will, da braucht man nur zu fragen: »Du willst doch nicht wieder ein kleiner Esel sein?« Da ist er schnell wieder fleißig und fröhlich.
*
Nach und nach wird es nun immer freundlicher draußen. Hier und da läßt sich wieder ein Vöglein hören, und es sieht aus, als wenn der liebe Gott auch seine Maler umherschicke in der weiten Welt, um alles wieder neu aufzuputzen. Die große weiße Schneedecke ist überall abgenommen. Auch die großen weißen Wolken verziehen sich, und man sieht wieder den lieben Himmel so blau, so blau, wie es gar keine Farbe im Malkasten giebt, und die Sonne sieht so hell und frisch ins Zimmer herein, wie lange nicht. Das kommt, sie kann sich nun wieder im Flusse waschen und spiegeln. Das mußte sie im Winter wohl bleiben lassen; da konnte man wohl auf dem Flusse spazieren gehen, aber sich nicht drin baden. Das Gehölz sieht in der Ferne aus, als habe es statt des weißen Wintermantels einen grünen Flor übergehangen. Auch die Wiesen werden von Tag zu Tag grüner. Ja, die Kinder finden sogar schon hin und wieder ein Blümchen unter den Grashalmen versteckt. Der März geht zu Ende, und der April ist vor der Thür mit seinen vielen Blüten und dem schönen Osterfest. Karl und Marie sprechen viel vom vorigen Sommer, von ihrem kleinen Gärtchen, von der großen Wiese hinter dem Hause, von der Kuh, von den mancherlei Spaziergängen und Fahrten, die sie gemacht, und freuen sich unbeschreiblich, als endlich der Tag da ist, wo alle Sachen wieder auf den Wagen geladen und hinaus gebracht werden ins Landhaus. Die ganze Familie geht und fährt hinterdrein, beladen mit den Sachen, die sie lieber selbst tragen, als hinaus schicken wollen: Lottchen mit ihrem Malkasten, damit er beim Verpacken keine Schramme bekomme, Marie mit ihrer großen Puppe im Arme und Karl mit Harke und Schaufel auf dem Rücken, um gleich mit der Gartenarbeit beginnen zu können, wenn er draußen ankommt.
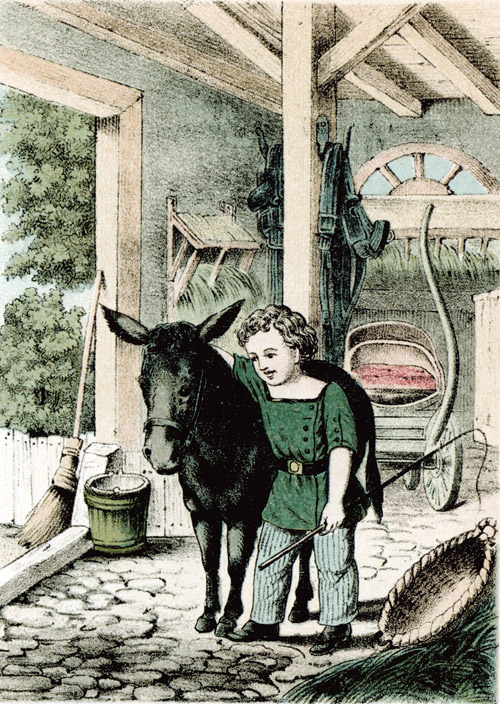
*
Ei wie schön schläft sich's draußen im Landhause! Um sechs Uhr sind schon die Kinder fertig angezogen und eilen in den Garten, um alle alten, liebgewordenen Plätze wieder aufzusuchen, und freuen sich, daß alle Bäume und Sträuche noch auf derselben Stelle stehen. Links vom Hause steht noch die alte Weide mit dem dicken Epheu umwunden; weiter hinten die große Lindenlaube, in der sie oft gefrühstückt haben. Noch ist sie freilich nicht schattig und grün, die Blätterknospen sind erst im Aufspringen. Hinter dem Hause ragen die sechs großen Pappeln hervor, die der Wind hin und her wiegt. Rechts breitet die große knorrige Eiche ihre niedrigen Äste aus, darauf Papa die Kinder so manchesmal setzte, und sie dann piepten, als wenn sie Vögel wären. Mitten auf dem Grasplatze sind die beiden großen Birnbäume, die im vorigen Jahre über zweitausend Birnen getragen haben, und weiter unten im Garten der Teich mit den vielen Hängeweiden rund herum, die immer mit ihren langen feinen Zweigen im Wasser spielen. Alles noch, wie im vorigen Jahre. Da steht auch noch die kleine Bretterhütte, in welcher der Gärtner sein Gerät aufbewahrt, und wo die Kinder so oft mit ihren Spielsachen gesessen, und die sie ihr Wohnhaus genannt haben, und rund umher das dicke Gebüsch, das sie ihren Wald nannten, und an der andern Seite die vielen Johannisbeer- und Stachelbeerbüsche und der hohe Hügel, mit Erdbeeren rund umher bepflanzt, und oben drauf die runde Bank, von Heckenkirschen und Jasmin beschattet, in denen voriges Jahr zwei Vogelnester waren. Alles, alles finden die Kinder wieder und kommen von einer Freude in die andere, so daß selbst Lottchen und Marie ein ganz trübliches Gesicht machen, als der Vater ruft: »Geschwinde, geschwinde, Kinder, es ist Zeit zur Schule!« Karl fängt sogar bitterlich an zu weinen. Da nehmen die beiden Mädchen sich aber zusammen, machen schnell ein freundliches Gesicht, sprechen mit dem Kleinen und erzählen ihm von allem, was sie nachmittags im Garten arbeiten und spielen wollen, und so gehen sie dann fröhlich zur Schule und lernen fleißig.
*
Um ein Uhr kommen die Kinder wieder nach Hause, und nach Tische geht der Vater mit ihnen in den Garten und schenkt ihnen ein großes Stück Land bei der Bretterhütte. Das soll ihr eigener Garten sein, damit sie machen können, was sie wollen. Nun giebt's vollauf zu thun für mehrere Wochen. Zuerst wird das Land umgegraben und mit einer Weidenhecke eingezäunt, damit keine Hunde, Katzen und Hühner hineinspazieren. Dann werden Beete abgeteilt, eins zu Blumen, eins zu Gemüse, eins zu Radieschen und Kresse, eins zu Erdbeeren, und auf dem letzten wird Roggen gesäet, von dem sich die Kinder im Sommer, wenn er ganz reif ist, selbst ein Brot backen wollen. Links in der Ecke, unter dem gelben Akazienbaum, den der Gärtner Goldregen nennt, weil er so schöne, goldfarbene Blüten hat, legen sie sich eine Laube an; da hinein setzen sie ihre kleine Kinderbank und den Tisch und pflanzen noch bunte Bohnen zu beiden Seiten. – Nachdem der Same aus der Erde hervorgekommen ist, muß einige Mal die Woche gejätet werden; mehrere Pflänzchen müssen ausgepflanzt und ausgesetzt werden. Bald nachher kann schon Kresse geschnitten und Radieschen können aufgezogen werden. Das ist ein großes Vergnügen, wenn die Kinder ihrer Mama etwas in die Küche bringen können, was mittags gegessen wird. Dicht bei der kleinen Laube aber haben sie ein Beet frei gelassen und nur ein kleines schwarzes Kreuz darauf gestellt; da wollen sie alle kleinen Vögel begraben, die entweder aus dem Neste gefallen oder sonst zu Tode gekommen sind. Ein kleiner Grasplatz ist auch im Garten, auf welchem Mariechen ihre Puppenkleider bleichen kann. Dazu hat ihr Vetter Adolf kleine Pfähle geschnitten, um daran einen Bindfaden hin und her zu spannen zum Aufhängen der Wäsche, die trocknen soll. Es fehlt also den Kindern den ganzen Sommer durch nicht an Arbeit und Beschäftigung bei ihrem Gärtchen.
*
Am Sonntag vor Ostern, früh morgens sechs Uhr, kam der erste Storch an. Die ganze Familie eilte herbei, das mit anzusehen. Es war auch wunderschön. Im vorigen Jahre hatte er sein Nest auf einem alten Nachbarhause gehabt, welches während des Winters hatte abgebrochen werden müssen. Aber die guten Leute hatten das Nest sorgfältig heruntergenommen und auf einer Scheune dicht daneben wieder aufgepflanzt. Als er nun daher geflogen kam, gerade auf seine alte Stelle zu, wunderte er sich sehr und flog im Kreise herum und klapperte ganz dumpf und traurig mit seinem langen Schnabel. Mit einem Male bemerkte er das Nest auf der Scheune, flog zuerst auf das Dach, ging langsam und bedächtig nach dem Neste zu, besah es und stieg hinein. Plötzlich mochte er es doch wohl erkennen, denn er hob den Schnabel gerade gen Himmel und klapperte nun so fröhlich und laut und stark, und schwang dabei seine Flügel, ohne zu fliegen, so munter und schnell, als wolle er den lieben Gort zum Zeugen anrufen, daß er nun wieder sein eigenes Nest gefunden und rechtmäßig davon Besitz nehme. Aber das Nest war etwas schadhaft geworden, darum ging's eifrig ans Ausbessern. Hier und dort wurde gebessert, zusammengeflochten, neues Baumaterial herbeigeholt, und zusehends wuchs und rundete sich das Nest. Acht Tage nachher kam seine Frau nach. Das war ein Leben, ein Jubeln, ein Klappern und Flügelschlagen, als ob sie sich in Jahr und Tag nicht gesehen hätten. Wenn die Schnäbel nicht so lang gewesen wären, hätten sie sich wohl gar geküßt, aber nun ging das nicht gut.
Das war nun wieder eine neue Freude für die Kinder, den Störchen zuzusehen, wie sie am Neste arbeiteten und wie sie klapperten und wie sie hoch auf des Daches Spitze mit langsamen Schritten auf- und abspazierten und nie rutschten oder fielen, und wie das Weibchen nachher so treu brütete und nie von den Eiern wich, und wie sorgsam das Männchen ihr alles zutrug, was sie bedurfte. Karl wollte nun immer wissen, warum der Storch dies und das thue, und was das Flügelschlagen und Klappern und das Wenden des Halses zu bedeuten habe. Da lehrte der Vater ihn ein Lied, welches bald alle Kinder auswendig wußten und dem Herrn Adebar, wie sie den Storch nannten, vorerzählten, wenn er so stolz von oben herabschaute.
Was klapperst Du dort von unserm Dach,
So hell und klar,
Nachtwächter Du, am hellen Tag,
Herr Adebar?
Schon strahlt ja rings der Sonnenschein,
Und alle Menschen groß und klein
Sieh! wie sie rennen und schaffen!
Storch.
Mein Kind, mich sendet der liebe Gott
An diesen Ort,
Ich klapp're hier auf sein Gebot
Mein Wächterwort.
Der Frühling ziehet bei Euch ein
Mit Blumenduft und Sonnenschein.
Nun lobet Gott den Herrn!
Knabe.
Was rüttelst und schüttelst Du so geschwind
Dein Flügelpaar
Und lüftest es im Morgenwind,
Herr Adebar?
Wir haben schon längst nach altem Brauch I
m tauig frischen Morgenhauch
Gebadet Augen und Wangen.
Storch.
Und schüttl' ich, mein Kind, das Flügelkleid
Im Windeshauch,
So soll's Euch lehren in dieser Zeit
Den neuen Brauch.
O breitet des Geistes Flügel aus
Und fliegt in den ewigen Frühling hinaus
Und lobet Gott den Herrn!
Knabe.
Und sprich, warum Du dort spazierst
So ernsthaft gar,
Langsamen Schrittes auf Daches First,
Herr Adebar?
Als wärst Du ein Wächter auf hohem Stand
Und schautest sorgsam umher im Land,
Ob alles in Fried' und Ruhe?
Storch.
Mein Kind, ich wandle auf und ab
Und schaue nach,
Ob irgend ein fauler Knab'
Zu rufen wach.
Und ist noch einer, der komm' hervor
Und singe in aller Wesen Chor
Und lobe Gott, den Herrn!
*
Am nächsten Sonntag ist nun das schöne Osterfest. Morgens früh singen die Eltern mit den Kindern schöne Osterlieder. Unter andern eins, was der liebe Onkel Eduard sie gelehrt hat, als er einmal in Hamburg zum Besuch war, das heißt:
Wie wehen draußen die Winde
So milde durch die Welt,
Wie hüpfen so geschwinde
Die Bächlein durch das Feld.
Und ach, wie treiben und schwellen
Die Knospen an dem Baum,
Wie schwirren die liederhellen
Lerchen durch weiten Raum.
Und auch mein Herz, wie singet
Es froh in meiner Brust,
Wie lieblich wiederklinget
Die heilige Frühlingslust.
Was will doch all dies Wesen
Und Wogen und Treiben sein,
Als wär' die Welt genesen
Aus schwerer Todespein?
Ihr Vöglein in den Lüften
Mit hellem Liederschall,
Ihr Blumen mit süßen Düften,
Ihr Bäume und Sträucher all'.
Habt Ihr's denn auch verstanden,
Wißt Ihr denn auch davon,
Daß heut' aus Grabesbanden
Erstanden Gottes Sohn?
Kommt Ihr um seinetwillen
Zum gold'nen Tagesschein
Hervor aus Eurem stillen,
Warmen Schlafkämmerlein?
Kommt, laßt uns alle ziehen
Zum offnen Grabesthor,
Da sollt Ihr singen und blühen,
Und ich will beten davor.
Der Vater wiederholt dann mit ihnen die Auferstehungsgeschichte des lieben Heilands. An der Wand hängen auch mehrere Osterbilder. Auf einem sieht man, wie Christus aus dem Grabe hervorgeht, und die Hüter vor Erschrecken zu Boden fallen; auf einem andern, wie Maria im Garten Jesum sucht, und der mit einem Male vor ihr steht und sie bei ihrem Namen ruft; auf einem dritten, wie Jesus mit den Jüngern nach Emmaus geht. Alle diese Bilder haben die Kinder mit Kränzen von Osterblümchen, Schneeglöckchen und Schlüsselblumen geschmückt, davon schon eine Menge im Gehölz blühen; das sieht gar lieblich aus. Um acht Uhr gehen Vater, Mutter, Adolf und Lottchen zur Kirche. Mariechen steht vor der Mutter und sieht sie ganz wehmütig an. »Nun, was will mein Töchterchen denn noch?« fragt die Mutter und bückt sich zu ihr hinunter. – »Ach Mutter, ich möchte so gern mit in die Kirche gehen und die schönen Lieder mitsingen und vom lieben Heiland erzählen hören, nimm mich mit!« So bittet Mariechen, und dabei drängen sich große Thränen aus ihren Augen, weil sie bange ist, daß Mama nein sage. – Mama sieht aber sehr freundlich aus, küßt der Kleinen die Thränen von den Backen und sagt: »Ja wohl gern, mein Herzenskind, komm mit uns! Du weißt ja, daß der Heiland gesagt hat: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht! Komm gern mit, Du wirst ja still und andächtig sein können.« O wie schnell holt Mariechen Hut und Tuch, und wie glückselig sieht sie aus! Karl sieht sie mit großen Augen an und weiß nicht recht, was er dazu sagen soll. Endlich geht er zu der kleinen Lisabeth und sagt: »Lisbeth, dann wollen wir während der Zeit in den Garten gehen und kleine Nester suchen für den Osterhasen; dann, wann die andern aus der Kirche kommen, ich weiß wohl! dann kommt noch was Schönes.«
Um elf Uhr kommen sie wieder aus der Kirche zurück. Der Vater spricht über die Predigt, und Mariechen erzählt von dem, was sie gehört und gesehen hat. Dann wird gefrühstückt, und darnach soll nun das Schöne kommen, worauf Karl sich am frühen Morgen freute. Am Tage vorher haben nämlich Vater, Mutter, Lottchen und Marie eine Menge Eier gekocht und bunt bemalt: blau und rot und gelb und grün, wie es eben kam, einige auch bunt. Einige waren auch in bunte Läppchen eingewickelt und so gekocht worden; da haben sich die Blümchen und Sternchen von dem Zeuge auf die weiße Schale abgedruckt, das sieht gar niedlich aus. Zuletzt sind nun auf die bunten Eier kleine Sprüchlein oder Verse geschrieben worden mit einer spitzen Nadel. Ein Vers heißt:
Vöglein sitzt im engen Ei,
Wachsen läßt's die Flügel,
Und dann fliegt es frank und frei
Über Wald und Hügel.
Auf einem andern Ei steht:
Wenn ein Bettler zu Dir träte,
Gäbest Du ihm wohl zum Hohn
Statt des Ei's darum er bäte,
Einen gift'gen Scorpion?
Auf einem dritten:
Weiß schon das Ei ein Sprüchelein,
Wie klug wird erst die Henne sein!
Auf einem vierten:
Fromm, gut und rein,
Drei Edelstein'!
Und so fort auf jedem Ei ein ernstes oder lustiges Sprüchlein. Als nun am Sonntag das Frühstück verzehrt ist, werden die Kinder und auch der große Adolf in das Vorderzimmer eingeschlossen. Papa und Mama gehen aber in den Garten und verstecken die Eier im Gras, in Buchsbaum, hinter den Büschen, und auch in den Sand werden einige leicht eingescharrt. Hier und da steht auch ein kleines Nest von Heu gemacht; drin liegen zwei Eier und drauf sitzt ein kleiner roter Zuckerhase. Als alle Eier versteckt sind, werden die Kinder gerufen. Sie müssen ganz leise und vorsichtig gehen, damit sie kein Ei zertreten; wenn aber eins gefunden wird, dann wird laut gejubelt. Nach ein paar Stunden sind alle Eier wieder da. Jedes Kind bekommt ein Zuckerhäschen und ein Nest, dahinein legt es seine Eier, bei Tische werden die Verschen gelesen und gelernt und dann die gelben Eidotter in die heiße Suppe geworfen und verzehrt. Die Zuckerhasen aber bewahren die Kinder auf, denn sie wollen sie gerne nächste Weihnachten mit an den Baum hängen. Nur Karl meint: »Vier, das ist doch gar zu viel!«, darum beißt er seinem Häschen schnell den Kopf ab, zerschlägt den Rest in kleine Stücke und giebt allen Geschwistern etwas davon ab. »Das ist ein süßer Braten,« sagt Lottchen, »unser Karl ist ein guter Koch, und wenn Weihnachten kommt, dann soll er unsern Hasen auch' mit aufessen helfen.«
*
Bei dem schönen warmen Wetter gefällt es den Kindern so gut im Garten, daß es immer ein Kummer ist, wenn es heißt:
Zu Bett, zu Bett, ihr Kindlein all',
Ich ruf' euch schon zum zweiten Mal!
Kein Mücklein spielt, kein Käfer schwirrt,
Kein Bienlein summt, kein Täubchen girrt,
All' Vöglein schweigen still, still, still,
Weil alles, alles schlafen will.
Kommt! Morgen ist ein neuer Tag,
Der ruft euch frühe wieder wach. –
Ach, dann ist kein Kind müde. Sie wollen die Sonne untergehen oder die Blumen sich schließen oder den Mond aufgehen sehen, oder der Garten muß noch fertig geharkt werden, oder dies oder das, kurz, zum Schlafen scheint es ihnen immer zu früh. Aber des Morgens, dann scheint es ihnen auch immer zum Aufstehen zu früh, und wenn Papa halb sechs Uhr von seinem Morgenspaziergang heim kommt und den Kindern entgegenruft:
Steh' auf, steh' auf! Die Lerche ruft,
Es ruft der süße Morgenduft,
Und tausend Blümlein warten dein,
Im farbenhellen Perlenschein.
Es wartet Dein der Sonnenstrahl,
Der leuchtet über Berg und Thal,
Hat schon vom Himmel über Nacht
Zu Dir den weiten Weg gemacht.
Wisch' Dir vom Schlaf die Augen hell
Und schüttl' und rüttle Dich, Gesell!
Sieh, wie die Erde strahlt und blüht!
Und sing' dem lieben Gott ein Lied!
dann meinen sie: »Ach Papa, mit den Augen kann ich doch nicht sehen, denn sie fallen immer wieder zu, und singen kann ich gar nicht, weil ich immer gähnen muß.« – Papa sagt aber: »O, wenn Ihr nur einmal mit mir draußen wäret, so früh morgens, da würde Euch das Gähnen einmal vergehen. Wenn Ihr hörtet, was die Vögel singen, und was der Wind flüstert, und was das Wasser rauscht, und was die Bäume und die Grashalme und die Knospen an den Bäumen sprechen, da würdet Ihr so schöne Lieder hören, daß Ihr's gar nicht lassen könntet, sie laut zu singen.« »Aber, Papa,« sagt Marie, »Du kannst es uns wohl wiedererzählen, was die Blumen und die Grashalme und die Knospen Dir alles erzählt haben!« »Und dabei wollt Ihr kleinen faulen Leute im Bette liegen?« »Ja, Papa, nur zu, nur zu!« ruft Karl, und dabei wühlt er sich in sein Kissen hinein und guckt mit seinen schelmischen schwarzen Augen so keck und munter in die Welt hinein wie ein Eichhörnchen.
»Nun, so hört!« sagt der Papa. »Als ich diesen Morgen so dahin ging und all die hundert Dinge um mich her betrachtete, da sah ich so recht, wie alles seine Stelle und Ordnung hatte, und alles so schön ineinander griff, und keins das andere störte oder hinderte, und keins hinter dem andern zurückblieb, und bei aller Thätigkeit doch alles so fröhlich und lustig, voller Jubel und Herrlichkeit war. Da war mir's, als könnten sie alle sprechen, und ich verstand ihre Sprache. Ich ging zum Tauperlchen und sagte: ›Guten Morgen, Tauperlchen, was thust Du da?‹ – Da sprach es ganz fröhlich: ›Ich sitze hier und gebe dem Blümlein zu trinken, und nebenher funkle ich und blitze, damit das Blümlein schöner werde. Ich habe aber keine Zeit zu plaudern; wenn die Sonne steigt, so zehrt sie mich auf und ich sterbe dann. Ach! das ist ein sel'ger Tod, an der Sonne sterben!‹ – Dann ging ich zum Vöglein und sagte: ›Guten Morgen, Vöglein, was thust Du?‹ – Da sprach es: ›Ich hab' ein Nest gebaut, da sitzen Kinder drin, die zwitschern und sind fröhlich, und ich füttre sie; aber ich habe jetzt keine Zeit zu plaudern: ich muß in die Luft fliegen und dem Herrn ein Morgenlied singen.‹ – Da ging ich zum Apfelbaum und sagte: ›Guten Morgen, Apfelbaum, was machst Du?‹ – Da antwortet der Apfelbaum: ›Ich habe alle meine Arme ausgestreckt, und da sind vom Himmel hunderttausend Blüten darauf gefallen, und nun hege und pflege ich sie, damit sie Früchte bringen. Aber ich habe keine Zeit zu plaudern. Höre, der Morgenwind braust daher! Der kommt, in den Blüten zu weben und zu schaffen, da muß ich sorgsam meiner Pflicht warten!‹ Und mit einem Mal fing alles an zu rauschen, zu flüstern und zu zwitschern rings um mich her, und alle zusammen fragten mich: ›Was thust Du denn?‹ ›Ich gehe spazieren.‹ – ›Spazieren? was ist das? was nützt das?‹ – Da verstanden sie alle nicht, was das sei, spazieren gehen; und ich schämte mich und schwieg stille und schlich leise und traurig nach Hause, und alle lachten und spotteten und jubelten hinter mir her. Was meint Ihr nun, was Tauperlchen und Vöglein und Apfelbaum wohl zu Euch sagen würden, wenn sie Euch gar im Bette liegen sähen?« – »Das leid' ich nicht,« sagt Karl, springt schnell aus dem Bette und läuft zu Mama, damit sie ihm helfe beim Waschen und Anziehen.
*
Am einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Juni haben Mama und Lottchen und Marie nachmittags so viel zu thun, daß sie gar nicht im Garten spielen können. Am ersten Tage stricken alle drei, daß ihnen am Ende die Finger ganz weh thun, am zweiten machen sie Kränze, so viel nur der Garten Blumen und Zweige hergeben will. Das kommt, am dreiundzwanzigsten ist Papas Geburtstag, dazu hat Mama drei, Lottchen zwei und Marie ein Paar Socken gestrickt, die müssen ja fertig werden, und mit den Kränzen wollen sie den lieben Papa und die ganze Stube schmücken. Karl ist ein bißchen unglücklich, daß er immer allein ist und keine Spielkameraden hat. Endlich fällt ihm ein, er möchte dem Vater doch auch gern etwas schenken, und er kann doch nicht stricken und nähen. Da giebt Mama ihm ein Stück Papier und einen Bleistift und rät ihm, schnell noch ein kleines Bild zu zeichnen und zu malen. Das gefällt ihm. Er zeichnet also ein Haus mit Thür und Fenster, Dach und Schornstein, wo viel Rauch heraussteigt, an der andern Seite Gras und eine Kuh. »Das geht ganz leicht,« sagt er, »da mache ich nur ein länglichrundes Ding und vier Striche da drunter, und an der einen Seite einen Schwanz, an der andern Seite den Kopf mit zwei Hörnern, fertig ist es.« »Aber wenn es denn doch gar nicht wie eine Kuh aussieht!« sagt Marie. »Ach, mein Papa kennt es doch, der ist viel zu klug,« versichert Karl. – »Laßt den Kleinen nur zeichnen,« sagt Mama, »Papa wird sich schon darüber freuen.« Nun kommt noch ein Baum mit vielen runden Äpfeln zwischen Haus und Wiese, dann muß Mama ihm vier kleine runde Räder machen, darauf zeichnet er einen Wagen mit einer Deichsel. Aber die Pferde sind schon im Stalle, die kann er nicht mit zeichnen. Nun wird der Malkasten geholt. Das Haus wird gelb, das Dach rot, die Wiese und der Baum grün, die Kuh braun und weiß gemalt. Die Beine der Kuh sind freilich auch grün geworden, aber Karl meint, das schade nicht, das sehe so aus, weil sie im hohen Grase stehe. Dann wird das Bild zum Trocknen in die Sonne gelegt. Das ist recht schwer für Karl, daß er so lange warten muß; denn er will noch die Äpfel auf dem Baume rot und gelb malen, und das ist so niedlich zu malen. Mama sagt aber, das gehe nicht, wenn der Baum nicht ganz trocken sei. Endlich hält Lottchen das Bild in der Küche ein bißchen gegen das Feuer, da wird es schnell trocken, und Karl malt es fertig. Er findet es ganz hübsch und möchte sehr gern Glas und Rahmen dazu haben. Mama findet das freilich nicht nötig, aber Lottchen sagt: »O Mutter, ich mache für Karl ein Glas von Gummi und einen Rahmen von schwarzem Papier.« Das geschieht. Als das Bild ganz trocken ist, bestreicht Lottchen es mit recht dickem klarem Gummi, klebt dann ein Stückchen Pappe dahinter und einen Streifen schwarzen Papiers rund umher. Nun sieht's prächtig aus und Karl findet sein Geschenk viel schöner, als die langweiligen grauen Socken, welche die andern gestrickt haben. Am dreiundzwanzigsten Juni, früh morgens, ist Mama mit allen Kindern im Wohnzimmer; Papa darf aber nicht eher kommen, bis er gerufen wird. Alle Bilder, die im Zimmer sind, werden mit Kränzen umhängt, und einen langen Kranz haben Mama und die drei Kinder in Händen. Nun wird geklingelt, und als Papa hereintritt, wird ihm der Kranz umgehängt, und die Kinder singen:
Wie hat mich doch so fröhlich
Der liebe Gott gemacht!
Wie hat er mich so selig,
So himmlisch reich bedacht
Ich kann ans Herz Dich drücken,
Und Du versagst mir's nicht;
Ich kann so frei Dir blicken
Ins Vaterangesicht.
Du willst mir alles zeigen,
Was schön und lieblich ist,
Das Herz mich lehren neigen
Dem Heiland Jesu Christ.
Du bleibest Deiner Liebe
Zu allen Stunden treu;
Und wenn ich Dich betrübe,
Vergiebst Du meiner Reu'.
Du bist mein süßes Leben,
Dein Herz mein Freudensaal;
Und der Dich mir gegeben,
Dem dank' ich tausendmal.
Papa küßt Mama und die lieben Kleinen und freut sich sehr über die Kränze und über die Socken und über Karls schönes Bild und verspricht den Kindern, er wolle in der Stadt den ganzen Morgen sehr fleißig sein, damit er bis ein Uhr mit seiner Arbeit fertig sei, dann will er zum Essen kommen, und anstatt nach Tische wieder zur Stadt zu gehen, mit der ganzen Familie weit über Land fahren.
*
Das ist eine Freude, als endlich das Mittagsessen verzehrt ist, und alle sich auf den Wagen setzen. Es ist auch wunderschön draußen! Alles rund umher ist so grün und so duftig. Die Vögel zwitschern, die Frösche quaken, die Lämmer und Ziegen machen tausend behende Sprünge, und die ernsten Kühe brüllen dazwischen, als wollten sie all' die fröhlichen Tiere in Ordnung halten und zur Ruhe verweisen. Mit einem Male ruft Karl: »Aber dürfen die Kühe denn das Korn auffressen?« – »Nein, bei Leibe nicht,« erwidert der Vater, »wovon sollten wir denn Brot backen?« »Sie thun es aber doch,« sagt Karl, »sieh' nur!« Und wahrlich! da sind eine Menge Kühe ins Kornfeld hineinspaziert, treten alles nieder und fressen nach Herzenslust. – »O weh, o weh,« sagt der Vater, »das ist eine böse Geschichte, gewiß liegt der faule Kuhjunge irgendwo und schläft, anstatt auf sein Vieh zu passen.« Und richtig! Wie sie noch eine Strecke weiter gefahren sind, da sehen sie den Burschen lang ausgestreckt im Grase liegen. Der Kutscher knallt mit der Peitsche, und alle rufen: »He! Halloh! Jahoh! Jahuh!« Der Junge wacht auf, dehnt sich und streckt sich und reibt sich die Augen. Als aber der Kutscher ihn nochmals anruft: »Du, Junge, sieh' doch einmal, wo Deine Kühe sind!«, da dreht er sich um und läuft mit großem Schrecken den unverschämten Tieren nach. Die haben aber den Weg ins Feld viel besser gefunden, als sie nun den Ausweg finden können, und das ganze Feld ist zertreten und ruiniert, ehe die Kühe wieder auf ihrer Weide sind. »Na, die Schläge, die der Junge noch von seinem Herrn kriegen wird, möchte ich auch nicht haben,« sagt der Kutscher. »Ach, und das schöne Korn,« ruft Lottchen, »wie viele arme Leute hätten davon Brot bekommen können!« »Da seht Ihr,« setzt der Vater hinzu, »wie schlimm es ist, wenn Kinder sich nicht frühzeitig gewöhnen, aufmerksam und gewissenhaft zu sein bei dem, was ihnen zu thun aufgetragen ist.«
Nach einer Stunde kommen sie bei einem großen Bauerhof an, steigen aus und gehen hinein. Da ist nun vieles, was den Kindern Freude macht. Gleich an der Thür liegt ein Hund, der hat vier Junge, ganz kleine Tierchen, die erst eben die Augen aufmachen können. Zwei sind ganz schwarz, einer ist braun und der vierte braun und weiß gefleckt. Die Kinder dürfen aber keins der Jungen anfassen, sonst wird der große Hund böse und beißt sie wohl gar. Auf dem Hof steht ein kleines Häuschen auf einem hohen Pfahl, darin wohnen viele Tauben, über fünfzig. Ach was sind das für süße Tierchen! Die Bauerfrau giebt Lottchen und Marien einen kleinen Sack voll gelber Erbsen und Taubenbohnen, die streuen sie hin; da kommen gleich alle Tauben heruntergeflogen und picken das Futter auf. Mehrere von ihnen haben auch Junge, die eben fliegen, aber noch nicht, fressen können; die schreien nun tüchtig hinter den Alten her, bis diese sie aus ihrem Kropf füttern. Ein Teich ist auch da, auf dem viele Enten und Gänse herumschwimmen und schnattern.
*
An der einen Seite ist ein großer eingezäunter Platz, darauf sind eine Menge Hühner mit einem großen bunten Hahn. Zwei Glucken sind auch da, davon hat eine zwölf, eine vierzehn Kücken. In dem Hühnerstalle waren eine Menge Nester, in welche die Hühner Eier legen. Marie und Lottchen sehen nach, ob auch Eier da sind, die sie der Bauerfrau ins Haus bringen können. Auf einem Nest sitzt eine Henne und Marie sagt: »Laß uns nur warten, die legt gewiß ein Ei.« Als das Tier den Mädchen aber zu lange sitzt, da jagen sie sie vom Neste und, potztausend, was sehen sie da! In dem Neste liegen sechzehn Eier. Voll Freuden packen sie dieselben in die Schürze und bringen sie der Hausfrau. Aber die macht ein böses Gesicht und weiß nicht recht, ob sie über die glücklichen Kinder lachen oder ob sie schelten soll. »Mädchen, Mädchen, was macht Ihr für dumme Streiche,« sagt sie endlich, »die Eier sind ja der Henne untergelegt, damit sie darauf sitzen und die jungen Kücken ausbrüten solle, die in den Eiern sind; nun habt Ihr sie weggenommen. Wenn die Henne sich nun nicht wieder darauf setzen will, so sind alle die Eier verdorben.« Marie und Lottchen machen traurige Gesichter und sehen bald die Frau und bald die Eier an. »Na, wir wollen versuchen, was die Gluckhenne thut, kommt mit, aber ein ander Mal müßt Ihr ja nicht wieder eine Henne vom Neste jagen!« sagt die Frau. Nun werden die Eier wieder sorgfältig ins Nest gelegt und die Frau stellt sich mit den Kindern in die Ecke des Hühnerhofes und sieht zu, was draus werde. Die weiße Henne läuft zwischen den andern hin und her und ruft: »Gluck, Gluck!« Nach einer Weile spaziert sie in den Stall, besieht das Nest mit den Eiern, steigt hinein, setzt sich auf die Eier, steht noch einmal wieder auf und legt das Köpfchen bald auf die rechte, bald auf die linke Seite; dann macht sie sich ganz rauch und nimmt die Eier wieder unter sich. Lottchen und Marie haben sehr ängstlich zugesehen und sind von Herzen froh, als alles wieder in Ordnung ist.
*
Nun gehen sie vom Hof in den Garten, wo die andern schon beim Trinken sitzen. Von da geht's auf die Wiese und ach! da kommt gerade der Hirtenknabe mit einer ganzen Herde junger Lämmerchen. Lisbethchen klascht vor Freuden in die Hände und läuft mitten zwischen die Tiere, die vor dem kleinen Mädchen gar nicht bange werden, faßt ein Lämmchen fest um den Hals und ruft: »Das mein Lamm, das mein Lamm!« Es hilft auch gar kein Bedeuten und Vorstellen, sie bleibt dabei: »Nein, nein, das mein Lamm, nicht weggehen! Das mein Lamm, mein süßes Lamm!" Und sie streichelt und küßt es. »Ach, Papa,« bittet Karl, »schenk' ihr das Lamm, wir haben ja so viel Gras im Garten, und im Gärtnerschauer kann ja sein Stall sein.« Der Vater läßt sich erbitten und kauft das Lamm. Nun bekommt es ein grünes Band um den Hals und wird bei der Bank angebunden. Elisabeth ist sehr glücklich und will all ihren Kuchen mit dem Lämmchen teilen. Als es sechs Uhr ist, da werden die Kühe gemolken auf der Wiese, und alle gehen hin, um das mit anzusehen. Karl aber hat bald genug gesehen und läuft bald hier-, bald dorthin, um sich an den vielen neuen fremden Dingen zu freuen. Mit einem Mal kommt er mit großem Jubel angesprungen, hat einen von den kleinen Hunden auf dem Arm und ruft: »Ach, Papa, sieh doch, ich hab' den einen kleinen schwarzen Hund geschenkt bekommen, ach Papa, darf ich ihn behalten? Ja, Papa? Sieh 'mal sein glattes Haar und die kleinen Pfoten, und sieh 'mal, nun macht er die Augen auf, wie sie blank sind, und Zähne hat er auch schon, soll ich sie Dir 'mal zeigen?« – »Junge, Junge, mach' nur den kleinen Hund nicht gleich tot! Ich bitte Dich, Du darfst ihn gar nicht so hart anfassen; hör' nur, wie er quiekt! Er will gern wieder bei seiner Mutter sein.« – »Ja, mein Papa,« sagt Karl, »aber der Mann sagt, er könne doch nicht alle vier Hunde behalten, und wenn er sie nicht verschenken könne, so sollen sie in den Teich geworfen werden. Unserm Kutscher hat er den weiß und braunen Hund geschenkt. Aber dieser soll nicht in den Teich geworfen werden. Nicht wahr, Papa, ich darf ihn mitnehmen?« »Nun, so frage Mama, ob die es erlauben will,« sagt der Vater. Mama nickt mit dem Kopfe und sagt: »Meinethalben, aber Du mußt auch nicht vergessen, für ihn zu sorgen.« »Nein, gewiß nicht,« verspricht Karl, »er kann schon Milch trinken und eingeweichtes Brot essen, damit füttere ich ihn.« Der kleine Hund wurde nun in ein Körbchen auf Heu gesetzt, um abends mitgenommen zu werden.
*
Um sieben Uhr werden die Kinder zusammengerufen, weil wieder nach Hause gefahren werden soll. Aber Mariechen kommt nicht. Sie rufen im Garten, im Hause, im Hofe – Marie kommt nicht. Vater und Mutter werden ganz bange, denn Mariechen ist gehorsam und kommt immer schnell angelaufen, wenn sie gerufen wird, und geht nirgend hin, wohin sie nicht gehen darf. »Ach, lieber Gott, wo mag mein Töchterchen sein?« sagt die Mutter. Da klatscht Karl in die Hände und ruft: »Ich weiß es schon, sie füttert die Tauben!« Vater und Mutter können sich das nicht recht denken und gehen schnell nach dem Hofe, rufen und sehen überall herum. Mit einem Male sagt die Bauerfrau: »Da sitzt sie ja, aber sie schläft!« Und mit großer Freude sehen die Eltern ihr liebes Mariechen an einem großen Heuhaufen sitzen, der vor der Scheune liegt. Den ganzen Schoß hat sie voll Erbsen gestreut. Wahrscheinlich hat sie gewartet, daß die Tauben herankommen sollen, um aus ihrer Hand zu fressen, und ist dabei eingeschlafen. Jetzt sitzt eine schneeweiße Taube in ihrem Schoß und pickt nach Herzenslust. Als die Eltern aber herzutreten, fliegt die Taube auf. Von der Bewegung erwacht Marie, streckt der Taube beide Arme nach und kann garnicht glauben, daß sie geschlafen hat; sie meint, sie habe mit all' den Tauben gespielt und ihnen kleine Halsbänder von Heu gemacht. Indes die ganze Familie sich nun wieder in dem Wagen zurecht setzt, hat die Bauerfrau noch auf dem Hofe zu thun; ehe sie aber wegfahren, kommt sie an den Wagen mit zwei verdeckten Körben und sagt: »Die Mädchen müssen doch auch ein Andenken mitnehmen. Da ist für die große Tochter eine schwarze Henne mit weißem Poll; die kannst Du nun füttern, damit sie brav Eier lege, die Du dann Deiner Mama bringen kannst! Und der kleinen Heumamsell schenke ich das weiße Täubchen, das sie im Schlaf gefüttert und gehätschelt hat. Damit sollst Du nun auch im Wachen spielen und dann an unser Dorf denken!« Wie freuen und bedanken sich nun die beiden Mädchen. Sie lassen die Hand der freundlichen Frau gar nicht wieder los, bis der Wagen mit ihnen fortrollt.

*
Das ist von nun an eine ganz neue Beschäftigung für die Kinder. Mit lebendigen Tieren haben sie bis jetzt noch nie zu thun gehabt. Zuerst muß das Lamm und der Hund und die Henne und die Taube jedes eine Wohnung haben. Der gute Papa macht sie auch zurecht. Die Taube bekommt einen kleinen vergitterten Kasten, den Mariechen abends mit in ihr Zimmer nimmt. Der Hund ist noch so klein, daß Mama einen alten Korb hergiebt, der, mit etwas Stroh darin, auf die Diele gestellt wird. Darin kann das Tierchen liegen, wenn es nicht mehr herumlaufen mag. Für die Henne muß im Waschhause ein Plätzchen abgeteilt werden, von dem sie durch ein ganz kleines Hühnerthürchen hinaus ins Freie laufen kann. Das Lamm bekommt seine Wohnung wirklich im Gärtnerschauer, wie Karl es vorgeschlagen hat. Nun müssen die Kinder aber immer dafür sorgen, daß die Tiere ihr Futter bekommen und reinlich gehalten werden und abends wieder auf ihrem Platze sind. Die Kinder geben ihren Tieren nun auch Namen. Karl nennt seinen Hund Hektor, Lottchen ihre Henne Pull und Mariechen ihre Taube Guli, das kleine Lamm heißt einstweilen Bählamm. Von allen Kindern sorgt aber keines so treu für sein Tier wie Marie. Sie trinkt und ißt nicht, wenn ihr Täubchen nicht schon gefüttert ist. Geht sie in den Garten, so nimmt sie es mit; bekommt sie Zuckerwerk, so teilt sie es mit Guli. Die wird aber auch so zahm, daß sie kommt, wenn Marie sie ruft, und ihr auf Kopf und Hand und Schultern fliegt und ihr die Krümchen aus dem Munde pickt. Einmal geht Marie mit ihrem Täubchen auf der Schulter in den Garten und will sehen, ob auch Äpfel abgefallen sind; die will sie in ihren Korb sammeln. Karl ist aber schon vorher da gewesen, und als er Marie kommen sieht, versteckt er sich hinter einen Fliederbusch. Als nun Mariechen vorbeigehen will, klatscht er mit einem Male in die Hände und springt mit großem Geschrei hervor. Darüber erschrickt die Taube und fliegt auf, höher und höher, bis sie sich auf die Zweige eines hohen Baumes setzt.
Marie schreit laut aus: »Meine Guli, meine Guli!« Aber Guli kommt nicht wieder, und Marie weint bitterlich. Karl ist traurig, daß er einen so dummen Streich gemacht hat. Aber das hilft nichts, Guli bleibt auf dem Baume sitzen, und Schwester Marie weint. Da ruft Lottchen zum Abendbrot. Karl geht langsam ins Haus, aber Marie mag nichts essen, sie sieht nur immer nach ihrer Taube. Karl bringt ihr Brot und Früchte in den Garten, wischt ihr die Thränen ab und küßt sie; es thut ihm so leid, daß die Schwester traurig ist, Marie bittet ihn: »Geh' ins Haus, damit die Taube nicht noch mehr bange wird; vielleicht kommt sie wieder, wenn ich allein bin und sie locke.« Karl geht, und Marie streut all ihr Abendbrot hin und ruft weinend ihre liebe Guli; und wie es nicht helfen will, faltet sie die Hände und sagt: »Ach, lieber Gott, bitte, schicke mir meine liebe Guli wieder herunter!« – und sieh, mit einem Male wird das Täubchen unruhig, bewegt die Flügel und fliegt herab in Mariens Schoß. Hoch oben kreist ein Habicht, den hat der liebe Gott geschickt, daß er die Taube bange mache. Da kommt sie herabgeflogen und sucht bei Marie Schutz. O wie froh ist Marie, als sie ihre Guli wieder in den Händen hält! Sie küßt sie wohl zwanzigmal und kann gar nicht aufhören zu weinen, so freut sie sich; aber sie sieht auch nach dem Himmel hinauf und dankt dem lieben Gott, der das Täubchen wieder heruntergeschickt hat. Nun kommt Mama mit dem Gitterkasten und den andern Kindern; die wollen Marie trösten. Karl bringt seinen kleinen Hund und will den an Marie schenken. Sie aber lacht ihnen entgegen, zeigt ihnen das Täubchen und sagt: »Der liebe Gott hat meine Guli wieder heruntergeschickt.« – »Das hat gewiß Bruder Edmund gethan,« sagt Karl, »das ist nett! Und nun kann ich auch meinen Hektor behalten, nicht wahr, Mama?«
»Aber Du mußt mich nicht wieder erschrecken, wenn Guli auf meiner Schulter sitzt,« sagt Marie, und alle gehen dann ins Haus und essen ihr Abendbrot.
*
Nach acht Tagen werden die Äpfel und Birnen und Pflaumen reif und glänzen schön rot und gelb und blau zwischen den grünen Blättern. Das haben die armen Kinder der Umgegend wohl gemerkt, drum kommen sie eins nach dem andern und fragen, ob sie wohl das Erntefest mitfeiern dürfen, wie sie schon zwei Jahre gethan. Alle werden auf den nächsten Donnerstag wiederbestellt. Bis dahin ist nun die ganze Familie beschäftigt, das Fest vorzubereiten. Es werden nämlich von Papa und Mama, Adolf und Lottchen Sprüche aus der Bibel auf kleine Karten geschrieben. Marie näht dann ein buntes Bändchen daran, und Karl legt sie fein ordentlich nach den Farben zusammen. Als die Kinder dann Donnerstag aus der Schule kommen, wird ein Tannenbaum aus dem Garten geholt, auf den Grasplatz dicht hinter dem Hause gestellt, und die Sprüche daran befestigt, so daß die bunten Bändchen im Winde flattern. Als nun die armen Kinder kommen, hat jedes sein Sprüchlein vom vorigen Jahr wieder mitgebracht. Das zeigt es und sagt es auf, denn sie haben es gar wohl behalten. Darauf bekommen die Kinder Milch und Brot, und dann geht's in den Garten zu dem schön geschmückten Tannenbaum. Die Kinder schließen einen großen Kreis. Der Vater steht bei dem Baum, läßt die Kinder einzeln hervortreten, löst ihnen einen Spruch ab, sagt denselben laut vor, und alle Kinder sprechen ihn im Chor nach. Dann tritt das Kind mit dem erhaltenen Spruch wieder an seinen Platz, und das nächste muß herzutreten. Als jedes Kind einen Spruch hat, geht's wieder ins Haus. Die Kinder werden nun alle auf Sonntag Mittag zwölf Uhr eingeladen; doch wird ihnen dabei gesagt, wer seinen Spruch nicht wisse, werde wieder fortgeschickt. Die Kinder im Hause lernen jetzt auch morgens und abends, um am Sonntag jedes seinen Spruch zu wissen. Lottchens Spruch ist: Joh. 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben; Mariens: Matthäus 19, 14. Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das Himmelreich; Karls: Psalm 118, 1. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Die kleine Elisabeth hat die Worte Lucas: 11, 3. Gieb uns unser täglich Brot immerdar. Als die Kinder am Sonntag Morgen die Augen aufthun, da ist großer Jubel, da die Sonne so schön hell und freundlich ins Zimmer scheint. Marie und Lottchen gehen mit den Eltern und Vetter Adolf zur Kirche, und als sie nach Hause kommen, da dauert es gar nicht lange, bis die ersten Kinder kommen. Um zwölf Uhr sind alle beisammen, sechsunddreißig an der Zahl. O, wie gut die Kinder gelernt haben! Jedes weiß seinen Spruch ohne Anstoß zu sagen und manche wissen noch vier oder fünf der andern Sprüche auch. Nun geht's in den Garten. Auf dem Grasplatze ist ein langer, langer Tisch gedeckt, da herum setzen sich die Familie und all' die armen Kinder. Nachdem der Vater für die Speise dem lieben Gott gedankt und ihn gebeten hat, sie zu segnen, da wird gegessen: Reis mit Caneel und Zucker und nachher ein großer Kalbsbraten und schöne gelbe Kartoffeln. Nach Tische geht's fort zur Ernte. Der ehrliche Gärtner Jakob hat heute auch mit ihnen essen müssen. Nun holt er Leiter und Stock, auch den Apfelfänger; das ist ein eiserner Ring mit vielen Zacken an einem langen Stiele, mit dem man die Äpfel abpflückt, die dann gleich in einen kleinen Sack fallen, der an dem Ringe festsitzt. Jedes Kind bekommt einen Sack umgehängt und die Erlaubnis, so viel Äpfel, Birnen und Pflaumen hinein zu sammeln, wie der Sack fassen will. Das ist nun eine Lust. Bis um drei Uhr wird geklettert, geschüttelt, gepflückt und aufgesammelt, und außer den Säcken der Kinder sind noch zwei große Körbe mit Äpfeln und Birnen und ein kleiner mit Pflaumen gefüllt worden. Dann bedanken sich die Kinder für alle Freude, die sie gehabt haben, versprechen die leeren Säcke am andern Tage wiederzubringen und gehen jubelnd mit ihrer Last nach Hause.
Abends wird von allen Sorten der Früchte probiert, und alle werden gelobt und bewundert. Dann wird noch ein Korb voll Früchte gepackt und mit Blumen und Tannenzweigen verziert; den bringen die Kinder dem alten Jakob, den sie alle so lieb haben. Der freut sich sehr darüber und schenkt jedem Kinde eine schöne Blume aus seinem kleinen Garten. Damit schmücken die Kinder ihre Hüte und kommen fröhlich wieder bei den Eltern an. Karl schenkt seine Blume an Mama, Lottchen setzt ihre ins Wasser, damit sie noch lange blühe, und Marie legt ihre vorsichtig in ein altes Buch, um sie zu trocknen. »Dann habe ich sie doch noch, wenn der alte Jakob schon gestorben ist, und kann dabei an ihn denken,« sagt das kleine Mädchen und sieht ganz ernsthaft aus. »Wer weiß,« sagt Adolf, »der alte Jakob lebt vielleicht noch länger als wir alle miteinander, der ist so stark und gesund.« – »O nein,« sagt Karl, »das kann doch nicht angehen, er hat ja schon weiße Haare!«
*
Nach und nach werden die Abende immer länger. Die Luft wird immer kälter, so daß die Kinder gar nicht mehr so viel im Garten laufen können, sondern besonders nach Tische im Zimmer spielen müssen. Lottchen und Marie haben ihre Puppen, bauen sich von Stühlen ganze Stuben, setzen ihre kleinen Stühle, Tische und Bettstellen dahinein und hegen und pflegen ihre Puppen, ziehen sie aus und an, setzen sie um den kleinen Tisch und füttern sie. Aber der wilde Karl paßt gar nicht mit in die Puppenstube; er will wohl immer mitspielen und verspricht, ganz sanft mit den Puppen umzugehen, aber er versteht das gar nicht. Wenn das Püppchen das schöne Sonntagskleid an hat, dann zieht er ihr einen alten schmutzigen Kittel darüber, und wenn er es füttern soll, dann bindet er ihr gar kein Tuch vor, und wenn das Püppchen sich begießt, dann sagt er, er könne das nicht sehen, und wenn die Schwestern rufen: »Hör', wie das kleine Kind schreit, Du mußt es hübsch einhuschen!« dann sagt er, er höre das gar nicht, und wenn er das Puppenkind in die Wiege legen soll, dann legt er's aufs Gesicht, daß es beinahe erstickt, und wenn die Schwestern nicht aufpassen, so vergißt er ganz, daß die Stühle Wände vorstellen sollen, schiebt sie mit einem Male auseinander, setzt sich auf einen und ruft: »Jü, jü, knall!« weil er meint, er sitze zu Pferde. Das geht ja gar nicht an, und die Mädchen bitten Mama, ob Karl nicht am Tische spielen könne, weil er ihr ganzes Spiel störe. »Ja, das ist auch besser,« sagt Karl, »ich mag auch gar nicht mit Mädchen spielen, ich bin ja ein Junge. Ich hole lieber meine Soldaten. Aber wenn die dann schießen, und es knallt tüchtig poh! poh! poh! dann kann ich auch nicht helfen, wenn Eure Puppen bange werden, das sag' ich.«
Karl baut nun den ganzen Tisch voll, und der liebe Papa und Vetter Adolf helfen mit. Karl stellt alle seine Soldaten in Reih und Glied. Adolf baut von Karls Bausteinen einen Irrgarten, wo die kleinen bleiernen Soldaten sich einen Weg suchen müssen, um in die Mitte hineinzukommen, wo ihre Betten stehen, und sie schlafen dürfen. Da laufen sich die Soldaten immer fest, und Karl lacht viel, daß die kleinen Kerle so dumm sind und ihr Bett nicht finden können. Auf der andern Seite hat Papa einen schönen hohen Turm von Karten gebaut, das soll das Haus der Soldaten sein. Nun ist Karl sehr glücklich und tröstet sich schnell, als Papa und Adolf weggehen, um einen kranken Freund zu besuchen. Die kleine Elisabeth sitzt auf Mamas Schoß und spielt mit kleinen blanken Tellerchen und Kummen. Von Zeit zu Zeit kommen Marie und Lottchen und bitten sie um eine Kumme mit Möschen für die Puppen. Dann bringen sie die Puppen hin; die müssen »Danke, liebe Lisbeth!« sagen und Kuß geben. Das freut die Kleine unbeschreiblich. Einmal kommt Marie auch, um Möschen zu holen und stößt unversehens an den Tisch, und pautz! da liegt das ganze Soldatenhaus, und die halbe Kompagnie Soldaten fällt auch auf die Nase. Karl schreit darüber laut auf und schlägt der armen Marie ins Gesicht, die erschrocken zurückfährt und das Gesicht zum Weinen verzieht. Karl ist darauf ganz still und pflückt an den Fingern, weil er sich schämt. »Pfui, Karl, wie war das unartig!« sagt Mama. »Sie hat mir auch alles umgestoßen,« sagt Karl halblaut. »Sie hat es ja doch nicht gern gethan,« erwidert die Mutter, »und darfst Du sie darum schlagen?« – »Mama, laß mich hier bleiben,« bittet Karl, »ich will es auch gar nicht wieder thun.« – »Ja,« sagt die Mutter, »das muß aber auch ganz gewiß sein, sonst darfst Du nicht bei uns im Zimmer spielen.« – »Ich will gut sein,« sagt Karl, »aber wenn ich größer bin, spiele ich gar nicht in der Stube, dann kauf' ich mir ein Pferd und reite in die Stadt, und aus dem Thor und nach Lübeck und nach Amerika.« – »O, Du bist ein Großprahler,« sagt die Mutter, »sieh', Dein Schwesterchen sieht noch ganz traurig aus! Hast Du schon vergessen, was Du ihr gethan hast?« – Karl sieht sich um, streichelt und küßt die Schwester und sagt: »Ich thue es nicht wieder, aber ich habe nun gar kein Haus mehr für die Soldaten.« – »Ich will es Dir wieder aufbauen,« sagt die Schwester, und Lottchen kommt auch herzu und hilft mit. Die kleine Elisabeth hat, während Mama mit Karl gesprochen, mit ihren kleinen Fingerchen den süßen Rest aus Papas Kaffeetasse ausgetupft und abgeleckt. Nun zeigt sie Mama die kleinen klebrigen Finger und sagt: »Libeth hat Papa sein Zucker ausleckt, aber Libeth hat's nicht gern than, dann thut's nix, nicht, Mama?« – »O, Du böser Schelm,« sagt Mama, »was muß der kleine Leckerfinger dann haben?« – »Nicht Patsche, Mama,« sagt die Kleine, »nein, nein, nicht Patsche; Patsche thut au, au, Libeth gutes Kind sein, Kuß geben,« und sie hält den kleinen Mund hin. Mama küßt sie und sagt: »Libeth muß es aber auch gewiß nicht wieder thun. Lecken ist bös, lecken ist ba, ba.« – »Nein, nein,« versichert die Kleine, und sagt noch lange, während sie mit ihren Tellern spielt: »Nicht lecken, lecken bös, lecken ba, ba; nein, nein, nicht wieder thun.« Als es sechs Uhr schlägt, bringt Martha Licht und fragt, ob sie noch Brot holen solle. Lottchen sieht nach; der Korb ist ganz leer. Da muß Martha denn Brot für alle und Zwieback für die kleine Elisabeth holen. Weil Trina aber auch nicht zu Hause ist, so müssen die beiden kleinen Mädchen unten die Hausthüre zuketten und so lange in der Küche bleiben, bis Martha wieder da ist. Mama will in der Zeit die kleine Elisabeth ausziehen, aber Karl hat gar keine Lust mit nach oben zu gehen. Die Schwestern haben ihm das Haus viel schöner und höher gebaut, als es vorher war. Nun kann er durch alle Löcher das Licht sehen, das macht ihm gar zu viel Spaß. »Mama, laß mich hier,« bittet er, »ich will auch ganz still sitzen beiben.« – »Das geht nicht, mein Herzenskind,« sagt die Mutter, »sieh, Martha kommt bald wieder und bleibt beim Schwesterchen, dann kommst Du mit mir wieder herunter.« Karl sieht bald auf sein schönes Haus, bald auf die wartende Mutter, die schon zweimal gerufen hat: »Komm, Karlchen, komm, mein Kind!« »Na ja, Mama,« sagt er, »dann warte nur noch einen Augenblick!«, und schnell läuft er in die Ecke des Zimmers, faltet seine kleinen Hände und betet ganz andächtig: »Bitte, lieber Gott, paß doch auf, daß mein schönes Haus nicht umfällt. Amen.« Dann läuft er zur Mutter und geht fröhlich mit nach oben. Als er nach einer kleinen Weile mit seiner Mutter wieder herunterkommt, steht sein Haus ganz unversehrt; aber mitten vor dem Hause steht eine kleine hölzerne Kanone und dabei zwei kleine Kanoniere. Ganz verstummt bleibt er eine Weile stehen, dann schlägt er jubelnd in die Hände und ruft: »Nun, sieh' 'mal, Mama, der liebe Gott hat so gut aufgepaßt, daß er mir eine Kanone geschenkt hat.« – »Ei der tausend,« sagt die Mutter, »nun mußt Du doch auch sehen, wen der liebe Gott mit der schönen Kanone zu Dir geschickt hat.« Karl sucht mit den Augen umher. Lottchen und Marie lachen und sehen nach dem Ofen. Karl läuft dahin. Siehe, da sitzt der Vetter Adolf ganz versteckt in der Ecke! Nun springt der wilde Junge an ihm hinauf und bedankt sich und küßt ihn und will ihn gar nicht wieder loslassen.
*
Als nun die Abende immer länger werden, da bitten die Kinder den lieben Papa sehr, er solle ihnen doch jedem eine Stocklaterne schenken, um bei warmem Wetter abends damit in den Garten gehen zu können. Der Vater verspricht es und geht eines Tages mit den Kindern zu einem Mann, der jeden Herbst seinen kleinen Laden mit vielen bunten Lampen schmückt. Als sie aber Stocklaternen fordern, wird der Mann ganz traurig und sagt: »Liebe Kinder, nehmt Ihr denn nicht ebenso gern Hängelaternen? Seht, ich habe hier so hübsche, und eine Stocklaterne kostet mehr als vier Hängelaternen.« Die Kinder sehen einander ganz ernsthaft an, denn sie haben sich gar zu sehr gefreut, einmal eine Stocklaterne zu bekommen. Indessen erzählt der Mann dem Vater, wie schlimm es ihm ergangen. »Sehen Sie, lieber Herr,« sagt er, »im vorigen Jahre kannte man die Stocklaternen fast noch gar nicht, und weil sie so teuer waren, wollte auch niemand sie kaufen. Nun habe ich diesen Sommer, als meine Frau so krank war, daß ich doch nicht aus dem Hause gehen konnte, dreihundert Stück Hängelaternen gemacht, und dazu hat mir ein Bekannter zehn Thaler geliehen. Kaum bin ich damit fertig, so kommen eine Menge Stocklaternen von Nürnberg hier an. Alle Welt macht sie nach, und nun will kein Mensch mehr Hängelaternen kaufen, alle fragen nach Stocklaternen, und da ich die nicht habe, so gehen sie zu andern Kaufleuten. Was soll ich nun machen? Ich kann doch nicht neue Schulden machen, um das anzuschaffen, was ich zu den Stocklaternen brauche! Erst muß ich doch diese verkauft und meinem Freunde sein Geld wieder bezahlt haben.« – »Das ist wahr,« sagt der Vater; »Sie sind recht schlimm daran, mein lieber Mann. Nun, ich will das erst einmal zu Hause mit den Kindern überlegen, und dann sollen Sie morgen Bescheid haben, ob wir mit den Stocklaternen noch warten wollen und uns diesen Herbst mit Hängelaternen begnügen, oder ob das nicht angehen kann.« Bei Tische erzählt der Vater Mama und Adolf, wie schlimm es dem armen Buchbinder ergangen sei. Die Kinder hören genau zu und verstehen die ganze Geschichte nun erst so recht. Nach Tische haben die drei Ältesten sehr eifrig miteinander zu sprechen. Mariechen will dem armen Mann gern alles Geld aus ihrem Spartopf geben, wenn Papa es erlaubt: zwei Thaler und sechs blanke Schillinge. Lottchen will all' ihre Schulkameraden bereden, daß sie dem armen Mann Hängelaternen abkaufen. Karl meint: »Ich möcht' ihm am liebsten acht Schilling geben, und dann kann er mir dafür eine Stocklaterne machen!« Nun reden sie noch lange miteinander. Endlich sind sie sich einig. Elisabeth wird auch herzugerufen, und Karl fragt sie: »Hör', Libeth, willst Du nicht auch gern hell hell haben, so wie Karl und Lolo und Mie?« – »Ja gern!« sagt die Kleine und klopft auf die Brust. »Ja, aber dann mußt Du auch blanken Thaler geben, das thut Lolo und Mie und Karl auch.« – »Thaler geben, da, ein, zei, dei!« ruft Libeth und schlägt den Bruder in die Hand. »Ja, aber wirklichen Thaler von Weihnachten,« sagt Karl wieder, »das thust Du auch gern, nicht wahr, Libeth?« – »Ja, gern Weihnachten!« sagt die Kleine, hüpft hoch auf und klatscht in die Hände, denn sie denkt an alles, was Mama und die Schwestern ihr Schönes von Weihnachten erzählt haben. Darauf gehen sie zum Vater, und Libeth dünkt sich sehr groß, daß sie mit ihnen geht. »Nun?« fragt der Vater, »was habt Ihr Euch ausgedacht? Was soll aus dem Laternenkauf werden?« – »Wir wollen Hängelaternen nehmen!« ruft Karl schnell, »und dann das Geld aus dem Spartopf, und dann für die Stocklaternen, und dann Dein Geld, und die kleine Libeth auch!« – »So?« sagt der Vater, »das ist ja eine kunterbunte Geschichte, die muß Lottchen mir wohl erst einmal übersetzen.« – Lottchen und sagt: »Lieber Vater, Du wolltest uns ja jedem eine Stocklaterne schenken?« – »Ganz richtig,« sagt der Vater, »siehst Du, da sind acht Schilling für Dich, und acht Schilling für Marie, und acht Schilling für Karl!« – »Ach bitte, für Elisabeth auch,« sagt Lottchen, und die andern fallen ein: »Ja, bitte Papa!« Der Vater lacht, legt noch acht Schilling für Elisabeth auf den Tisch und fragt: »Na, und was nun weiter?« – »Nun wollen wir jeder gern noch acht Schilling aus unserm Spartopf dazu legen; denn, weißt Du wohl, wir wollten uns ja erst die Stocklaternen kaufen, und dann wollen wir für all das Geld Hängelaternen kaufen.«
»Ich muß aber auch zehn oder zwanzig Laternen haben, lieber Onkel,« sagt Adolf und legt einen preußischen Thaler dazu. »O, dann muß ich ja auch Lampen haben,« sagt die Mutter und legt noch zwei Thaler dabei. Nun wird das Geld aus den Spartöpfen der vier Kinder geholt und dann alles gezählt. Viermal acht Schilling, die der Vater den Kindern schenkt, und viermal acht Schilling, die die Kinder selbst bezahlen, dazu ein preußischer Thaler von Adolf und zwei von Mama, das sind vier Thaler und vier und zwanzig Schilling. »Nun,« sagt der Vater, »wenn Ihr denn so viel silberne Schillinge und Thaler zusammengelegt, dann muß ich wohl zwei goldene Thaler dazu legen.« – »Nein Papa«! ruft Karl, »Du brauchst es nicht, Du hast ja schon alle die acht Schillinge für uns dahin gelegt.« – »Laß Papa doch,« unterbricht Mariechen, »das ist ja wunderschön für den armen Mann, dann kann er recht viele Stocklaternen machen und die an andere Leute verkaufen.«
*
Am andern Morgen stehen die Kinder viel früher auf, als gewöhnlich, um noch vor der Schule zu dem Buchbinder gehen zu können. Der Vater bringt sie bis an die Hausthüre, und weil Karl es gern will, bleibt er draußen stehen und läßt die Kinder allein ins Haus gehen. Im Laden sehen sie eins das andre an und lachen, und keiner mag recht sagen, was sie eigentlich wollen. Endlich fragt der freundliche Mann: »Nun, liebe Kinder, was wollt Ihr haben?« – »Hängelaternen,« sagt Lottchen. »Ei, das ist ja wunderschön, da will ich Euch auch die allerschönsten aussuchen, die ich habe,« erwidert der Mann, »wie viel sollen es denn sein? Drei Stück?« – »Für elf Thaler,« sagt Mariechen und wird ganz rot. Aber der Mann wird auch ganz rot und fragt: »Was sagst Du, mein Kind? Für elf Thaler?« – »Ja, ja, ganz gewiß, Mann,« sagt Karl und zählt das Geld auf den Tisch. »Das ist ein goldener Thaler und das ist wieder ein goldener Thaler und das sind drei Thaler und das sind lauter Acht-Schillings! Und nun kannst Du für andere Leute Stocklaternen machen, nicht wahr?« Der Mann sagt nichts, er sieht das Geld an und die Kinder, und die hellen Thränen laufen ihm übers Gesicht. Das macht die Kinder ganz verlegen, und Karl sagt: »Ich will nur lieber Papa rufen!« geht hinaus und sagt: »Papa, der Mann weint, aber wir sind gar nicht unartig gewesen. Vielleicht will er seine hübschen Laternen gern behalten.« Der Vater kommt, giebt dem Mann die Hand und spricht mit ihm, und der Mann lacht und weint eins ums andere und erzählt, er habe tags vorher den lieben Gott so recht gebeten, er möge ihm doch beistehen, damit er so viel Geld verdiene, daß er und seine Frau und seine drei Kinder davon leben könnten. Da sei es ihm diesen Morgen auch so frisch und fröhlich zu Sinn gewesen, und als um acht Uhr die Hausthür geklingelt, da habe er zu seiner Frau gesagt: »Sollst sehen, nun schickt der liebe Gott Hilfe, so früh kommt sonst niemand, um zu kaufen!« Der Vater spricht noch eine Weile mit dem Mann. Dann gehen die Kinder zur Schule, und als sie mittags nach Hause kommen, da steht in der Stube ein ganz großer Korb mit 150 Papierlaternen, große und kleine. Das ist eine Freude! Jedes Kind bekommt nur eine, zehn werden an Nachbarskinder verschenkt, und der Rest wird auf dem Boden bewahrt, wozu? Das wissen die Kinder nicht. Wenn jetzt ein schöner warmer Abend ist, dann gehen Lotte, Karl und Marie mit ihren Laternen in den Garten. Papa und Mama und Adolf haben auch jeder eine, das sind also sechs. Elisabeth ist dann schon zu Bette, die kann noch nicht mit in den dunkeln Garten gehen. Zuweilen kommen auch noch kleine Schulkameraden und Nachbarskinder mit ihren Lampen dazu, und dann wird immer zuerst Diogenes gespielt. Das geschieht so: Ein Kind hängt seine Laterne an den großen Birnbaum, der mitten im Garten steht, und versteckt sich dann im Gebüsch oder hinter der Wassertonne oder im Gärtnerschauer bei dem Lamm oder wo es sonst will. Die andern zünden dann ihre Laternen an und suchen ihn. Das Spiel haben sie Diogenes geheißen, weil ein weiser Mann, der so hieß und in einer Tonne wohnte, auch einmal, aber am hellen Mittage, mit der Leuchte umherging und Menschen suchte. Zuweilen hängen sie auch alle Laternen in einen ganz jungen Kastanienbaum, der auf einem freien Platze steht, und dann machen sie einen Kreis und spielen Plumpsack oder Katz und Maus oder Dritten abschlagen.
*
Am Morgen des achtzehnten Oktobers erzählt der Vater den Kindern viel von dem großen Napoleon, der die ganze Welt glücklich machen wollte, aber ganz vergessen hatte, daß das niemand kann als Christus. Dieser Napoleon war so stolz, daß er meinte, wenn er nur über alle zu sagen habe, dann müßten auch alle ganz glücklich sein. Die Welt wollte das aber nicht glauben, und wenn Napoleon kam und sagte: »Ich will euer König und euer Kaiser sein!«, dann sagten sie: »Nein, wir brauchen Dich nicht, wir wollen unsern alten König behalten!« oder, wenn sie keinen hatten, so sagten sie: »Wir wollen frei bleiben!« Das nahm Napoleon aber sehr übel, und weil er klug war und viele Soldaten hatte, so kam er mit Gewalt, eroberte ein Land nach dem andern und plagte die Leute, die ihn nicht hatten zum König haben wollen, und war in kurzer Zeit der Beherrscher von vielen, vielen Ländern. Aber was geschah? Als die Leute sich von ihrem Schreck und ihrer Angst ein bißchen erholt hatten, da dachten sie daran, daß es Einen gebe, der mehr Macht hat, als Napoleon mit seinen vielhunderttausend Soldaten, und daß, wenn dieser Eine ihnen beistehe, sie den Napoleon wohl wieder wegjagen könnten aus all' den Ländern, die er erobert und unglücklich gemacht hatte. Da beteten sie zu diesem einzigen Helfer, flehten, daß Gott sie erretten und den großen Eroberer überwinden wolle. Und was that unser lieber Herr Gott? Er schickte einen so kalten Winter, daß die Franzosen, die ja gewohnt sind, in einem ganz warmen Lande zu leben, und die damals gerade in Rußland waren, es gar nicht aushalten konnten. Es brachen Krankheiten in der Armee aus, und eine ungeheure Menge Soldaten und Pferde starben. Der Kaiser flüchtete nun sehr schnell durch die Länder, die er früher erobert hatte, wieder in sein schönes Frankreich zurück und sammelte dort wieder aufs neue ein großes Heer Soldaten. – Alle die unterdrückten Völker hatten sich aber während dieser Zeit in treuer Liebe vereinigt und sich das Wort gegeben, einander beizustehen gegen diesen stolzen Räuber. In ihren Fahnen stand: »Gott mit uns!« und im Vertrauen auf diesen mächtigen Helfer treten sie nun kühn dem wieder in Deutschland eingefallenen Kaiser entgegen, gewinnen mehrere Schlachten, treiben ihn weiter und weiter, bis nach Frankreich, und weil sie bald merken, daß er sein Wort nicht hält, so kehren sie sich auch nicht daran, daß er verspricht, er wolle nie wieder in ihre Länder kommen; sie dringen in Paris ein, nehmen den Kaiser gefangen und bringen ihn endlich weit weg, nach der Insel St. Helena, die mitten im großen Ozean nicht weit von Afrika liegt. Da hat er noch viele Jahre als Gefangener gelebt, bis er endlich dort gestorben ist.
Der Vater erzählt den Kindern auch von der Schlacht bei Leipzig, die am siebzehnten, achtzehnten und neunzehnten Oktober gefochten ist, wo die Franzosen hatten fliehen müssen vor den verbündeten Heeren, und wo der Kaiser von Rußland und der Kaiser von Oesterreich und der König von Preußen auf dem Schlachtfelde niederknieten und dem lieben Gott dankten, daß er sie von dem mächtigen Feinde befreit hatte, und wie sie einander die Hände geben und versprechen, sie wollten einer dem andern beistehen in jeder neuen Not.
Auch erzählt der Vater von dem schrecklichen Weihnachten 1813, wo die Hamburger nachts aus ihren Häusern gerissen und in die kalte Kirche eingesperrt und morgens aus der Stadt hinausgetrieben wurden mit unbarmherziger Gewalt und Eile, so daß es vorkam, daß Vater und Mutter im Gedränge von ihren lieben Kindern getrennt und die einen zu diesem, die andern zu jenem Thore hinaus mußten.
Marie wird ganz traurig bei diesen Erzählungen, aber Karl meint: »Ich wollte, ich wäre mit dabei gewesen, ich hätte wohl einen Säbel kriegen wollen, und dann – na!« sagt er, ballt seine Faust und macht ein so entsetzliches Gesicht, daß der Vater sagt: »Das ist ja ordentlich zum Bangewerden. Ja, wenn Du die Soldaten nur angesehen hättest, so wären sie am Ende alle davon gelaufen!« Karl macht seine Augen noch immer größer und seine Lippen immer dicker und nickt bedeutend mit dem Kopfe.
*
Während der Vater erzählt, haben Mama, Adolf und die beiden Mädchen Kränze gewunden von Georginen, Astern und Eichenlaub. Nach Tische gehen nun alle nach dem Kirchhof, wo Bruder Edmund begraben ist, wo aber auch ein Denkstein für gefallene Krieger steht. Sie bekränzen den Stein und singen dabei:
Heut' erschall' die Siegesfeier,
Heut' zur Ehre der Befreier,
Heut' zu der Befreiten Lust.
Der Erinnerung heil'ge Kunde
Wohnt in jedes Deutschen Munde
Und in jedes Deutschen Brust.
Einen schönen Kranz hat Mama aber noch zurückbehalten, den hängen sie nachher über das kleine Kreuz, welches auf Edmunds Grabe steht, und singen dabei, während sie hingehen:
Brüderchen ist hingegangen,
Wo die Sterne hell und schön
An dem blauen Himmel hangen,
Kann wohl auf uns niedersehn.
Brüderchen geht nun spazieren
Mit den lieben Engelein,
Freundlich werden sie es führen;
O wie schön muß es da sein!
Wollen nun zum Grab uns bücken,
Drin des Bruders Hülle liegt,
Wollen es mit Blumen schmücken,
Die der Wind dann freundlich wiegt.
Und wenn wir zum Grabe treten
Mit den Blumen weiß und rot,
Wollen wir andächtig beten
Zu dem lieben, lieben Gott.
Nachmittags giebt's nun noch etwas Festliches einzurichten. Papa hat nämlich tags vorher eine große Anzahl kleiner Wachslichter gekauft. Dann wird in jede der 138 Laternen, denn zwei sind im Laufe der Zeit verbrannt, eins befestigt, und als es dunkel geworden ist, werden die Lichter angezündet und alle die Laternen im Garten aufgehängt. Hoch an den Bäumen und in den Büschen und um die Laube, ach, das ist eine Pracht! Das leuchtet nun rot und grün und gelb und blau zwischen den Blättern durch, und dazu blitzen viel tausend Sterne vom dunkeln Himmel herab, wie große Tautropfen, die in der Morgensonne funkeln. Adolf hat mehrere Freunde zu sich eingeladen. Mit denen setzt er sich in die große Laube und singt mit ihnen viele Lieder zum Lob der Freiheit, die Gott uns gnädig bisher erhalten hat. Manch Lied singen die Kinder mit; denn sie haben es dem Adolf schon abgehorcht. Karl aber springt von einer Laterne zur andern und wiederholt immer noch einmal: »Das ist doch viel hübscher als Stocklaternen!« – Dann flüstert er seinem Papa etwas ins Ohr. Der lacht und sagt: »Jawohl, gern.« Da läuft der Junge weg und kommt nach einiger Zeit mit dem Buchbinder wieder; der soll sich auch über die Laternen freuen, die er gemacht hat. Die Nachbarskinder sind auch mit Karl in den Garten gekommen; denn sie haben schon ein Weilchen gelauscht, was das Singen und Leuchten im Garten wohl bedeute. Mama erlaubt ihnen auch, da zu bleiben, wenn sie ganz leise im Garten mit ihren Laternen spazieren und den Gesang nicht stören wollen. Das thun sie auch, und nun huschen sie, ihr Lichtlein in der Hand, durch die dunkeln Gänge, daß es aussieht, als ob die Laternen ganz allein im Garten umherflögen. Nach einer Stunde wird der Himmel heller und heller, und die Papierlaternen verlieren ihren leuchtenden Schein. Marie merkt es zuerst, läuft nach dem Hügel und klatscht in die Hände, so stark sie kann, zum Zeichen, daß es etwas Besonderes zu sehen gebe. Alle Kinder versammeln sich da, und auf ihr Ah! und Oh! kommen auch die Großen herzu, ohne daß die Kinder es gewahr werden, und alle sehen stumm zu, wie der schöne Mond, gleich einer feurigen Masse, sich am Rande des Horizonts erhebt. Bald steigt er höher, wird kleiner und lichter, bis er als glänzend helle, silberne Kugel frei dahin schwebt und seine milden Strahlen durch den ganzen Garten gießt. Da fängt Mariechen an zu singen, und alle Kinder stimmen mit ein, das schöne Lied vom alten Claudius, das sie in der Schule gelernt haben:
Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.
Wie ist die Welt so stille,
Und in der Dämmerung Hülle
So traulich und so hold,
Wie eine stille Kammer,
Wo ihr des Tages Jammer
Verschlafen und vergessen sollt.
Wir stolzen Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder
Und wissen gar nicht viel.
Wie Schafe ohne Hirten
Vom Wege sich verirrten,
So irren wir auch oft vom Ziel
Gott, laß Dein Heil uns schauen,
Auf nicht's Vergänglich's bauen,
Nicht Eitelkeit uns freun!
Laß uns einfältig werden
Und vor Dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein.
Wollst endlich ohne Grämen
Aus dieser Welt uns nehmen
Durch einen sanften Tod;
Und wenn Du uns genommen,
Laß uns in Himmel kommen
Du unser Herr und unser Gott.
Als sie wieder vom Hügel herabkommen, sieht's mit den Lampen traurig aus. Die meisten Lichter sind ausgegangen, und die noch brennen, die sehen im hellen Mondschein so düster aus, daß sie schnell ausgemacht werden. Noch ein klein Weilchen wird im Mondschein spazieren gegangen und gesungen. Dann ruft Mama zum Abendbrot. Die Nachbarskinder müssen nach Hause gehen, und der schöne Festtag ist zu Ende.
*
Die ganze Woche, die nun kommt, ist für Karl eine wunderschöne, denn er muß immer denken: »Freitag ist mein Geburtstag.« Auch ist da eine sonderbare Geschichte geschehen. Karl hatte ein Rollpferd, das nach und nach die Rollen und den Schwanz und die Mähne und seine schöne braune Farbe verloren. Seit acht Tagen ist das Tier verschwunden. Karl sucht es überall, aber umsonst, es ist fort. Endlich sagt er zur Mama: »Nun glaube ich, ich weiß, wo mein Pferd ist; gewiß haben die kleinen Engel es geholt und haben es zum Christkind gebracht, und das macht ein Schaukelpferd draus.« »Ach nein, mein Herzensjunge,« sagt Mama, »das thut das Christkind gewiß nicht; das weiß wohl, wenn ein solch kleiner wilder Junge auf einem Schaukelpferd reitet, da würde er herunterfallen und Hals und Beine brechen; ich glaube, Dein Pferd ist auf die große Weide gelaufen bei Vater Martin und frißt da, bis es wieder ein glattes, braunes Fell und schöne, feste Beine und einen buschigen Schwanz und steife Ohren hat, und dann kommt es wieder.« »Glaubst Du zu meinem Geburtstag?« »Ja, ja, ich glaube,« sagt Mama. Karl reibt die Hände vor Vergnügen und läuft fort.
Einige Tage nachher ist Mama bei ihrer Kommode, Karl kommt herzugelaufen, als Mama gerade die Schieblade zuschiebt. »Süße Mama!« ruft er, »mach' noch einmal auf, ich habe da ein Bild gesehen mit springenden Pferden; sind die zu meinem Geburtstage?« »O, ja nicht,« sagt Mama, »ja nicht wollen wir hinein sehen. Was der Geburtstag bringt, darf man nie wissen, und wenn man's vorher sieht, holt das Christkind es wieder ab.« Karl denkt ein Weilchen nach und spielt umher, dann kommt er wieder und sagt: »Mama! Ich will mich da in die Ecke hinter den Schrank stellen und die Augen fest zuhalten, dann sieh Du in der Zeit 'mal nach, ob das Christkind die springenden Pferde noch da gelassen hat.« Karl thut es, Mama öffnet die Schieblade ein wenig und sagt: »Ich glaube, es ist noch da, ich habe so ein kleines, rundes, schwarzes Ding gesehen, ich glaube, das war ein Hufeisen aber mehr will ich lieber nicht nachsehen.« Karl lacht und freut sich und spielt weiter.
*
Am fünfundzwanzigsten Oktober ist Karls Geburtstag, und es ist ihm seit langer Zeit versprochen worden, wenn dann gutes, trocknes Wetter sei, so solle der Wein geerntet werden. Um fünf Uhr springt Karl schon im Bette auf und zieht den Vorhang weg, aber alles ist dunkel. Die Sonne schläft noch, und Karl kriecht auch noch einmal unter die Decke. Allein schlafen kann er nicht, er muß immer denken: »Mein Geburtstag ist da! Mein Geburtstag ist da!« So wie er nun hört, daß Mama sich im Bette rührt, läuft er schnell hin und klettert zu ihr ins Bett und erzählt ihr: »Heute ist mein Geburtstag, und nun bin ich sechs Jahr alt!« Mama nimmt den lieben Jungen in den Arm, betet mit ihm und dankt Gott, daß er ihm so lange Gesundheit und Leben erhalten hat. »Aber einmal habe ich doch die Masern gehabt,« sagt Karl. »Das hast Du,« sagt die Mama, »und denkst Du auch noch daran, wie Du garnicht folgsam warst, und der liebe Gott Dich doch behütet hat? Dafür mußt Du ihm noch recht vielmals danken.« »Ja, dafür danke ich Dir noch vielmals und bitte, dann laß mich auch nicht wieder krank werden, und ich möchte auch gar zu gern einmal einen kleinen Esel haben.« »Ja, Kindchen, aber vor allem wollen wir Gott bitten, daß er Dich recht fromm und folgsam und fleißig mache.« »Ja,« sagt Karl, »sonst krieg' ich auch niemals einen Esel.« Nun kommt auch Papa herein und segnet sein Söhnchen. Bald wachen die andern Kinder auch auf, und alle freuen sich, daß Karls Geburtstag ist. Als die Uhr sieben schlägt, da guckt die liebe Frau Sonne in ihrem goldenen Geburtstagsrock so lustig durchs Weinlaub ins Fenster, als wenn sie sagen wollte: »Nun sollt ihr einmal sehen, wie süß und saftig die Trauben alle geworden sind, weil ich sie immer so warm beschienen habe!« Auf einmal klingelt die Hausthür laut und lange. »Ei Karl,« sagt der Vater, »geh' doch einmal hinunter und sieh' wer da kommt, gewiß ist die Kette übergehängt.« Karl läuft hin, öffnet – und wer steht davor? Das liebe, lange vermißte Pferd! Karl schreit laut auf vor Freude und zieht es herein. »Ei, wie schön ist es aber geworden! Das Fell ganz glatt und ohne Löcher, die Ohren gespitzt und an den Füßen so schöne blaue Rollen!« Karl setzt sich gleich drauf und reitet mit großem Gepolter immer auf der Diele in die Runde, bis alle Hausgenossen zusammenkommen und das schöne Pferd bewundern. Dann geht's in die Frühstücksstube, denn alle sind nachgerade hungrig und durstig geworden. Auf dem Frühstückstische steht heute ein schöner Kuchen. Darauf brennen sechs kleine Lichter, und in der Mitte des Kuchens ist ein Schild von Zucker, drauf steht: Vivat Karl! Auf Karls Platze liegen viele Blumen: Astern, Georginen und was sonst noch im Oktober blüht. Außerdem findet er einen Malkasten, zwei Bilderbogen mit Soldaten und springenden Pferden, zwei Pinsel, einen goldenen und einen silbernen Rechenstift und ein Paar hohe Stiefel, denn Karl ist jetzt groß und kann nicht mehr über die Straße getragen werden, wenn es schmutzig ist.
*

Karl freut sich an allem, aber die Stiefel sind doch das Schönste. Er besieht sie immer von neuem, steckt die Arme hinein und geht so mit den Händen auf der Erde spazieren, stellt sie auf den Tisch, daß die Sonne sich drin spiegelt, und meint: »Wenn es doch diesen Nachmittag tüchtig regnete! Dann ziehe ich sie morgen an, nicht wahr, Papa?« »Ja, gewiß,« antwortet der, »das ist sehr notwendig, sonst könnte mein Junge ja nasse Füße bekommen. Ich würde in Deiner Stelle einmal zusehen, ob die Straße heute auch wirklich ganz trocken ist.« Karl springt ans Fenster, sieht rechts, sieht links, kann aber nichts Nasses entdecken. »Ich kann hier nicht recht sehen,« sagt er, »ich will einmal hinuntergehen.« Nun geht er zur Hausthüre hinaus. Nichts Nasses ist zu sehen, als der Rinnstein; aber sieh', welch Glück! ein bißchen weiter hin, gerade da, wo er vorbeigehen muß, kommt eine Frau aus der Hausthüre und gießt einen ganzen Eimer schmutziges Wasser auf die Straße. Pflastersteine liegen nicht all zu dicht, und eine große Menge Wasser bleibt in einer Pfütze stehen. Jubelnd und händeklatschend springt der Kleine die Treppe hinan. »Papa,« ruft er, »da ist ein großer Schmutz und dann noch der lange Rinnstein!« »I, da mußt Du ja durchaus die hohen Stiefel anziehen. Hole nur geschwind Papas Stiefelhaken aus dem Waschtisch, denn mit den Fingern kann man so große Stiefel gar nicht ordentlich festhalten.« In zwei Minuten hat Karl die Haken geholt, und nun muß Papa sich sehr anstrengen, um dem Jungen die hohen Stiefeln anzuziehen. Nun ist alles fertig. Karl will gern die schönen weißen Hosen in die Stiefel stopfen, aber Papa und Mama sagen, das gehört sich nicht so. »Das ist sehr schade, denn nun sieht man die schönen Stiefeln nur halb.« Aber tüchtig laut schallt es, wenn er damit in der Stube auf- und abgeht, und stampfen kann er damit, wie ein preußisches Husarenpferd. Die kleinen Mädchen sehen ihn ganz schüchtern und erstaunt an, und er zieht die Stirn hoch auf und macht den Mund sehr spitz, weil er gern sehr ernsthaft sein will und doch das Lachen nicht lassen kann. »Aber Karl,« sagt Papa, »Du solltest doch einmal zusehen, ob der Schmutz auch noch da ist.« »Ja, das thue ich,« sagt Karl und läuft mit großem Getrampel die Treppe hinunter. Martha kommt aus der Küche und ruft: »Was ist da? Was ist da?« »Meinst Du, da kommt ein Husar?« fragt Karl. »Das bin ich und meine Stiefeln, siehst Du wohl?« Nun geht Karl zur Hausthür hinaus. Er sieht sich rings herum, besieht dann die Stiefeln, zieht die weißen Hosen immer wieder und wieder etwas in die Höhe. Dann besieht er die Sohle, geht ein paar Schritte und besieht wieder die Sohle, reibt sie mit der Hand wieder sauber und geht dann bis zur Pfütze. Mit der Spitze tritt er ins Nasse, besieht dann wieder die Sohle und tritt ein bißchen weiter hinein. Einige Mal versucht er's noch, dann sieht er sich rechts und links um, hält die Hose mit beiden Händen fest, daß sie nicht herunterrutschen kann, und spaziert durch die Pfütze. In der Mitte ist's aber doch tiefer, als er gedacht hat. Das schmutzige Wasser läuft über den Stiefel, und der ganze Stiefel ist schmutzig und gar nicht blank mehr. Karl macht ein sehr ernsthaftes Gesicht, dann zieht er sein reines Schnupftuch aus der Tasche und reibt die Stiefel damit wieder ab. Aber nun hat er die Hose losgelassen und aus Versehen auch mit abgewischt; nun ist die voll schwarzer Flecken und Streifen, und das Schnupftuch ist ganz schwarz. Karl sieht ganz traurig aus und besinnt sich. Dann läuft er nach dem Rinnstein und fängt an, sein Schnupftuch wieder auszuwaschen. Aber der Grund des Rinnsteins ist schwarzer Schlamm, und Hose und Schnupftuch werden schlimmer, als sie vorher gewesen. Da fängt der arme kleine Junge bitterlich an zu weinen. Mama hat aber schon eine Weile dem kleinen Helden zugesehen. Die nimmt ihn nun in den Arm und tröstet ihn. Die Stiefel werden schnell getrocknet, und Martha giebt sich viel Mühe, sie wieder blank zu putzen. Trina holt ein reines Höschen und Schnupftuch, und so ist der Kummer bald vergessen. Karl geht fröhlich mit den kleinen Mädchen zur Schule und zeigt seinen Kameraden mit großem Stolz die hohen Stiefel.
*
Jakob, der Gärtner, kommt um zwei Uhr, sobald das Mittagsessen verzehrt ist, mit einer hohen Leiter und zwei oder drei Gartenscheren. Mama sucht auch an Scheren und Körben zusammen, was sie im Hause nur auftreiben kann. Jeder bekommt nun eine Schere in die rechte Hand und einen Korb an den linken Arm. Alle dürfen schneiden und in die Körbe legen, aber keiner darf sich bücken, um zu schneiden, denn die niedrigsten schneidet die kleine Elisabeth, die auch eine ganz kleine Schere in die Hand bekommen hat, mit der sie sich keinen Schaden thun kann. Erst pflückt die Kleine immer die einzelnen Beeren ab, und wenn dann der Saft herauskommt, dann steckt sie dieselben ins kleine Mäulchen und sagt: »Die ist naß, die muß Libeth aufessen.« Einige Mal läßt Mama das geschehen, dann sagt sie aber: »Libeth, nun nicht mehr naschen, alle ins Körbchen legen, sonst darf Libeth nicht schneiden.« Als die Kleine sieht, daß Mama ganz ernsthaft dabei aussieht, da nimmt sie keine mehr in den Mund, sondern schneidet ganz ordentlich, und wenn sie es nicht recht kann, so helfen Marie und Lottchen ihr. Papa und der Gärtner stehen auf hohen Leitern und schneiden die obern Trauben ab. Sie haben ihre Körbe an lange Bindfäden gebunden; sind sie nun mit Trauben gefüllt, dann lassen sie sie hinunter. Mama nimmt die Trauben heraus und legt sie in einen großen Korb. Dann werden die Körbe wieder hinaufgezogen. Alle Kinder ziehen mit und singen:
Auf und nieder,
Hin und wieder,
Bring' uns schöne Trauben wieder.
Schmecken süß,
Schmecken süß,
O, das weiß ich ganz gewiß.
Als alle Trauben abgenommen sind, werden sie ins Haus getragen und auf Tische ausgebreitet, die blauen zusammen, die grünen zusammen, die großbeerigen zusammen, die kleinbeerigen zusammen, jede Sorte für sich allein. Dann wird ein Körbchen voll gepackt und schön mit Blumen und Blättern verziert für Tante Emilie, eins für die Lehrerin der Kinder, eins für den Prediger und eins für den guten Doktor, der ihnen Medizin verordnet, wenn sie krank sind. Einen Korb voll bekommt auch der alte Gärtner Jakob für sich und seine Familie. Die andern Trauben werden dann erst genau ausgesucht, probiert und bewundert. Nun holt Papa Siegellack und jede ganz gute Traube bekommt am Ende des Stengels einen Lackknopf. So gegen das schnelle Verderben geschützt, werden sie auf Fäden gezogen und auf der Obstkammer aufgehängt, um bewahrt zu werden. Die Kinder müssen bei all' diesen Geschäften viel helfen, und selbst die kleine Elisabeth ist ganz müde vom Schneiden und Tragen und Binden und Treppenlaufen, als die Abendbrotzeit herankommt.
*
Einmal kommt Karl zu Mama in die Stube gesprungen und erzählt: »Mama, unten im Gras liegen ganz viele kleine Mützen und ganz viele kleine Hemden, soll die Mariens Puppe haben?« Mama lacht und sagt: »Wenn Du ganz artig bist, so bringen die lieben Engel Dir vielleicht ein kleines lebendiges Püppchen.« – »Ich möchte aber lieber ein Pferd haben,« sagt Karl. – »Lieber als einen kleinen Bruder, der mit Dir Pferd spielen kann?« fragt Mama. »Wollen die Engel unsern Edmund wiederbringen?« fragt Karl verwundert. »Unser Edmund ist selbst ein Engel; der kommt nicht wieder zu uns, aber einen neuen, ganz kleinen Bruder, oder auch ein Schwesterchen sollt Ihr haben,« sagt Mama. »Freust Du Dich nicht darüber?« »Ja,« sagt Karl, »aber ist er denn erst so ganz klein, wie die kleine Mathilde bei dem Gärtner? Dann mag ich ihn eigentlich nicht gern leiden, dann kann er ja nicht laufen und nicht sprechen, und man kann ihn gar nicht recht anfassen.« – »Aber wenn's doch Dein Brüderchen ist, was der liebe Gott Dir schenkt, da wirst Du es doch gewiß recht sehr lieb haben,« sagt Mama. »Ja, das thue ich auch,« sagt Karl, »er soll auch manchmal Kutscher sein, aber manchmal muß ich auch Kutscher sein, nicht, Mama?« Das verspricht ihm die Mama, und nun läuft er wieder in den Garten und erzählt an Marie und Lottchen, was Mama ihm gesagt hat, und die freuen sich viel mehr darüber, als der wilde Karl, und bitten den lieben Gott alle Tage, er solle doch die lieben Engel mit dem kleinen lebendigen Püppchen schicken.
Als nun alle Blätter auf den Bäumen rot und gelb geworden und vom Wind herunter geweht sind, da ziehen die Eltern wieder zur Stadt und wohnen in dem warmen Winterhause. Karl ist nun sehr bange, daß die Engel das am Ende gar nicht wissen und den kleinen Bruder draußen ins Gras legen, weil das Haus geschlossen ist. Marie meint aber, sie können es wohl vom Himmel sehen, wo die kleine Wiege stehe.
Sie hat auch ganz recht gehabt; denn als die Kinder einige Tage nachher Mama guten Morgen sagen wollen, da sagt der Papa: »Ja, Ihr könnt wohl hereinkommen, aber Ihr müßt sehr sachte sein, denn das kleine lebendige Püppchen ist nun da, und es ist wirklich ein Brüderchen.« Mama liegt im Bette und hat den kleinen Jungen im Arm. Karl muß viel lachen, daß der Bruder so schrecklich klein ist und doch wirklich kleine Finger hat und kleine Nägel daran und ordentlich einen Mund und eine kleine Zunge drin, womit er lecken kann, und wie er so kleine komische Fratzen macht und sich reckt und streckt. Elisabeth faßt das Brüderchen auch ganz sachte an und streichelt es; als der Kleine aber an zu schreien fängt, da läuft das kleine Mädchen fort und ruft: »Libeth is bange, Libeth is bange!« und will gar nichts mehr von dem kleinen Bruder wissen.
*
Am zweiten Sonntag wird das kleine Brüderchen getauft. Da kommt der Pastor in seinem langen Pastorenrocke und mit dem großen weißen Kragen. Dem Brüderchen hat Mama ein schönes weißes Kleidchen angezogen und eine ganz neue Mütze aufgesetzt; so hübsch ist er noch nie angezogen gewesen. Mama sagt, es sei auch Brüderchens bester Festtag. Mehrere Leute, die Papa und Mama lieb haben, sind auch gekommen und wollen den schönen Festtag mitfeiern. Als der Pastor angekommen ist und alle begrüßt hat, da nimmt Tante Emilie das Brüderchen in ihren Arm und Onkel Karl, Vetter Adolf und noch ein Herr stellen sich daneben hin und der Pastor ihnen gegenüber. Nun singen alle:
O Vater, nimm zum Bunde
Dies Kindlein gnädig auf!
Ihm leuchte diese Stunde
Im ganzen Lebenslauf!
Sohn Gottes, sieh', wir legen
Dies Kindlein an Dein Herz.
Du wirst es liebend pflegen
In Freuden und im Schmerz.
O Geist der Wahrheit, bilde
Sein Herz für Heiligkeit;
Durch Wahrheit, Reinheit, Milde
Leit' es zur Seligkeit!
Dreieiniger erhöre,
Um was wir innig flehn!
Herr, in der Engel Chöre
Laß dieses Kind eingehn!
Drauf spricht der Pastor davon, wie lieb der Herr Jesus alle kleinen Kinder habe, und wie viel er für sie gethan und ihnen geschenkt habe, und wie er sie wieder lebendig und selig machen wolle in seinem schönen Himmel, wenn sie einmal gestorben sind. Dann sagt der Pastor den großen Leuten, daß sie dafür sorgen sollen, daß das Kindchen den lieben Heiland kennen lerne und lieb habe, wenn es größer wird. Zuletzt muß Tante Emilie dem Kinde die Mütze abnehmen, und der Pastor sagt, daß der Herr Jesus befohlen habe, daß alle, die ihm angehören und seine Jünger sein wollen, sich taufen lassen sollen, und so wie Gesicht und Hände und Hals und Brust rein werden, wenn man sie mit Wasser wasche, so solle die Seele rein werden von aller Sünde durch das Wasser der heiligen Taufe, wenn man dem Worte Gottes und seiner Gnade glaube. »Zum Andenken an seine heilige Taufe,« so spricht der Pastor weiter, »soll das Kind den Namen Roland bekommen«. Und nun endlich kommt die Hauptsache. Der Pastor schöpft mit seiner hohlen Hand Wasser aus dem silbernen Taufbecken, welches auf einem kleinen, mit Blumen bekränzten Tischchen vor ihm steht, begießt damit dreimal das Köpfchen des kleinen Bruders und sagt: »Roland, ich taufe Dich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes.« Nun betet der Prediger und alle mit ihm, daß der liebe Heiland das Kind behüten wolle. Dann singen sie:
Liebes Kind, getauft bist Du,
Gehörst nun dem Herrn Jesus zu;
Den Namen hat er Dir gegeben,
Den Du trägst Dein ganzes Leben.
Daran will er Dich erkennen,
Will sein liebes Kind Dich nennen,
Will Dich rufen, will Dich lehren,
Will das Böse von Dir wehren,
Führt Dich gar dem Himmel zu.
Liebes Kind, getauft bist Du.
Und alle küssen den lieben kleinen, getauften Roland. Nachher wird sehr schön aufgeputzter Kuchen herumgegeben, und die Kinder bekommen auch davon. Die großen Leute trinken Wein dazu und trinken des kleinen Rolands Gesundheit. Die Kinder laufen von einem zum andern und sind sehr vergnügt, denn sie mögen gern, wenn viel Leute da sind und mögen auch gern Kuchen.
*
»Mama! Mama!« ruft Mariechen durchs Haus, »wo bist Du, meine süße Mama?« – »Hier bin ich, mein liebes Kind,« antwortet Mama aus der Küche, »was ist Dir denn begegnet, daß Mama so schnell helfen soll?« – »Ach, Mama, ich esse eben mein Brot, und als ich abbeiße, da thut es mir im Munde ein bißchen weh, aber nur ein ganz klein bißchen, und da meine ich, ich habe eine Perle im Munde, und als ich es herausnehme, da ist es ein Zahn, und hier ist das Loch. Aber ich kann es wirklich nicht helfen, Mama, das Brot war gar nicht sehr hart.« – »O Du Mäuschen, o Du Mäuschen,« sagt die Mutter, »wenn Du Dir nun jeden Tag einen Zahn ausbeißest, wie willst Du dann am Ende Dein Brot essen?« – Marie sieht die Mutter an und weiß nicht, ob es eine ernsthafte oder eine Spaßgeschichte ist, daß sie den Zahn verloren hat. Aber Mama lacht und küßt ihr kleines Mädchen und sagt: »Sei nur ohne Sorgen, Du bekommst bald ein neues Zähnchen, viel stärker als das erste. Dir werden noch viele von Deinen Zähnen ausfallen, aber für jeden bekommst Du einen stärkern wieder. Die kleinen Zähne, die Du bis jetzt gehabt hast, das sind Milchzähne. Für Milch und Brot und Gemüse und Kartoffelmus sind sie stark genug, aber Du bist nun ein großes Mädchen und willst Fleisch essen und harte Rinde beißen, dazu schenkt Dir nun der liebe Gott neue starke Zähne.« – »Das ist nett,« sagt Mariechen, »aber wo soll ich mit meinem Milchzahn bleiben?« – »Den wollen wir einsiegeln und ihn diesen Mittag an Papa geben, der soll einmal lange raten, was in dem Papier ist.« Karl kommt herzu gesprungen und muß immer lachen, wenn Mariechen den Mund aufmacht, und er das Loch sieht, wo der Zahn gesessen hat. »Nun hat Deine Mauer einen Thorweg,« sagt er, »nun können alle Feinde in Deinen Mund kommen.« – »O,« sagt Mariechen, »ich halte die Zunge vor, dann können sie doch nicht durch.« Mittags findet Papa das Papier, und Mariechen hält den Mund sehr fest zu, damit Papa das Loch nicht sehe. Als er das Papier aber öffnen will, ruft Karl: »Das geht nicht, Papa, erst mußt Du raten, was drin ist!« – »I, was sollte da drin sein?« sagt Papa, und besinnt sich. »Wohl ein kleiner Vogel?« – »Nein, Papa, der ist viel zu groß!« – »Ach, das ist wahr, vielleicht ein Eichhörnchen?« – »Das ist ja noch größer.« – »Vielleicht ein Schmetterling?« – »Nein, gar nicht, der würde ja zerdrückt werden, es ist etwas von Marien.« – »I, es kann ja doch nicht Mariens kleine Puppe sein?« – »Nein, Papa, von Marie selbst.« – »Dann ist's gewiß eine von ihren Locken.« Marie schüttelt mit dem Kopfe und kneift die Lippen fest zusammen. »Nun weiß ich's,« sagt Papa, »es ist ihre Zunge, daher hat sie den ganzen Mittag auch gar nicht sprechen können.« Darüber muß Marie sehr lachen, steckt ihre rote Zunge aus und sagt: »Doch nicht!« Papa hat aber das kleine Loch gesehen und sagt: »Aha, nun merk' ich's! Mein Töchterchen hat mir einen Zahn hier eingewickelt; aber wer hat Dir den ausgebrochen?« Die Kinder lachen und klatschen in die Hände. Marie erzählt die Zahngeschichte, und das kleine weiße Zähnchen geht nun von Hand zu Hand. Mama nimmt es dann zu sich, bewahrt es und läßt späterhin eine kleine Goldeinfassung drum und eine kurze Litze von ihrem Haar dran machen, das wollen sie mitnehmen, wenn sie im Sommer nach Cuxhaven reisen und es der alten Großmutter schenken, die da wohnt: die soll es als Lesezeichen in ihre großgedruckte Bibel legen. Papa aber sagt: »Ja, ich habe immer gehört: für den ersten Zahn, den ein Kind verliert, muß Papa einen Schilling bezahlen! Muß ich denn das auch?« – »Ja, Papa, ja, Papa!« rufen alle Kinder, und Karl reißt und bricht an allen seinen Zähnen herum, ob er nicht einen loskriegen könne, aber es geht nicht, sie sitzen noch zu fest. Marie bekommt allein einen Schilling; aber sie kauft sich eine süße Apfelsine dafür, die sie mit den Geschwistern teilt.
*
Bald nach Ostern wird das Wasser sehr warm und schön. Die Bäume werden grün; die Pfirsichen, Aprikosen und Kirschen blühen. Vierzehn Tage später werden nach und nach auch die Äpfel-, Birnen- und Pflaumenbäume mit ihrem Blütenschmucke gekrönt. Als Pfingsten kommt, ist das Landhaus schon lange bezogen. Klein Roland wird im Garten herumgefahren, und die andern Kinder bleiben, wenn sie nicht in der Schule sind, den ganzen Tag im Freien, spielen und laufen und freuen sich, daß sie nicht, wie vor zwei Jahren, im Bette liegen müssen und die Masern haben. In kurzem werden auch die Kirschen reif und die Kinder singen:
Wir schmausen so gerne, die Vögel und ich,
Die Kirsche, die Pflaume;
Sie hängen am Baume,
Die eine für sie, die andre für mich.
Wir sorgen nicht gerne, die Vögel und ich.
Was heute bescheret,
Wird heute verzehret;
Was kümmert es sie, was kümmert es mich!
Wie es nun einmal ein recht schöner Julitag ist, da geht Karl zum ersten Male mit Papa von der Schule aus nach der Elbe, um da zu baden und schwimmen zu lernen. Karl hat sich lange darauf gefreut. Er ist gewohnt, morgens im kalten Wasser herumzuplätschern, aber nur in einer Wanne; in der großen Elbe war er noch nie. Ein klein bißchen ängstlich kommt es ihm doch vor, daß er, der kleine Mensch, in das große, weite Wasser hinein soll. Als er ausgezogen ist und nun wirklich hineinspringt, da kann er sich nicht helfen, daß er einmal aufschreit, denn er hat gar keine Luft, und das grobe Wasser läuft ihm in die Augen und in die Ohren und in die Nase und in den offnen Mund. Nun muß er spucken und niesen und pusten und nach Luft schnappen, daß alle andern, die da schwimmen und baden, viel über seine närrischen Fratzen lachen müssen. Dazwischen schreit er aber immer in abgebrochenen Tönen: »Es – ist – wunder – schön! – es – ist – ganz – wunder – schön!« Von nun an badet er jeden Tag mit Papa, und jeden Tag geht es besser, jeden Tag macht es ihm mehr Vergnügen. Bald lernt Karl auch schwimmen. Anfangs wird er an einem Gurt gehalten, aber nach einigen Wochen ist das nicht mehr nötig, und er schwimmt so frisch und sicher im Wasser umher, als wenn er sein Leben lang ein Fisch gewesen wäre.
*
Im August ist Trinas Geburtstag. Karl hat sie lieb und möchte ihr so gern etwas schenken, aber er hat kein Geld, und der Geburtstag ist schon übermorgen. Marie will ihm einen Schilling schenken, aber das will er nicht. »Nein,« sagt er, »dann schenke ich es ja nicht, dann schenkst Du es ja.« – »Dann suche Du Raupen von unserm großen Aprikosenbaum, ich helfe Dir mit; Du weißt wohl, für hundert Stück giebt uns Papa einen Schilling.« Der Einfall gefällt Karl. Aber nun schlafen die Raupen, er muß warten bis zum andern Morgen. Abends liegt er lange im Bette und wacht; dabei hat er immer die Finger im Munde und ächzt, als wenn er eine große Arbeit vorhätte. Trina fragt ihn, ob er Zahnweh habe. Das verneint er, liegt ein kleines Weilchen stille, und dann geht das Ächzen und Arbeiten von neuem los. Endlich tritt Martha einmal ans Bette und fragt: »Junge, was hast Du denn eigentlich vor?« – »Sch!« sagt er, »er wackelt schon, ich glaube, es geht bis morgen, wenn ich die ganze Nacht dran reiße.« – »Was reißest Du denn?« fragt Martha ganz leise, damit die andern Kinder nicht aufwachen. »Ich reiß' an meinem Zahn, denn wenn ich ihn herauskriege, so giebt mir Papa morgen einen Schilling. Dann kann ich Trina was zum Geburtstag schenken.« – »Ja, aber wenn Du nun nicht bald schläfst, dann wirst Du morgen die Zeit verschlafen, und dann kannst Du keine Raupen absuchen.« – »Das ist wahr,« sagt Karl, »na, vielleicht fällt der Zahn morgen von selbst aus. Dann will ich nur lieber einschlafen.« Damit legt er sich auf die andere Seite und in fünf Minuten schnarcht er. Am andern Morgen früh vor halb sechs Uhr wacht er auf, läßt sich ankleiden und wandert dann in den Garten auf die Raupenjagd. Marie kommt bald nach und hilft ihm, und alle Raupen werden genau gezählt und in einen großen Topf gethan. Aber mehr wie vierundsiebzig können die Kinder nicht finden. Sie sehen wohl noch welche, aber die sind höher, als sie reichen können. Mit ganz weinerlichem Gesicht kommt Karl zum Papa und bittet mit sehr kläglichem Tone: »Darf ich nur einmal auf die Leiter steigen?« – »Da könntest Du leicht fallen. Warum wolltest Du das, mein Karl?« fragt Papa. Da bricht der kleine Bursche in lautes Weinen aus und sagt: »Ich will so schrecklich gern einen Schilling verdienen, und meinen Zahn kann ich nicht loskriegen, und die letzten Raupen von hundert sitzen so hoch, daß ich nicht ankommen kann.« – »Ei, seit wann ist denn mein Karl so geldgierig geworden, daß er sich für einen Schilling die Zähne ausbrechen und die Glieder entzwei fallen will?« fragt Papa ganz verwundert. Karl vertraut ihm nun unter fortwährendem Weinen an, daß er Trina so gern zu ihrem Geburtstag was schenken wolle, aber nicht was von Papa oder von Mama oder von Marie, sondern von sich selbst. »Nun,« sagt der Vater, »dann will ich Dir noch was sagen, ich will Dir die sechsundzwanzig Raupen noch dazu suchen.« »Ja,« sagt Karl, »oder nimm mich auf den Arm, Papa, dann such' ich sie selbst, das ist noch besser.« Das thut Papa, und so ist der Schilling bald verdient, und niemand vergnügter als Karl. Nun wird Martha gefragt, was Trina wohl gern haben möge. Nähnadeln oder Kopfnadeln findet Karl langweilig. »Bonbons?« – »Nein, das ist nichts Ordentliches.« – »Leinenband?« – »Ach, das sieht so weiß aus.« – »Zwirn?« – »Das ist nun gar langweilig.« – »Eine bunte Nadeldose?« – »Ja, das ist nett, die kaufe ich! Hat der Krämer die zu Kauf?« »Nein, Mamsell Möller da drüben im Eckhause.« – »Das ist schade.« – »Schade? Warum.« – »Der Krämer giebt uns immer Bonbons, wenn wir etwas kaufen, das thut Mamsell Möller nie.« – »Aber Du willst ja was für Trina haben und nicht für Dich!« Karl besinnt sich einen Augenblick, dann sagt er: »Ja da, dann könnte ich aber den Bonbon auch an Trina schenken.« – »Das ist wahr,« sagt Martha, »aber von Bonbons möchten Trina nachher doch nur die Zähne weh thun.«
Als nun Karl und Marie aus der Schule kommen, da gehen sie bei Mamsell Möller vor und fragen nach Nadeldosen. Eine rote ist da mit silbernem Rand, die findet Karl für wunderhübsch, aber sie kostet zwei Schilling, und die Dosen zu einem Schilling mag er gar nicht leiden. Er besinnt sich, fühlt noch einmal seinen Zahn, aber der ist fest. Raupen sind auch nicht mehr da. »Ich will mich noch einmal besinnen, ob ich nicht noch einen Schilling verdienen kann,« sagt er, »und dann komme ich wieder und kaufe die hübsche Dose.« – »Thu' das, mein Junge, ich will sie für Dich aufbewahren,« sagt Mamsell Möller, und die beiden Kinder gehen nach Hause.
*
Nach Tische ist Karl nirgends zu sehen. Mama hat schon ein paarmal gefragt: »Wo ist denn Karl?«, aber niemand hat ihn gesehen. Da hört die Mama seine kleine helle Stimme in der Küche; sie geht hin. Da steht er. Seinen Sammetkittel hat er ausgezogen; der hängt über der Stuhllehne. Dafür hat er ein großes weißes Halstuch von Martha um und eine lange leinene Schürze vor. In der linken Hand hat er einen Schuh und in der rechten Hand eine Bürste, damit bürstet er den Schuh, so stark er kann. Martha steht dabei, reinigt die Schuhe vom Schmutz und schmiert sie mit Wichse ein. Sie winkt Mama, daß sie sich nichts solle merken lassen, und diese bleibt in der Thür stehen. »Wie viel haben wir noch nach, Martha?« fragt Karl. »Noch drei Stiefel, einen von Marie und Deine beiden.« »Auch noch große Schuhe?« – »Nein, damit sind wir fertig.« – »Das ist auch nur gut, die kleinen werden viel schneller fertig. Ist dieser schon blank genug?« – »O ja, nun nimm diesen.« – »Habe ich nun schon einen halben Schilling verdient?« – »Ja, schon mehr.« – »Meine Stiefel brauche ich eigentlich nicht zu bürsten, die brauchen morgen nicht blank zu sein.« – »Morgen nicht? Auf Trinas Geburtstag? Und dann könnte ich Dir ja keinen Schilling geben; wir haben ja gesagt: für acht Schuhe einen Schilling.« – »Das ist auch wahr. Siehst Du, dieser ist auch schon wieder fertig!« »Aber Deine Schuhe sind doch viel blanker, als meine.« – »Ich bürste Deine morgen früh noch ein bißchen über, dann sind sie ebenso schön, wie meine. Du, aber das Bürsten ist ordentlich eine Arbeit, nicht Du?« »Ja wohl, und Du bist nun ein ordentlicher Arbeitsmann.« – »Ja, und wenn ich fertig bin, kriege ich ordentlich mein Geld. Was dann wohl Mamsell Möller sagt? Die denkt gewiß gar nicht, daß ich Geld verdienen könne. So, nun gieb mir den letzten! Aber dann mußt Du mir auch meinen Kittel wiedergeben.« – »Ja, der hängt da, aber vorher mußt Du Dich tüchtig waschen. Sieh 'mal, wie Deine Arme schwarz sind! Die hast Du immer ein bißchen mit gebürstet.« – »Muß ich mich denn mit grüner Seife waschen?« – »Ja wohl, und mit warmem Wasser.« – »Sonst werde ich gar nicht wieder rein?« »Nein, anders nicht.« – »Ist dieser nun fertig?« – »Nein, sieh'! Diese Seite hast Du noch ganz vergessen.« Karl seufzt und bürstet weiter. »Du, Martha, ich mag doch kein Schuhputzer werden.« – »Nein? Erst fandest Du es ja so nett.« – »Ja, einen Schuh, aber immer kratz, kratz, kratz, und immer schwarz und immer, daß der Arm weh thut.« – »Aber nun ist er auch schön gebürstet; nun bist Du fertig. Jetzt komm nur her, daß wir uns waschen.« Karl jubelt und lacht, daß das Wasser so schwarz wird, und daß die Seife so schäumt, zieht seinen Kittel wieder über, und nimmt mit stolzer Miene seinen wohlverdienten Schilling in Empfang.
Mit leuchtenden Augen läuft er nun zu seiner Mama und ruft: »Mama, ich habe mir mit Schuheputzen einen Schilling verdient, kann ich nun nach Mamsell Möller gehen und die rote Dose mit Silber kaufen?« – »Du? Schuhe putzen?« fragt die Mutter, »ach warum nicht gar, Du kannst ja keine Schuhe putzen.« – »Doch, Mama, doch!« ruft er, läuft schnell in die Küche, holt Mariechens Stiefel und zeigt sie. »Die habe ich geputzt,« sagt er, »ich selber, Du kannst Martha fragen.« – »Ei, das ist ja prächtig,« erwidert die Mutter. »Martha hat doch so viel zu thun, dann kannst Du ja in Zukunft alle Morgen unsre Schuhe putzen.« – »Ach nein, meine Mama, viele Schuhe mag ich gar nicht gern putzen, und wenn ich nur die Dose kaufen kann, so brauche ich auch keine Schillinge mehr.« – »Du solltest auch keine Schillinge dafür haben, Du solltest die Schuhe putzen, weil Du uns so lieb hast.« Karl wird stutzig, dann sagt er: »Darum will ich Euch lieber einen süßen Kuß geben.« – »So gieb denn her,« sagt Mama, »und dann lauf' und hole Deine schöne Dose.« Karl thut's und läuft darauf den ganzen Abend von einem zum andern, um seine hübsche Dose bewundern zu lassen.
*
Am andern Morgen thun die Kinder sehr heimlich, haben viel zu flüstern und zu lachen, und Marie geht leise in den Garten, um Blumen zu pflücken. Karl aber geht immer mit seiner eingewickelten Dose in der Hand in der Kinderstube auf und nieder, bis Marie wiederkommt; dann gehen sie hinunter ins Frühstückszimmer. Marie legt ihre Blumen in einen Kranz auf den Tisch, Mama legt einen Kuchen hinein, und darauf steht Karls Dose. Als Trina nun zur Morgenandacht kommt, da wünschen ihr alle viel Glück, und Karl führt sie an den Tisch, der für sie geschmückt ist. Das ist eine Freude für alle miteinander! Nach der Schule meinen die Kinder, es müsse durchaus etwas Besonderes geschehen, weil Trinas Geburtstag ist, und nach langem Besinnen und Beraten kommen sie überein: sie wollen mit Trina Seifenblasen machen. Zwei Pfeifen sind noch da, und Mama schenkt ihnen einen Schilling, dafür kaufen sie noch vier. Dann wird Wasser und grüne Seife so lange geschlagen, bis es lauter Schaum ist, und nun geht der Spaß an. Jedes Kind hat eine Pfeife, die steckt es in das Wasser und bläst, was es blasen kann, bis die Schale eine so hohe Blasenperücke hat, daß es den Kindern an die Nase stößt. Dann versucht jedes Kind für sich eine recht große Blase zu stande zu bringen, und wenn eine gelingt, und die Sonne drauf scheint, daß alle die grünen, roten, gelben und blauen Goldfarben in der Blase schwimmen, und der ganze Garten sich drin spiegelt, dann ist es ein Jauchzen und Wundern und sich Freuen, bis die Blase springt und alle Herrlichkeit verschwindet. Lisbethchen macht sich ein andres Vergnügen; die nimmt die Pfeife verkehrt herum, daß der Kopf aufwärts steht, füllt sie voll Wasser und bläst dann, daß das Wasser in lauter kleinen Blasen aus der Pfeife läuft. Karl will das nicht haben: »Du bist ein alter Verschwender,« sagt er, »Du spülst all' unser schönes Wasser weg.« Lisbethchen läßt sich aber nicht irre machen, sie füllt ihre Pfeife und läuft damit ein wenig weiter und sprudelt wie vorher und freut sich, wenn die kleinen Bläschen an Büschen und Blättern hängen bleiben. Karl will's ihr noch einmal wehren: da kommt Papa drüber dazu und sagt: »Laßt doch der Kleinen ihr Vergnügen! Es ist nicht hübsch von Dir, Karl, daß Du ihr wehren willst; Ihr spielt ja nur, um froh zu sein. Seht einmal, ich will Euch etwas Neues zeigen! Macht einmal eine recht schöne Blase, aber nicht zu groß.« Karl thut es. Da nimmt Papa die Cigarre aus dem Munde und bläst den Rauch durch die Pfeife in die Blase. Nun sieht sie aus, als ob sie mit Milch gefüllt sei. Karl will sie 'mal oben anfühlen, da springt sie und all' der Rauch geht Karl ins Gesicht. Nun versuchen Papa und Vetter Adolf die Seifenblasen hoch zu heben und dann von der Pfeife abzuwerfen. Sieh, es geht, und bald fliegen, zu der Kinder großen Freude, eine Menge bald bunter, bald mit Rauch gefüllter Seifenblasen vom Winde getragen hoch in der Luft umher; ja, einige fliegen sogar übers Dach weg, und die Kinder jubeln ihnen nach. Nach einer kleinen Stunde kommt die kleine Elisabeth zu Mama und sagt: »Guck, Mama, wie naß! Die Waschfrau braucht Libeth ihre Schürze gar nicht zu waschen.« O weh, wie sieht die Kleine aus. Schuh, Strümpfe, Kleid, Überzug, alles ist vorn ganz naß. Mit den andern beiden ist's freilich nicht so schlimm, aber trocken sind sie auch nicht, und alle müssen vor dem Trinken noch wieder trocken angekleidet werden. Doch war der Spaß groß, und Mama verspricht, sie sollen bald einmal wieder Seifenblasen machen.
*
Einmal über das andre schreibt die Großmama, die in Cuxhaven an der weiten, tiefen See wohnt, die Familie solle doch hinkommen und drei oder vier Wochen bei ihr zubringen. In ihrem Hause ist Platz, um alle zu beherbergen, und Großmutter hat von alten Zeiten her noch Betten und Bettstellen genug für die ganze Familie. Papa und Mama bedenken und besprechen die Sache. Das Wetter ist wunderschön; klein Roland ist ein kräftiger Junge, die andern Kinder sind gesund. Mariechen ist freilich nur zart und hat oft Kopfweh, aber der Arzt meint, ihr werde das Einatmen der schönen Luft und mehr noch das Baden in der großen See sehr wohl thun. Der Vater muß wegen seines Geschäfts eine Reise nach England machen, und so wird beschlossen: alle wollen am 12. August von Hamburg fort, und Mama soll mit den Kindern so lange in Cuxhaven bleiben, bis der Vater von England zurückkommt. Der will dann noch mit ihnen ein paar Tage bei der Großmutter bleiben, und dann wollen alle Mitte September wieder nach Hamburg zurückkehren. Dabei bleibt es. Am 12. August, morgens sechs Uhr, setzt sich die ganze Familie auf das große Dampfschiff Rob Roy, welches nach England fährt, und lassen niemanden im Hause als Martha, die Köchin. Vetter Adolf wohnt so lange bei Tante Emilie, weil er vom Comptoir nicht wegbleiben und daher nicht mitreisen kann. Wie wundern die Kinder sich über das große Schiff! Beim Hafen müssen sie erst in ein kleines Boot steigen und so an das große hinanfahren, weil das nicht an der Landungstreppe anlegen kann. Nun müssen sie auf einer steilen Treppe zum Schiff hinaufsteigen. Lottchen und Karl gehen frisch vorwärts, aber Mariechen läßt sich lieber tragen, wie die beiden Kleinen. Sie fürchtet sich vor dem großen Wasser und dem Schwanken des Bootes und der Treppe. Aber wie viel ist auf dem Schiffe zu sehen! Erst ist's ihnen beinahe bange, und sie bleiben dicht bei Papa und Mama. Die Matrosen laufen viel hin und her. Koffer, Kisten und Säcke werden hierhin und dorthin gepackt. Es wird gerufen, gefragt, geschrieen, und dabei ist es ein Sausen und Brausen und Zischen und Stoßen und Zittern, und das Schiff beugt sich bald auf die eine, bald auf die andre Seite, geht bald ein bißchen vorwärts, bald ein bißchen rückwärts! Die Kinder wissen gar nicht, wie ihnen zu Mute ist, und Mariechen denkt ganz heimlich in ihrer kleinen Seele: »Ich möchte viel lieber in unserm Garten in der Laube sitzen.« Endlich, als es sieben schlägt, wird das Lärmen und Bewegen noch viel stärker. Die Räder peitschen die Elbe, daß sie ungestüm schäumt, und die dem Schiffe nachfolgenden Wogen heben und senken sich wohl zwölf Fuß. Da fährt der Rob Roy dahin, zwischen den vielen Schiffen durch, hinaus in die freie Elbe. Vor und hinter ihm kreuzen die stromaufwärts fahrenden Kähne und Ewer mit ihren großen Segeln. Wenn sie die großen Wellen durchschneiden, so spritzt das schäumende Wasser im Sonnenstrahl blitzend oft bis zur Spitze der Masten hinauf und fällt in Millionen funkelnden Tröpfchen wieder herab. Wunderprächtig sieht es aus, und die Kinder können nicht aufhören, darüber zu jubeln und zu jauchzen. So geht's die Elbe hinunter. Nach und nach werden die Kinder bekannter und heimischer in den Schiffsräumen. Der eine Teil des Verdecks, zu dem einige Stufen hinaufführen, ist wie ein großer Saal; da haben die Kinder Platz zu spazieren, zu laufen, zu spielen, zu toben ganz nach Gefallen. Der andere tiefer liegende Raum ist sehr viel größer und sieht gerade aus, wie einer von Papas Speicherböden. Da sind Fässer, Kisten, Tonnen, Säcke, Körbe hoch aufeinander gestapelt, und der ganze Raum ist so voll gepackt, daß nur ein schmaler Weg zum Gehen frei geblieben ist, und der ist so schwierig und schmutzig, daß die Kinder kaum darauf fort können. Lottchen und Karl spazieren aber doch überall umher und lassen sich von einem freundlichen alten Matrosen zeigen und erzählen, womit das Schiff beladen ist, und wozu all' die fremden Dinge gebraucht werden. Nachher kommt Papa mit Mariechen auch und geht mit allen drei Kindern in den untern Schiffsraum, wo sie die ganze Maschine und die großen Feuerstellen sehen können, die wieder und wieder voll Steinkohlen geschüttet werden, damit das Wasser in dem ungeheuren Kessel immer koche, und der Dampf, der aus dem Kessel kommt, die ganze Maschine in Bewegung setze, die das Schiff von der Stelle bringt. Aber es ist unten eine Hitze und ein Lärmen und ein Geruch, daß die Kinder es nicht lange aushalten können. Sie gehen drum wieder hinauf und sehen oben durch das große Fenster, was die untern Räume hell macht, hinunter, wie alles sich da hebt und senkt und stampft und dreht. Mama ist mit Trina und den beiden Kleinen unten in der Kajüte; da ist ein sehr hübsches gemütliches Zimmer. Elisabeth und Roland sitzen auf der schönen Fußdecke und freuen sich an den bunten Blumen, die drin gewirkt sind, stehen auch oft auf den gepolsterten Bänken, die rund umher an den Wänden sind, sehen durch die kleinen Fenster in das schäumende Wasser hinaus und fahren schreiend und lachend zurück, wenn eine besonders große Welle ans Fenster schlägt und durch die Ritzen sie naß spritzt.
*
Um halb zwölf Uhr sieht man Cuxhaven liegen mit seinem hohen Leuchtturm. Nach und nach erkennt man auch Häuser und endlich eine Landungsbrücke und die vielen darauf stehenden Menschen. Zwischen diesen steht eine kleine alte Dame mit schneeweißen Locken. Sie hat ein dunkles Kleid an, eine saubre Mütze auf und ist in ein warmes Tuch eingehüllt. Der Vater macht die Kinder drauf aufmerksam und sagt: »Seht, das ist die liebe Großmama!« Und alle Kinder nicken und wehen mit ihren Tüchern. Klein Roland hat in Hamburg durchaus lernen sollen »Großmama« sagen; der kleine Schelm hat es aber nicht nachsprechen können, endlich hat er selbst einen Ausweg gefunden. Wenn er gefragt wird: »Roland, wie groß bist Du?«, dann hebt er die Händchen über den Kopf. Soll er nun Großmama sagen, so hebt er erst die Hände hoch auf und ruft dann: »Mama!« Dies Kunststück macht er nun fortwährend am Bord des Schiffes, als die andern Kinder Großmama rufen und grüßen und mit den Tüchern wehen. Mama hat in der Zeit alle Sachen geholt, weil sie nun gleich sehr schnell vom großen Schiff in ein kleines Boot steigen müssen, welches sie ans Ufer bringt. Papa aber küßt seine lieben kleinen Kinder eins um das andre, weil er nicht aussteigt, sondern weiter reist nach England. Sehr schnell werden alle Kinder in das Boot getragen und die Sachen hineingesetzt. Mama nimmt auch ganz eilig auf vier Wochen Abschied vom lieben Papa und setzt sich zu ihnen, Elisabeth und Roland strecken aber beide Hände nach dem großen Schiffe und rufen immer: »Papa! Papa! Papa!« Elisabeth fängt bitterlich an zu weinen, weil sie gar nicht begreifen kann, warum Papa nach der einen, und sie in dem kleinen Boote nach der andern Seite fahren. Darüber bemerken sie gar nicht das starke Schwanken des Schiffleins, worüber Karl jauchzt, klein Mariechen aber so ängstlich wird, daß sie sich von Lottchen fest in den Arm nehmen läßt und ihr Gesicht verbirgt. Bald fährt das Boot ruhiger. Sie können die liebe Großmama immer deutlicher erkennen. Nun können sie schon ihr »Willkommen! Willkommen!« hören und beantworten. Nun legt das Boot an der »alten Liebe,« so heißt die Landungsbrücke, an, und alle steigen aus und lassen sich von der Großmama herzen und küssen und streicheln und liebkosen. Karl hat freilich gar keine Zeit dazu. Er fragt schon: wo die Muscheln seien, von denen Mama erzählt hat, und möchte gern oben die vielen Lampen auf dem Leuchtturm sehen, und fragt, wo die Kugelbaak sei, und ob er die Insel Neuwerk nicht sehen könne, wohin seine Mama, als sie klein war, in einem Stuhlwagen durch die große See gefahren ist, und hundert andre Dinge. Aber er wird zur Geduld verwiesen, und als er erfährt, daß der große schwarze Hund mit den langen seidnen Haaren und den großen Schlappohren, der neben ihnen läuft, der Großmama zugehöre und Achilles heiße, da vergißt er alle seine ungeduldigen Wünsche und macht mit dem Bekanntschaft.
*
Am Seedeich liegt Großmamas Haus. Tante Minna hat das Mittagsessen schon fertig gemacht und auf den Tisch gesetzt. Die kommt ihnen nun entgegen, grüßt und küßt alle, besonders den lieben kleinen Roland, den sie noch gar nicht kennt. Den trägt sie ins Haus, und nachdem alle ihre Sachen abgelegt haben, essen sie erst zu Mittag, denn alle sind auf der langen Fahrt hungrig geworden. Tante Minna hat auch für die Kinder süße Fruchtsuppe kochen und einen Pudding backen lassen, das schmeckt prächtig, viel schöner als in Hamburg, und Großmutter streut doch immer ein bißchen Zucker über, wenn Mama auch sagt: »Es ist süß genug für die Kinder.«
Nach Tische wird nun erst die ganze Wohnung besehen. Oben sind vier Zimmer, darin Mama mit ihren Kindern wohnen und schlafen soll. Nach hinten ist ein kleines Zimmer für Lottchen und Marie ganz allein; drin steht außer den beiden Betten noch ein Waschtisch mit einer weißen Marmorplatte, auf welcher die Schale, der Krug, die Wasserflasche und das Glas stehen. So etwas Schönes haben die Kinder nie gesehen. Eine Kommode steht auch im Zimmer, ordentlich zum Zuschließen; davon soll Lottchen zwei und Mariechen zwei Schiebladen benutzen. Und denk'! an der Wand hängt auch ein Spiegel, freilich ein bißchen hoch, aber wenn Marie sich auf einen Schemel stellt, kann sie doch hineinsehen. Vor den Fenstern stehen sogar vier Blumentöpfe mit blühenden Gewächsen darin, und die kleinen Mädchen müssen versprechen, daß sie jeden Morgen sie begießen wollen. An dieses Zimmer stößt Mamas kleines Schlafzimmer; darin ist auch ein Waschtisch mit einer Marmorplatte. Das Schönste in beiden Zimmern ist aber, daß man die große weite See sehen kann, wie die Sonne sich abends da hineintaucht, und wie die vielen großen Schiffe drauf fahren, und wie die Kühe auf dem Seedeich auf- und niedersteigen und die viel tausend schönen Blumen abfressen, mit denen der Wiesengrund des Seedeichs bedeckt ist. Ja, sie können so weit, so weit sehen, bis die See an den Himmel stößt. Nach vorn hinaus liegt die große Kinderstube und dran die Wohnstube. Von da aus sehen sie freilich auch ein Stück von der See dicht vor sich, aber das ist nur ein Watt und nicht die rechte See. Wenn Flut ist, dann ist es mit schönem, hellem, klarem Seewasser gefüllt, aber wenn die Ebbe eintritt, läuft alles Wasser weg, und nur Schlamm bleibt zurück. Das ist nicht sehr schön; aber der Schlamm riecht nicht, wie in Hamburg die Kanäle und Gräben, wenn sie leer sind. O nein! Die Seeluft und der Seewind sind so frisch und duftig und schön, daß es immer ist, als lege man sein Gesicht in blühende Blumenbeete, wenn man aus den Fenstern sieht, und dabei ist der Wind so weich, so weich, daß man ihn gar nicht fürchtet.
Unten im Hause sind Großmamas Zimmer; eins davon hat eine große Glasthür, die in den Garten führt. Das Gärtchen ist freilich nur klein, aber die Wiesen rund umher sind so groß, daß die Kinder Platz genug haben, sich umher zu tummeln, und wenn sie sich müde gespielt haben, dann ist's doch hübsch, in der Gartenlaube ausruhen zu können.
*
Elisabeths größte Freude ist der kleine Hühnerhof, der links von der Glasthür zwischen Haus und Garten angebracht ist. Wenn die drei großen Kinder draußen auf dem Seedeich umherlaufen, dann bleibt sie bei Mama und Großmutter, füttert die Hühner und treibt die kleinen Küken wieder aus dem Garten, wenn sie in den Blumenbeeten scharren. Den bunten Hahn mag sie besonders gern leiden und nennt ihn immer den Hühnerpapa. Einmal kräht der Hahn sehr viel, da fragt sie: »Mama, warum schreit der Hühnerpapa?« – »Er weiß gewiß nicht, wo Du alle seine kleinen Kinder hingejagt hast,« antwortet Mama. »Ach,« sagt Lisbeth, »die sind alle in den Stall gelaufen. Soll ich ihm das sagen?« – »Ja, thu' das, Kindchen!« Nun läuft Elisabeth dem Hahn nach, der vor ihr ins Gebüsch flieht, hockt dann vor dem Gebüsch nieder und ruft: »Hühnerpapa, Deine kleinen Kinder sind alle im Stall!« Ein Weilchen bleibt sie sitzen, als warte sie auf etwas, dann kommt sie zu Mama zurück und sagt ganz erstaunt: »Mama, der Hühnerpapa hat gar nichts dazu gesagt!« Mama nimmt das kleine Mädchen auf den Schoß und sagt: »Er hat es aber doch gehört und fürchtet sich nur vor der großen Elisabeth. Sitz' einmal ganz ruhig, dann sollst Du sehen, er wird zu den kleinen Hühnchen in den Hof gehen.« Und richtig, kaum hat Mama es gesagt, da spaziert der Hühnerpapa mit hochtrabendem Tritt bei ihnen vorbei nach dem Hof, wo er bald ein Würmchen findet, und mit lautem kuk! kuk! kuk! kuk! seine Hühnerwelt zusammen ruft, um die Mahlzeit zu verzehren.
Nach zwei oder drei Tagen wird nun auch das Baden versucht. Mariechen schreit und spuckt und ächzt anfangs noch viel mehr, als Karl gethan hat, als er zuerst badete; aber nach und nach gewöhnt sie sich dran, und wenn sie auch immer sehr nach Luft schnappen muß, besonders sobald Mama sie so untertaucht, daß das Wasser über ihrem Kopfe zusammen schlägt, so macht es ihr doch Spaß, und sie freut sich jeden Tag dazu und kommt immer mit vielen Muscheln beladen nach Hause. Karl badet und schwimmt aber nicht in solch kleinem Häuschen mit leinenem Vordach; der Platz wäre ihm viel zu klein. Der geht mit Großmamas Johann an eine andre Stelle, und da badet er in der freien See. Ins Haus kommt Karl fast gar nicht. Hat er morgens bei Mama gelernt, dann wandert er fort und sucht entweder Muscheln, von denen er schon mehrere kleine Säcke voll hat; oder er spielt mit Achilles, kriecht auch wohl einmal zu ihm ins Hundehaus, um ihm, wie er sagt, Geschichten zu erzählen; oder auch er sitzt mit den Lotsen, die den muntern Jungen gern um sich haben und sorgsam auf ihn achten, auf der »alten Liebe« und läßt sich von ihnen Schiffsgeschichten erzählen. Die Lotsen sitzen dann auf der kleinen Bank und schmauchen aus ihrer kurzen Pfeife, und Karl hockt vor ihnen auf einem Holzklotz oder auf platter Erde, stützt den einen Ellenbogen aufs Knie und das Gesicht in die Hand und treibt mit schnell wiederholtem »Na? Na?« zum Weitererzählen, wenn die Lotsen einmal die Pfeife ausklopfen oder den Rauch von sich blasen oder sonst eine Pause machen. Lottchen und Marie können sich nicht satt suchen an Feldblümchen und Moos, wovon täglich Kränze und Sträuße und Kreuze gewunden werden. Großmamas Blumenschüsseln sind immer geschmückt, ebenso alle Bilder, die an der Wand hängen, und doch werden noch viele Kränze getrocknet, um mit nach Hamburg genommen zu werden.
Ist es einmal regnerisches Wetter, dann muß Tante Minna helfen, die Kleinen zu beschäftigen; denn Bauhölzer und Puppen und Wiegen und sonstiges Kinderspielzeug ist gar nicht da. Freilich eine alte Wachspuppe ist noch vorhanden, mit welcher die Tante früher gespielt hat, aber die Kinder wissen gar nicht, was sie mit der thun sollen. Sie hat ein wunderschönes Kleid an mit Silber gestickt und Perlen um den Hals und schöne Schuhe an, aber auskleiden kann man sie nicht, und die Locken sitzen hoch aus dem Gesicht, welches ganz gelbweiß ist; denn die roten Backen und die roten Lippen sind lange verschwunden. Elisabeth nennt die Puppe »die häßliche Madame« und hängt ihr immer ein Tuch über das Gesicht; aber damit spielen mag weder sie noch eins der andern Kinder. Tante Minna muß also Geschichten erzählen, und das Spaßgeschichten: von Tante Kolibri und Onkel Zuckerbrot, und von Mäusegesellschaften und Schneckenausfahrten. Oft zeigt sie ihnen Bilder von Tieren und auch von biblischen Geschichten, oder sie giebt ihnen Rätsel auf. Aber es müssen ganz kleine dazwischen sein, so daß Elisabeth auch mit raten kann, z. B. Oben Schwefel, unten Schwefel, in der Mitte Holz! – Inwendig Wasser, auswendig Glas, was ist das? Außen Eisen, innen Feuer, und im Winter macht es die Stube warm. Vier Beine tragen ein Brett, und mittags steht das Essen drauf. Es hängt an der Wand und sagt tick, tick, und wenn ich's ansehe, weiß ich, wie spät es ist. Elisabeths schönstes Rätsel ist aber: Ein wunderschönes Kleid, ein wunderhäßliches Gesicht, wer hat das? Dann ruft sie: »Die Wachspuppe, die Wachspuppe.« Und immer, wenn Tante Rätsel aufgeben will, dann winkt sie mit den Augen und bittet ganz leise: »Tante, vergiß auch nicht das häßliche Gesicht.« –
Zuweilen sitzt Tante Minna auch mit den Kindern um einen Tisch und klebt mit ihnen. Dann werden lauter verschiedene kleine Muscheln, bald offne, bald geschlossene, bald halbe mit Gummi bestrichen und in eine große Muschel geklebt; zwischen den Muscheln werden Moos, kleine bunte Steinchen und Blümchen befestigt, daß das Ganze wie ein kleines, allerliebstes Gärtchen oder Körbchen aussieht. Zuweilen kleben sie auch kleine Perlen und Glassplitter dazwischen, wenn's nur bunt und niedlich aussieht. Alle diese geschmückten Muscheln werden dann Mama in Verwahrung gegeben und schon im voraus für alle möglichen Bekannte und Verwandte, Gespielen und Schulkameraden bestimmt.
*
An einem heitern Sonntag Morgen gehen Mama und Tante Minna mit den drei ältesten Kindern, Lottchen, Marie und Karl, früh fünf Uhr zur »alten Liebe«, um die Sonne aus der See steigen zu sehen. Alles ist still und feierlich. Drei große Schiffe liegen nicht fern vom Ufer vor Anker, so ruhig als schliefen auch sie, und nur die Tritte der einzelnen Matrosen, die auf dem Verdeck zu thun haben, hallen durch die tiefe Stille. Außerdem hört man nichts, als das klingende Anschlagen der Wellen an den Brückenpfeilern. Die große See liegt wie ein leis bewegter goldener Spiegel. Das Feuermeer im Osten am Rande des Horizonts wird nach und nach immer glühender. Allen ist's ganz feierlich zu Sinn, selbst Karl spricht ganz wenig und ganz leise. Jetzt hört man in der Ferne den Kuhhirten, wie er mit seinem eintönigen Ruf die Kühe zusammenlockt. Und sieh! – da kommt ein lichter Funken herauf, und flattert sogleich, alle Spitzen der kräuselnden Wellen berührend, bis zu den Füßen der Kinder. In demselben Augenblick wird von allen drei Schiffen geschossen. Eine Schar Seemöven heben sich schreiend in die Luft, und die Kuhherde, die sich hinter dem Seedeich versammelt hat, kommt brüllend über die Höhe. Karl jauchzt laut und klatscht in die Hände. Marie sieht sehr froh aus und schmiegt sich dicht an die Mutter, der die hellen Thränen über das Gesicht laufen, Lottchen ist auf die Knie gesunken und betet. Da stimmt Tante Minna ein Lied an, und alle singen mit:
Die Morgensonne bricht hervor,
Ihr Glanz verkündiget die Macht des Herrn.
Komm, Mensch, und bete auch!
Das Tier des Feldes, der Vogel der Luft,
Sie preisen laut die Größe des Herrn.
Komm, Mensch, und bete auch!
Die Wellen tragen der Sonne Licht,
Sie klingen lieblich zur Ehre des Herrn.
Komm, Mensch, und bete auch!
»Herr, sei uns gnädig, Herr, sei uns freundlich
Und laß Deine seligen Kinder uns sein,
Um Jesu Willen. Amen.«
Als sie wieder nach Hause kommen, springt ihnen Elisabeth fröhlich entgegen und sagt: »Pfui, warum habt Ihr Elisabeth nicht mitgenommen? Ich kann ganz früh aufstehen und ganz weit gehen. Ihr sollt mich nicht wieder zurücklassen, wenn Ihr ausgeht.« »Aber Lisbeth,« sagt Mama, »dann bleibt die arme Großmutter ja ganz allein!« »Weißt Du was, Mama?« fragt die Kleine sehr freundlich, »ich bin zu Großmama ins Bett gestiegen, und nachher hat sie mir ganz süßen Kaffee abgegeben!« »O, Du böser Schelm!« droht Mama, »dann muß ich wohl ein ander Mal auch bei Euch bleiben, damit Großmama mir was abgiebt.«
*
Einige Tage später wird gegen Abend der Leuchtturm bestiegen. O, wie hoch ist er! Immer noch eine Treppe und immer noch eine Treppe. Erst haben die Kinder angefangen, die Stufen zu zählen; aber das Steigen dauert zu lange, sie müssen sich unterwegs oft ausruhen, besonders weil die kleine Elisabeth dieses Mal mit ist; und dabei haben sie sich dann so viel zu zeigen und zu erzählen, daß sie immer vergessen, wie viel Stufen sie schon gezählt haben. Es dauert wohl eine Viertelstunde, bis sie oben in dem Lampenzimmer ankommen. Elisabethchen läßt sich die letzte Treppe von Mama tragen, weil die kleinen Beine schon so müde und die Stufen so sehr schmal sind. Das Zimmer ist rund wie der ganze Turm, und fast die ganzen Wände sind Fenster. In der Runde des Zimmers ist eine Art Gerüst, an welchem vierundzwanzig große Lampen hängen. Hinter jeder Lampe ist ein unbeschreiblich glänzender Schirm, noch größer wie Großmamas Theebrett, von Kupfer oder Messing, so hell poliert, daß auf der Seite, wo die goldene Abendsonne ins Zimmer scheint, die Kinder vor blendendem Glanz nicht zu den Lampen hinaufsehen können. Im Zimmer sind die Leute beschäftigt, alles in Ordnung zu bringen, was zum Anzünden der Lampen nötig ist, weil die Sonne schon bald untergeht. Mit einem Male kommen einige heftige Schläge an das westliche Fenster. Die Kinder erschrecken, und der Mann im Leuchtturm sagt ihnen, daß das Vögel seien, die von dem hellen Glanz der Blenden, wie er die Lampenschirme nennt, gelockt werden, das Fenster gar nicht bemerken, und daher so dagegenfahren. Er erzählt ihnen, daß nachts, wenn alles draußen finster, und daher der Glanz der Lampen viel bedeutender sei, die Vögel mit solcher Gewalt gegen die Fenster flögen, daß des Morgens oft sechs bis acht tot draußen auf dem Balken lägen.
Im Zimmer ist's sehr dunstig, aber draußen auf der Gallerie wunderschön. Sie gehen also hinaus, sehen alle Lampen noch einmal von außen an und bleiben dann so lange da, bis die Sonne hinter eine kleine Wolkenbank und so ins Meer sinkt. Elisabeth hat das sehr andächtig angesehen und sich mehr daran gefreut, als an allen Lampen und Blenden. Als alle andern im Hause von dem Glanz und der Herrlichkeit des Leuchtturms miteinander reden, da sagt sie ganz langsam und bedächtig: »Du, Großmama, die Sonne war 'mal schön; sie hatte ein ganz blankes Gesicht und einen langen roten Rock an von lauter Licht!«
*
Als Mariechen mit ihrer Mutter in der Hausthür steht, es ist gerade ein Uhr, da kommt eine ärmlich gekleidete alte Frau daher. In der rechten Hand hat sie einen Stock, in der linken einen Topf. Als sie ganz nahe kommt, stößt sie plötzlich gegen einen etwas hervorstehenden Stein und fällt. Mama springt schnell zu und hilft ihr wieder auf. Sie hat zwar nicht gerade Schaden genommen, denn sie hat im Fallen beide Hände vorgestreckt, aber der Topf ist in tausend Stücke gebrochen, und ihre schöne Suppe, dran sie sich hat recht pflegen wollen, fließt über die Steine. »Ach,« klagt die Arme, »das ist mir schon oft so begegnet! Immer meine ich, ich kenne die Stelle, wo der böse Stein ist, und immer falle ich noch einmal darüber; das ist nun schon zum dritten Male. Aber der liebe Gott hat mich gnädig beschützt, daß ich noch nie Schaden genommen.« Nun erst bemerkt Mama, daß die Frau blind ist, und erfährt, daß sie jeden Mittag um 1 Uhr sich von einer ganz nahe wohnenden Familie einen Topf mit Essen holt, welches sie im Hause mit ihrem kleinen 4jährigen Enkel Rudolf verzehrt. – Mariechen flüstert der Mutter etwas ins Ohr; die nickt mit dem Kopf und giebt ihr zwei Schilling; damit läuft die Kleine zu Frau Wessels, die an der Ecke der Straße wohnt und Steinzeug verkauft, holt einen Henkeltopf und geht damit ins Haus. »Großmama!« ruft sie, »hast Du zu heute Mittag wohl zu viel Suppe gekocht?« »Zu viel? Nein, mein Herzchen; ich denk', wir werden sie alle aufessen. Aber warum weinst Du?« Mariechen erzählt die traurige Geschichte, und Großmama sagt: »Die arme Dorthel! Ich kenne sie wohl, sie wohnt ganz unten am Seedeich und ist immer so fleißig. Da will ich Dir Deinen Topf gewiß füllen, dann essen wir jeder diesen Mittag ein bißchen weniger Suppe und danken Gott, daß wir das haben.« Mariechen bringt den vollen Topf hinaus, und Mama erlaubt ihr, die blinde Dorthel nach Hause zu bringen. Von nun an paßt Mariechen jeden Tag um ein Uhr auf, und wenn sie die blinde Dorthel kommen sieht, dann läuft sie zu ihr, nimmt sie bei der Hand und bringt sie zu dem Hause, wo sie das Essen bekommt. Es sieht gar lieblich aus, wenn das kleine zarte Mädchen die alte Frau so sorgsam führt und ihr so freundlich Bescheid sagt, wenn ein Stein im Wege liegt, oder wenn eine Pfütze da ist. Vor dem Hause wartet Mariechen dann, bis die Alte wieder herauskommt, nimmt ihr den Topf ab und leitet sie wieder nach Hause. Das kleine Mädchen hat solche Freude dran, der armen Blinden zu helfen, daß in all' den vier Wochen, die sie in Cuxhaven zubringen, weder Spiel noch Erzählung noch Besuch sie jemals diese kleine übernommene Pflicht vergessen läßt. Wird aber einmal eine Ausfahrt unternommen, so muß Großmutters Köchin ihr versprechen, der armen Dorthel aufzupassen und sie wenigstens bei dem bösen Stein vorbeizuführen. Die alte Frau geht übrigens auch langsam aus dem Hause und wartet auf Mariechen, denn sie weiß, daß das kleine Mädchen ganz traurig wird, wenn sie die Alte verfehlt oder ihrer zu spät gewahr wird. Sie hat ihre kleine Führerin auch bald so lieb gewonnen, daß sie sich jeden Morgen zu dieser kleinen Wanderung freut. Schon am dritten Morgen nimmt Mariechen übrigens den kleinen Rudolf mit, ermahnt ihn, nicht wild zu sein, leidet nicht, daß er fortläuft, macht ihn auf die Stellen aufmerksam, wo er seine Großmutter vorsichtiger führen müsse, und diese ist ganz verwundert, daß der Knabe sich so gut von der kleinen sanften Marie leiten läßt. Die Blinde konnte früher nie wagen, ihn mit sich zu nehmen, weil er ihr zuweilen entwischte und dann nicht hörte und folgte, wenn Großmama ihn rief. Jetzt geht er aber so still und gehorsam zwischen Dorthel und Marien, und will er einmal unruhig werden, so weiß Marie ihn mit einer kleinen Erzählung oder einem kurzen Gespräche so festzuhalten, daß die alte Blinde schon sieht, er wird ihr kleiner treuer Führer sein können, wenn Marie wieder nach Hamburg reist.

*
Drei Wochen sind bald zu Ende, und die Hamburger haben schon viele hübsche Spaziergänge in der Umgegend gemacht. Nach Ritzebittel sind sie gewesen, wo das alte Schloß steht, in dem der Amtmann wohnt. Das ist ordentlich von einem Graben und einem Wall umgeben, auf dem sogar Kanonen aufgepflanzt sind, und Soldaten, aber wirkliche lebendige Soldaten, stehen dabei und halten Wache. In Döse waren sie auch, wo man es den saubern Häusern und den üppigen großen Gärten und Feldern ansieht, wie wohlhabend seine Bewohner sind. Daß man aber an beiden Orten die weite See gar nicht sieht und nur zuweilen das ferne Rauschen hört, will den Hamburgern gar nicht gefallen. Doch freuen sie sich ganz besonders an den schönen hohen, dichtbelaubten Bäumen, die hier in Menge sind und in Cuxhaven, so nahe bei der See, ganz fehlen, weil der Seewind sie nicht aufkommen läßt. Eines schönen Morgens fahren sie auch nach Brookswalde, da hat man beides: die See, wenn auch etwas in der Ferne, und viele Bäume, ein ganzes Gehölz. Aber ganz kurios kommt ihnen das Wäldchen vor. Es liegt hart am Strande, und da sind die ersten Bäume, eben weil der Seewind sie nicht wachsen läßt, so klein, daß Karl und Marie die höchsten Zweige der Eichen erreichen können, Lottchen aber gar nicht einmal gerade darunter stehen kann. Karl ruft: »O ein Zwergenwald, ein Zwergenwald! Wo wohl die Zwerge wohnen, denen dieser Wald zugehört?« und er springt von einem Baume zum andern und pflückt die höchsten Zweige ab. Marie meint, das müßte wunderniedlich sein, wenn hier lauter so kleine Menschen wohnten, daß ihre Häuser hier unter den Bäumen stehen könnten. Je weiter sie sich aber von der See entfernen, um so höher werden die Bäume, und rund um das Wirtshaus, in dem sie frühstücken, sind sie gerade so schlank und hoch, wie in und um Hamburg. Beim Wirtshaus zieht aber etwas anderes ihre Aufmerksamkeit auf sich. Achilles, der schwarze langhaarige Hund, ist mitgelaufen und freut sich sehr, hier einen Kameraden zu finden, mit dem er spielen kann. Im Garten des Wirtshauses läuft nämlich ein Hund umher, ebenso groß wie Achilles. Als die Kinder aber das Tier, welches sich nur sehr langsam bewegt, von vorn zu sehen bekommen, da bemerken sie, daß es einen großen Holzklotz, der fast bis zur Erde niederhängt, an einem Riemen um den Hals hat. Sie rufen voll Schrecken Mama und Großmama herbei und bitten sie, dem armen Hund doch den Klotz abzunehmen. Diese erklären aber: »Das dürfen wir nicht, liebe Kinder! Seht, der Hund gehört dem Wirt; der hat es nun einmal für gut gefunden, dem Tiere das Laufen so zu erschweren. Soll das geändert werden, so muß der Herr des Hundes es selbst thun.« Da gehen alle vier, Lottchen, Marie, Karl und Elisabeth, ins Wirtshaus. Der Wirt tritt ihnen freundlich entgegen und meint, sie wollen etwas zu essen oder zu trinken bestellen. Da fängt Karl an: »Gehört Dir der große schwarze Hund?«
Wirt. »Ja, mein Kind, ist das nicht ein schönes Tier?«
Karl. »Ja, er ist wunderhübsch, aber Du mußt ihm den großen Klotz abnehmen.«
Wirt. »Nein, ja nicht, mein Junge, sonst würde er alle Leute anspringen und vielleicht gar davonlaufen.«
Elisabeth. »Dann mußt Du Kusch! sagen, dann liegt er ganz still.«
Wirt. »Ich bin aber nicht immer da, und wenn er nun ganz wegliefe?«
Karl. »Pfui! dann wäre er ja gar kein treuer Hund. Unser Achilles hat gar keinen Klotz um, und der läuft niemals weg!«
Wirt. »Ja, bei Euch kommen nicht so viel Leute. Sieh, hier sind oft über hundert Menschen, und alle locken den Hund und füttern ihn, da könnte er leicht mit weglaufen, und das soll er doch nicht.«
Marie. »Ich darf auch nicht von Mama weglaufen; aber wenn Mama mir solchen Klotz umbände, dann würde ich ebenso traurig sein, wie Dein Hund.«
Wirt. »Ist mein Hund traurig?«
Karl. »Ja gewiß! Sieh, wie vergnügt unser Achilles ist, und wenn Dein Hund mitspringen will, dann thut es seinen Beinen weh an dem häßlichen Klotz, der dazwischen hängt. Bitte, bitte, nimm ihm den Klotz ab!« »Ja bitte, bitte!« rufen alle vier Kinder und drängen sich ganz dicht um den Wirt.
Wirt. »Liebe, gute Kinder, es geht wirklich nicht. Nachts läuft der Hund frei umher, aber tags muß er den Klotz umbehalten.«
Lottchen. »Aber der Klotz ist so schrecklich groß und schwer, sollte nicht die Hälfte abgesägt werden können?«
Der Wirt schweigt einen Augenblick und sieht die Kinder an. Seine Frau, die indes hinzugekommen ist, sagt: »Ich habe Dich auch schon darum bitten wollen; das arme Tier hat wirklich zu schwer dran zu tragen.« Nun bestürmen die Kinder ihn noch viel mehr, und als er endlich sagt: »Nun ja, so soll das Holz diesen Abend durchgesägt werden!«, da lassen sie ihm keine Ruhe, er muß sogleich die Säge holen.
O wie springt, wie läuft, wie freudig bellt der Hund, als der Herr ihm den Riemen abgelöst hat! Und die Kinder jubeln und springen mit ihm um die Wette. Als sein Herr ihn dann wieder ruft und ihm den durchgesägten Klotz umhängt, da sieht er ganz traurig aus, als er aber merkt, daß er damit laufen und auch etwas springen kann, da bellt er und wedelt mit dem Schwanz, als wenn er »danke! danke!« sagen wollte.
*
Eines Freitag Morgens nach dem Baden wandern Großmama, Mama, Tante Minna und die drei Großen auf dem Seedeich weiter und weiter bis zur Kugelbaak. Das ist ein hohes Gerüst, welches dahin gebaut ist, um den Schiffern auf der See das rechte Fahrwasser zu zeigen. Sie müssen ihr Schiff nämlich so steuern, daß die Kugelbaak grade vor dem Leuchtturm steht. Weil nun der Leuchtturm nachts von den vielen Lampen so hell erleuchtet ist, so können die Schiffer natürlich auch dann sehen, ob sie auf rechtem Wege sind. Der Strand ist hier sehr groß, und es liegen rund umher so viele, so große und auch wieder so kleine Muscheln, wie sonst nirgends. Hier lagert sich die Familie am Strande, frühstückt und füllt dann alle mitgenommenen Säcke und Beutel mit großen und kleinen Muscheln. Während sie nun da sitzen und ihr Butterbrot mit Schinken verzehren, kommt eine Frau mit einem Korb über dem einen Arm und ein ziemlich großes Netz an einem langen Stock auf der Schulter. Am Strande zieht sie ihren dicken Rock ab, läßt ihn im Sande liegen und wandert dann in weißleinenen Manneshosen, bloßen Beinen, einer Weiberjacke und Tüllmütze geradenweges in die See hinein, die hier zur Ebbezeit ganz flach ist. Als die Frau ungefähr hundert Schritte weit entfernt ist, nimmt sie das Netz, welches durch einen halbrunden Reifen ausgespannt wird, von der Schulter und schiebt es vor sich hin und geht so schiebend weiter und tiefer in die See, daß ihr das Wasser oft bis an die Brust spült. Die Kinder sind sehr verwundert über diesen Anblick und meinen, das haben sie in Hamburg doch niemals gesehen, daß jemand so weit ins Wasser gehe. »Ja,« sagt Lottchen, »und die Elbe und die Alster sind doch nur Flüsse, und dies ist die große See.« »Aber will sie da Muscheln in das Netz sammeln, oder was sucht sie eigentlich?« fragt Marie. »Ihr sollt es gleich sehen,« antwortet die Mutter, »seht, da kommt eine andre Frau aus der See zurück, die hat ihren Korb wohl voll, die ist schon früh morgens hinausgegangen.« Die Frau kommt heran. Alle Kinder besehen sie neugierig. O, wie sie naß ist! Aber sie friert nicht und klagt nicht, und in ihrem Korbe ist ein unbeschreibliches Gekrabbel von kleinen durchsichtigen Tieren. Lottchen ruft gleich: »O, Krabben, Krabben!« Die andern Kinder wollen das gar nicht glauben, daß das Krabben seien, weil sie bis jetzt nur gekochte gesehen haben. Die Großmutter will gern den ganzen Korb voll kaufen, aber die Frau sagt: »Nein, liebe Madame, diese hier sind für den Herrn Amtmann. Der eigentliche Krabbenfang dauert nur bis August; da der Herr Amtmann uns aber gut bezahlen will, so halten wir bei dem warmen Wetter noch so eine Art Nachlese, und sehen Sie nur, die ist ganz gut ausgefallen.« Die Frau giebt nun jedem Kinde eine kleine Krabbe, um sie recht genau besehen zu können, zieht dann ihren dicken Rock wieder über die nassen Hosen und wandert den Seedeich zurück. Mehr als die Krabbenfängerinnen nimmt aber Karl die Kugelbaak in Anspruch, dieses hohe Gerüst, welches so fest zwischen förmlichen Steinmauern angelegt und so hoch ist, daß man den Kopf ganz hintenüber legen muß, um bis zur Spitze hinauf sehen zu können. »Da möcht' ich einmal hinaufsteigen, schrecklich gern!« sagt Karl. »Sieh einmal, Marie, da ganz oben, wo nun die beiden Seemöven sich hinsetzen!« »Und dann hinunterfallen in die See und auf die Steine?« fragt Marie. »Nein, gar nicht,« antwortet er, »da wollte ich auf einem von den Balken reiten, und dann – Tante Minna sagt: da oben sei ein Schrank und darin Brot und Branntwein. Dann eß' ich und trinke und dann reite ich wieder und sehe in die große, weite See hinaus und singe ein Lied, so wie gestern der Mann sang, der nur mit einem Bein so eben auf den großen Steinen an der See saß.« »Magst Du das Lied leiden, Du Wildfang?« fragt Tante Minna, »das kannst Du ja gar nicht verstehen.« »Ich kann es aber hören, daß ich es leiden mag,« sagt Karl, »und er hat auch was von Wiege und Blumen und Sternen und Mond gesungen, das kann ich gut verstehen.« »Und auch zuletzt was von ›meines Vaters Haus‹,« sagt Marie, »und das sang er dreimal, ich mocht' es auch gern hören. Tante Minna, sing' es einmal, ja?« Tante Minna kennt das Lied, ist gern bereit und singt:
Habt Ihr wohl schon gestanden am weiten Meeresstrand,
Wenn Wellen langgestrecket hinrollen in den Sand?
Wenn schaumgekrönt die Spitze sich heben und beugen muß
Und mächtig überstürzend zerfließt an Eurem Fuß?
Da hab' ich oft gestanden und habe still gelauscht,
Wenn es so fern und nahe und immer näher rauscht,
Wenn's wie auf weichen Flügeln dahergezogen kam,
Mit unsichtbaren Banden mein Herz gefangen nahm.
Mir war's, ich läg' in der Wiege, und mein lieb Mutterlein,
Das sänge, wie ich vor Jahren, das weinende Kindlein ein
Mit Schlummerliedern so milde vom silberweißen Mond,
Von Blumen und von Sternen und dem, der droben thront.
Und wenn ich's recht bedenke, wie es so tönt und klingt,
So glaub' ich, daß das Meer auch ein Schlummerliedlein singt.
Wenn es die Erd' und alles, was drauf sich fröhlich regt,
Und was drauf weint und klaget, in Mutterarmen trägt.
Es singt von Gottes Liebe, die rings die Welt umfängt
Und die, wie Well' um Welle ohn' Ende heran sich drängt,
Es singt vom Himmelreiche ein feierlich ernstes Lied,
Das um der Erde Leben die ewigen Kreise zieht.
Und wenn ich lausche, da wird mir im Herzen so wohl und weh
Ich möchte mich wonnig schaukeln wohl auf der blauen Höh',
Ich möchte ewig fahren ins weite Meer hinaus,
Bis ich gelandet wäre in meines Vaters Haus!
*
Alle sitzen ganz still und lauschen. Mama aber ist aufgestanden, ist so weit wie möglich den Strand hinunter an die See gegangen. Da steht sie, hält die Hand vor die Augen und schaut. »Da kommt der Papa! Da kommt der liebe Papa!« ruft sie plötzlich. Alle Kinder springen auf, sehen rechts, sehen links und fragen: »Wo? wo? wo denn, Mama?« Die Mutter aber sieht hinaus in die See und ruft: »Da! da! Seht Ihr nicht da ganz in der Ferne den feinen Rauchstreifen? Das ist das englische Dampfboot! Nun müssen wir eilen, sonst kommt der liebe Papa früher bei der ›alten Liebe‹ an als wir.« »Hoho,« sagt Karl, »wir haben flinke Beine, und das Schiff ist noch so weit weg, das soll uns gewiß nicht einholen.« Schnell sucht jeder seine Sachen zusammen, und der Heimweg wird angetreten. Aber der Weg ist weit, und die kleinen Beine werden müde. Noch dreimal muß unterwegs ausgeruht werden, und jedesmal sehen sie, wie viel näher das Dampfboot gekommen ist. Bei der letzten Ruhe erkennen sie schon die englische Flagge und hören bei dem stillen Wetter, wie die See von den Rädern geschlagen wird. Da läßt die Mutter die drei Kinder bei der Großmama und eilt mit Tante Minna in schnellen Schritten voran, um den Papa doch beim Aussteigen empfangen zu können. Als das Dampfboot bei dem Platz vorbeifährt, wo die Kinder sich noch ausruhen, da springt Karl auf und will nun mit dem Schiffe um die Wette laufen. Großmama läßt ihn laufen, sie weiß, er wird bald von selbst stehen bleiben, denn sie haben fast noch eine halbe Stunde bis nach Hause. So geschieht es auch. Als Karl sich müde gelaufen hat, wartet er die Großmutter ab und sagt: »Es ist besser, wenn Papa uns hier noch entgegenkommt, denn auf der ›alten Liebe‹ sind doch immer so viele Menschen, da können wir Kinder sehr leicht ins Wasser fallen, nicht wahr, Großmama?« »Ja wohl, Herr Professor,« antwortet diese, »Du bist ja mit einem Male sehr vernünftig geworden! Ich finde es auch viel passender, wenn die Kinder die alte Großmama nicht hinterher gehen lassen, sondern hübsch bei ihr bleiben. So schnell wie ein Dampfboot fährt, können die kleinen Karlsbeine auch doch nicht laufen, und wenn sie noch einmal so lang und so flink wären.« So sprechend geht die alte Frau mit den drei Kindern langsam weiter, immer dem Hause zu. Als sie nur einige hundert Schritte von da entfernt sind, sieh, da kommt der Papa mit Roland und Elisabeth um die Ecke. Jetzt ist an kein Bleiben mehr zu denken. Jeder läuft, so schnell er kann, und bald hängen alle Kinder um den lieben Papa herum, und der kann kaum einen Arm frei bekommen, um die alte Mutter zu umarmen.
Am Dienstag soll's nun wieder zurückgehen nach Hamburg, und bis dahin sind nur noch drei Tage. Da wird denn gleich am Nachmittage verabredet, was in dieser kostbaren Zeit noch geschehen solle. Die Kinder fragen gleich: »Wann geht es nach Neuwerk? Wann geht es nach Neuwerk?« Und zu ihrer großen Freude kann dazu kein andrer Tag festgesetzt werden als der morgende Sonnabend; denn am Sonntag wollen alle nach Ritzebittel zur Kirche und haben versprochen, den Rest des Tages teils bei Pastor Walther, teils beim Amtmann auf dem Schlosse zuzubringen. Am Montag aber hat die Mutter viel zu ordnen und zu packen, und außerdem wollen sie den letzten Tag gern recht gemütlich mit der lieben Großmama und Tante Minna verleben. Es bleibt also dabei: »Morgen geht's nach Neuwerk!«
Abends erzählt der Vater nun noch mancherlei von dem, was er in England gesehen hat; aber die Kinder sind müde vom weiten Spaziergange und wollen morgen gern recht frisch und kräftig sein auf der lang ersehnten Fahrt. Sie sagen darum gleich nach dem Abendbrot gute Nacht und gehen zu Bett.
*
Früh sechs Uhr am andern Morgen sind die Kinder schon aus den Betten, um zu sehen, ob das Wetter freundlich sei. Und siehe, die Sonne scheint so warm ins Zimmer, als sei es im Juli. Alles ist fröhlich. Jeder holt herbei, was er für diese Tour passend oder notwendig findet: die Kinder Körbe und Taschen, um mit zurückzubringen, was sie dort Besonderes finden; der Vater ein gutes Fernglas, um ins Weite sehen zu können. Tante Minna sorgt für ein gutes Frühstück; denn finden sie dort auch beim Schulmeister Sonnabends, wo keine Schule gehalten wird, ein geräumiges Zimmer und Tische und Bänke, so doch besser, für Speise und Trank selbst zu sorgen, da es leicht sein könnte, daß auf der Insel nicht einmal so viel zu kaufen wäre, wie zehn hungrige Personen, die unerwartet ankommen, zum Frühstück verzehren. Mama und Großmama sorgen aber für Mäntel und Decken, denn, sie versichern, daß es auch bei dem wärmsten Wetter kalt auf dem Wege sei.
Um elf Uhr kommt der Wagen. Alles wird eingepackt: Mäntel, Decken und sonstige Sachen unten im Wagen, Kinder und große Leute auf den vier Stühlen. So geht's nun fort, so schnell die Pferde laufen können, durch Cuxhaven, Ritzebittel, Döse bis nach Dunen, einem ärmlichen Dorfe hart an der See. Hier wird angehalten. Alle Mäntel werden umgebunden und die Füße der Kinder in Decken eingewickelt, worüber die Kleinen viel lachen, weil sie so warm sind bei dem schönen Wetter. Darauf werden noch zwei Pferde vorgespannt, und ein Lotse mit Wasserstiefeln, die ihm fast bis zur Hüfte hinaufreichen, setzt sich zu Pferde, um vor dem Wagen her zu reiten und den Weg zu zeigen. Nun soll es weiter gehen in die See hinein. Tausende von Lerchen wirbeln von den Feldern auf in den blauen Himmel hinein, mit so lautem hellem Jubelruf, wie die Kinder es nie zuvor gehört haben. Dazu brüllen die Kühe, und die Dorfhunde bellen, und die Pferde stampfen, und die Kinder jauchzen. Es ist gar zu schön! Und nun geht's tripp und trapp vorwärts mit den vier Pferden über den weißen Strand, und der alte Lotse zu Pferde voraus. Vor sich sehen sie nichts, als die See, rechts und links bald auch nichts, als die See. Nach und nach wird der Weg schlüpfriger, das Land hinter ihnen bleibt zurück, das Brüllen der Kühe, das Bellen der Hunde, das Gewirbel der Lerchen verstummt. Bald sehen sie nichts mehr als Himmel und Wasser und sich selbst in einem Stuhlwagen mitten drin! So fahren sie eine volle Stunde lang in der Mittagszeit im klarsten Sonnenbrand ohne Hitze, ohne Staub, ohne Sturm, immer umweht von leiser Kühlung, die die Mäntel und Decken sehr angenehm macht. Dabei ist alles so still, so still, daß keiner recht zu sprechen wagt. Selbst die Kinder werden ganz still in der wonnigen, großartigen Ruhe, die sie rings umgiebt. Nur einzeln huschen schreiende Seemöven bei ihnen vorbei. Sonst hören sie nichts als die Pferde in ihrem gleichmäßigen hopp, hopp, hopp, hopp. Wird das Wasser ein bißchen tiefer, dann geht's plinsch, plansch, plinsch, plansch, und der alte Lotse immer vorauf und Achilles immer zur Seite und das Wasser zu ihren Füßen so silberhell und klar! – – Es ist zu schön, zu schön! Zuweilen kommen auch ganz trockne Stellen. Da sind dann schneeweiße Muschelberge und Straßen durchs Watt, so weit man sehen kann, gleichsam wie mit Muscheln gepflastert. Zweimal müssen sie aber auch durch ganz tiefe Stellen fahren; die Leute da nennen sie Priel. Da kommen die Pferde bis an den Bauch ins Wasser, und des Lotsen Stiefel werden naß fast bis zum Knie, und das Wasser schlägt ordentlich kleine Wellen. Dann wird Marie ein bißchen ängstlich, denn sie meint, der Wagen könne doch leicht umschlagen, und es scheint ihr immer, als wenn sie nach der Seite hinfahren, in die tiefe See hinein, auf der man in nicht gar großer Entfernung große Seeschiffe sieht. Lange dauert es aber nicht, dann geht's wieder hinauf, und Achilles, der so lange hat schwimmen müssen, macht große Sätze, daß das Wasser hoch aufspritzt, sobald er nur eben oben wieder festen Fuß fassen kann. Dann geht's wieder weiter im stillen kühlen hopp, hopp, hopp, hopp, plinsch, plansch, plinsch, plansch, bis endlich die Insel, die anfangs sehr von Nebel verhüllt war, kennbarer wird. Sie sehen grüne Wiesen und Felder schimmern. Dann erkennen sie den Deich. Der Weg, der im Wasser mit großen Rutenbüscheln bezeichnet ist, geht zu Ende. Sie fahren hinauf auf die Insel und werden begrüßt vom jubelnden Lerchengewirbel. Nun geht's durch den Außendeich, durch den Innendeich, bei dem großen mächtigen Leuchtturm vorbei, bis zum kleinen Häuschen des alten Schulmeisters.
Hier werden sie sehr freundlich empfangen. Im Hinterstübchen, wo der Schulmeister Sonntags eine Predigt hält, weil auf der Insel keine Kirche und kein Prediger ist, werden alle Sachen abgelegt, und im Schulzimmer, gleich links von der Hausthür, wird gefrühstückt. O wie trefflich schmeckt es nach einer solchen Fahrt! Die Pferde werden ausgespannt und gefüttert, und der Achilles knurrt und wedelt so lange, bis man auch ihm was zu fressen giebt. Nachdem die Familie sich einigermaßen gestärkt hat, besteigen sie den Leuchtturm. Wie mächtig steht er da in seiner altertümlichen Bauart. Die Mauern sind über zehn Fuß dick, und in dem untern Gewölbe, welches aber doch noch über der Erde liegt, ist eine solche Eiseskälte, daß alles drin erstarrt. Zur Wohnung des Vogtes führt eine wohl fünfzig Stufen hohe hölzerne Treppe hinan. Oben sind einige sehr hohe düstre Zimmer und ein großer Vorplatz, dessen Decke von vier schweren eckigen Pfeilern getragen wird. Von hier führt eine Seitenthür zum Turm. Inwendig in der dicken Mauer liegt die schmale steinerne Wendeltreppe, davon jede Stufe ein Dreieck bildet. Sie hat etwas ungemein Schauriges. So schmal! so eng! so klein der Raum, den man übersieht; und dabei geht's fort und fort immer rechts um. Endlich kommt ein Absatz. Zwei hölzerne Treppen führen gerade hinauf, und von da die letzte braunrot gemalte Treppe zu den Lampen und zur Gallerie. Da hinauf sind nun alle gestiegen; nur Trina mit den beiden Kleinen ist zurück geblieben unten beim Vogt. Der Vater aber steht mit den andern oben und schaut hinaus über die kleine üppig grüne, aber durchaus baumlose Insel mit ihren sechzehn bis achtzehn Häusern, ins weite unbegrenzte Meer. Auf der einen Seite sieht man noch eine große Sandbank mit einer hohen Baake: Schaarhörn. Auf der andern Seite erkennt man in unbestimmten Umrissen die Kugelbaak und den Leuchtturm. Anfangs können alle freilich nichts erkennen, aber als der Vater sein Fernrohr gebraucht und genau den Ort angegeben hat, wo beides liegt, da erkennen es Marie und Tante Minna, aber den andern, die nicht so scharf sehen, bleibt es doch zweifelhaft. Nachdem sie den Leuchtturm wieder verlassen haben, gehen sie noch die Wiesen hinunter nach dem Strande, um Muscheln zu suchen. Aber der Vater treibt schon. Sie dürfen nicht länger bleiben, weil sonst die Flut eintritt und sie nicht nachher zu Wagen durch die See fahren können. Ehe es drei Uhr schlägt, sitzen alle wieder auf dem Stuhlwagen, und wieder geht's im wonnigen hopp und hopp und plinsch und plansch durch die See nach Cuxhaven zurück.
*
Abends haben sie aber noch einen Unfall, der alle recht in Schrecken setzt. Als die beiden Kleinen eben zu Bette sind, kommt Karls Freund, der eine alte Lotse, und sagt: »Kommst Du mit zur ›alten Liebe‹, Karl? Heute leuchtet die See, das hast Du noch gar nicht gesehen.« – »O laß mich auch mit, laß mich auch mit!« bitten Lottchen und Marie. Der Vater sagt: »Nur zu, ich begleite Euch!« Alle vier gehen mit dem Lotsen fort. Anfangs können sie das Seeleuchten gar nicht recht sehen, aber als der Lotse Steine ins Wasser wirft und mit dem Ruder hineinschlägt, da ist die Freude groß, und die Kinder jauchzen laut, wenn das Wasser wie lauter kleine blaue Funken emporspritzt und vom Ruder herabtropft. Karl holt auch Sand und Steine und wirft sie in die See und ist dabei schnell wie immer. Als er sich einmal sehr rasch umwendet, um einen Stein aufzuheben, der unten auf der Treppe neben dem Vater und Marien liegt, da meint diese, er sei im Fallen, läßt den Vater los, um den Bruder zu halten, und gleitet selbst aus. Alle hören einen großen Plumps. Das funkelnde Wasser spritzt ihnen ins Gesicht. Die Kinder jauchzen, der Vater aber bemerkt gleich, daß Marie nicht mehr an seiner Seite steht. In demselben Augenblicke erscheint schon ihr helles Kleid auf der dunkeln Wasserfläche. Der Vater ergreift es, zieht sein durchnäßtes Töchterchen heraus, nimmt es in seinen Arm, bittet den Lotsen, sogleich mit Karl und Lottchen zu folgen, und eilt ins Haus, so schnell er kann. Mutter und Großmutter sind sehr erschrocken. Mariechen wird schnell ausgekleidet, mit warmen Tüchern abgerieben und ins Bette gelegt. Anfangs ist sie ganz bleich und kann gar nicht sprechen. Nach und nach kommt sie wieder zu sich, trinkt warmen Thee und legt sich zum Schlafen, aber sie schläft unruhig, träumt viel und ist doch am Sonntagmorgen so unwohl, daß Mama und Großmama mit ihr zu Hause bleiben und die andern allein nach Ritzebittel fahren lassen.
*
Am Montag ist Marie wieder wohl, und die Mutter meint, es sei ein Glück, daß sie das Baden so gewohnt, sonst wäre sie wohl nicht so leicht davon gekommen. Da wird nun den ganzen Tag gepackt. Ach, wie viele Herrlichkeiten müssen mit. Alles, was an Säcken und Schachteln aufzutreiben ist, wird voll Muscheln und bunte Steinchen, Seepflanzen und Wiesenblumen gepackt. Am Dienstag Morgen ist das Wetter ein bißchen unfreundlich, die Sonne scheint nicht. Kinder und große Leute sind ernsthaft, weil sie sich nicht von einander trennen mögen. Mariechen hat Kopfweh und ist weinerlich, nur Karl, der ist herzensfroh, freut sich zum Dampfboot, zur Elbfahrt, zum Nachhausekommen, zu Vetter Adolf, ja sogar zur Schule, die er so lange versäumt hat. Daß er so viel Liebes und Schönes in Cuxhaven zurückläßt, darüber tröstet er sich. Er sagt, er komme bald wieder, vielleicht gleich nach Weihnachten oder im Frühjahr.
Endlich schlägt es neun Uhr. Alle Sachen sind schon auf eine Karre geladen und ins Schiff gebracht. Vom Schiffe wird zum ersten Male geläutet. Da wollen alle miteinander fortgehen bis zur »alten Liebe«. Aber an der Hausthür müssen sie noch etwas warten; da steht die alte blinde Dorthel mit ihrem kleinen Rudolf. Sie will allen und besonders Mariechen noch einmal danken und Lebewohl sagen. Mariechen kann das Weinen nicht lassen und bittet Rudolf, er solle doch immer recht vorsichtig sein, wenn er die Großmutter führe, und verspricht ihm schöne Bilder aus Hamburg, die er sich Weihnachten von Tante Minna abholen solle. Da wird zum zweiten Male geläutet. Nun treibt der Vater zur Eile. Fort geht's zur »alten Liebe« und ins Dampfboot, und kaum haben sie Großmutter und Tante einen herzlichen Abschiedskuß gegeben, da rauscht das Wasser vom Peitschen der Räder. Die Stricke werden gelöst, das Schiff saust fort, und Tante Minna bleibt mit der alten Großmutter, grüßend und mit Tüchern wehend, auf der »alten Liebe« stehen.
*
Auf der Rückfahrt ist Mariechen recht unwohl. Anfangs ist sie sehr übel, und Mama meint, sie werde seekrank. Um elf Uhr fängt sie aber so fürchterlich an zu frieren, daß sie mit den Zähnen klappert, und sie wird auch nicht warm, obgleich Mama sie ganz warm in eins der Schiffsbetten einpackt. Nach einigen Stunden wird sie sehr heiß, trinkt viel und klagt über Kopfschmerz. Um vier Uhr, als sie wieder bei Hamburg landen, da liegt klein Mariechen in solchem Schweiß, daß sie über und über in wollene Decken gewickelt und so ans Land und in den Wagen getragen werden muß, damit sie sich nicht erkälte. Sie haben nun noch über eine Stunde zu fahren, bis sie in ihrem Landhause ankommen. Alle andern freuen sich, die bekannten Plätze und Häuser wiederzusehen, nur Marie sieht von allem nichts; denn sie liegt in Mamas Arm und schlummert. Das Haus ist sehr freundlich und schön geschmückt. Der alte Jakob hat mit Marthas und Vetter Adolfs Hülfe das ganze Haus bekränzt. Tante Emilie ist auch da, die hat einen schönen Kuchen gebacken, welcher in der Wohnstube auf dem Tische steht. Alle sind herzlich froh, wieder in Hamburg zu sein, so gern sie auch in Cuxhaven gewesen sind, und selbst Marie schläft im eignen Bettchen oben in der Kinderstube so sanft und fest, daß Mama hofft, sie werde morgen wieder besser sein. So scheint es auch am andern Tage. Marie ist fröhlich und guten Mutes, nur sehr blaß und etwas matt, weshalb Mama ihr auch nicht erlaubt, aus dem Zimmer und noch viel weniger zur Schule zu gehen. Am Donnerstag Morgen ist es kaum zehn Uhr, da fängt das arme kleine Mädchen wieder an zu frieren und zu klappern. Mama merkt nun, daß sie wirklich das kalte Fieber hat. Fast drei Wochen lang ist sie den einen Tag, die Mattigkeit abgerechnet, ganz gesund und den andern Tag so krank, daß sie nicht aus dem Bette sein kann. Endlich giebt der Arzt ihr ganz bittere Pulver, und als sie davon eingenommen hat, bleibt das Fieber weg. Das Pulver ist so weiß wie Zucker, aber so bitter, daß Marie beim Einnehmen das Gesicht sehr verzieht. Als Karl das sieht, sagt er: »Pfui, Marie, schäme Dich! Solch kleines, schönes Pulver und dabei machst Du solche saure Fratze? Ich mache keine Fratze, wenn ich Medizin einnehme.« – »Ja, Du!« sagt die Mutter, »Du hast noch nie etwas anderes eingenommen, als süßen Hustensaft. Da, nimm Du nur den Rest!« – »Das kann ich,« sagt Karl, »siehst Du?« und damit leckt er schnell den Löffel aus. Aber wie spuckt er, wie schüttelt er sich, wie wischt er den Mund und wie schimpft er. »Pfui! Das schmeckt scheußlich!« ruft er, »noch viel schlechter als Papas brauner Senf, den er zum Ochsenbraten ißt. Das will ich niemals wieder probieren, und wenn Du noch so viel saure Fratzen machst.« Mama und Mariechen lachen den Karl tüchtig aus; er läuft aber in die Küche und ißt ein Stück Schwarzbrot, um den bittern Geschmack wieder los zu werden.
*
Im Oktober wird das Wetter sehr rauh, und auf klein Rolands erstem Geburtstag zieht die Familie zur Stadt. Marie ist noch immer nicht zur Schule gewesen, weil der Arzt bange ist, sie könnte von dem weiten Schulwege in der kalten Herbstluft das Fieber wieder bekommen. Sie ist auch noch so blaß und mager, daß niemand glauben will, daß sie wirklich ganz gesund sei. Am Tage, als nun alle Sachen vom Garten hereingebracht werden, haben die großen Leute viel zu thun. Elisabeth und der kleine dicke Roland, der seit vier Wochen allein laufen kann, spielen zwischen den vielen Sachen umher, die noch nicht auf ihrem rechten Platze stehen, und sind sehr vergnügt. Mariechen sitzt auf dem Fußboden und ordnet das Puppenzeug, welches sie in die Schiebladen der kleinen Kommode einpacken will, die an der einen Wand des Wohnzimmers steht. An die gegenüberliegende Wand ist ein großer Spiegel gelehnt, den der Tischler aufhängen soll, sobald er Zeit hat. Da kommt der kleine Roland angekrochen, sieht sich im Spiegel, kriecht von der einen Seite zur andern und sucht hinter dem Spiegel nach dem kleinen Jungen, den er da vor sich sieht. Mariechen freut sich an dem Spiel des Kleinen und lacht mit ihm. Mit einem Male steht er auf, lacht in den Spiegel hinein und läuft dann wieder zu den Seiten und guckt dahinter. Ehe Mariechen sich's aber versieht, faßt der kleine Schelm den großen Spiegel mit beiden Händen. Der Spiegel bekommt das Übergewicht. Der kleine Roland schlägt rücklings nieder, der Spiegel stürzt auf ihn und zerbricht klirrend in tausend Stücke. Auf den Fall und das Geschrei eilt die Mutter herbei. Sie hebt den Spiegel auf, und drunter liegt der liebe, kleine Roland, und in seinem Gesichtchen stecken eine Menge Scherben von dem dicken Spiegelglase. Mama zieht vorsichtig das Glas heraus, wäscht ihm sein kleines blutiges Gesicht und sucht ihn mit Liebkosen und Erzählen und Zuckerwasser zu beruhigen, bis der Arzt kommt, der den Kleinen genau besehen und Pflaster auf die Wunden legen soll. Eh' der aber noch kommt, schmiegt sich Elisabeth an Mamas Knie und sagt: »Marie schläft und ist so weiß, als wenn sie tot wäre.« Mama sieht sich erschrocken nach dem kleinen Mädchen um, und wirklich, der große Schreck hat das arme, noch halb kranke Kind ohnmächtig gemacht. Sie sitzt auf der Erde und lehnt ihr totbleiches Gesicht an die Puppenkommode. Es dauert lange, bis sie sich wieder besinnen kann, und nachher muß sie immer wieder weinen, wenn sie auch noch so gern fröhlich sein will. Als der Arzt Rolands Wunden verbindet, da giebt er Mariechen auch Medizin und sagt, sie solle sich nur gleich still ins Bett legen.
*
In der Nacht kann Marie aber nicht schlafen. Immer dreht sie sich hin und her; sie ist wohl müde, aber die Augen wollen gar nicht zubleiben. Papa und Mama sind ganz traurig, daß sie noch spät in der Nacht gar nicht schläft und so heiße rote Backen hat. Mama giebt ihr Zuckerwasser zu trinken und sagt ihr, daß sie ganz still liegen solle. Marie ist auch gehorsam, aber sie kann doch nicht schlafen und möchte viel lieber aufstehen und herumspazieren. Mama sitzt noch lange an ihrem Bette, sieht ihr kleines Töchterchen an und legt es zurecht, bis es endlich, endlich einschläft. Aber kaum ist Mama zu Bette gegangen, da wacht Marie wieder auf. Sie hat geträumt, daß sie mit dem kleinen Kinderwagen, in dem Roland sitzt, einen großen Berg hinunterfalle, das hat sie so erschreckt, daß sie aufgewacht ist. Nun kann sie gar nicht wieder schlafen, denn der Kopf thut ihr so weh. Sie liegt aber ganz stille, damit ihre liebe Mama ja nicht wieder aufwache. Als es Morgen wird, da thut Marien der Kopf noch viel weher; sie mag auch nicht aufstehen und kein Brot essen und keine Milch trinken. Die andern Kinder müssen ganz sachte sein, und Papa holt den Doktor. Der kommt bald nachher und verschreibt neue Medizin; die nimmt Marie auch ganz artig ein, aber der Kopf will doch nicht besser werden.
Ein Tag nach dem andern geht hin, und immer liegt Marie noch zu Bette und ist krank. Sie spricht viel von Sternen und Blumen und Kränzen und Kreuzen und kleinen Kindern, die doch gar nicht da sind. Oft spricht sie die ganze Nacht und schläft gar nicht. Papa und Mama sind ganz traurig, und Mama sitzt immer bei Mariens Bett. Karl und Elisabeth werden jeden Nachmittag von Lottchen unterhalten, und die sorgt dafür, daß sie hübsch still und artig sind und die Mutter nicht stören. Eines Tages hat Marie wohl eine Stunde lang schön geschlafen, da wacht sie ganz fröhlich auf und fragt: »Wo ist Bruder Edmund geblieben? Ach, ich habe so mit ihm gespielt; er hat viele helle Sterne in meinen Korb gelegt, die kann ich behalten. Sieh', Mama, wie schön!« Und sie zeigt Mama die leeren Händchen. – »Aber,« fährt sie eifrig fort, »ich habe keine Zeit, ich muß mich schnell fertig machen! Wo ist meine Guli? Guli muß auch mit. Um fünf Uhr kommt Edmund, und das Christkind kommt auch mit und viele liebe Engel, dann wollen wir ausfahren in einem goldenen Wagen, meine Mama, und dann – sehe ich noch viel mehr Sterne – und Sonne – Sieh', Mama – wie hell – wie hell – o!« – Mariechen schläft wieder ein. – Mama weint viel, sie merkt es wohl: ihre Marie ist sehr krank und wird wohl wirklich zum seligen Brüderchen heimziehen, und Mama möchte sie doch so gerne noch behalten. – Marie schläft lange und fest. Um drei Uhr wacht sie auf. Sie ist ganz still und fragt nach Papa, Lottchen, Karl und Elisabeth, auch der kleine Roland muß an ihr Bett kommen; alle müssen ihr guten Tag sagen, sie hat sie so lange nicht gesehen. Dann fordert sie ihr Täubchen, lacht ganz freundlich und streichelt es. Auch Martha und Trina müssen kommen und ihr die Hand geben. Dann klagt sie, daß ihr der Kopf so weh, so weh thue. Alle andern gehen leise wieder fort, und Marie bleibt allein mit ihren Eltern. Die Mama giebt ihr Medizin und legt ihr kalte, nasse Tücher auf den Kopf; aber es will alles nicht helfen. Da faltet das kleine Mädchen die Hände und betet laut: »Lieber Gott, mach' Du doch, daß mein Kopf nicht mehr so weh thut, und daß ich ganz gesund werde! Thut der liebe Gott das denn nun auch gewiß?« fragt Marie. »Ja ganz gewiß, mein süßes Kind,« sagt Mama. »Schickt er denn die lieben Engel, daß die mir die rechte Medizin bringen?« – »Ja, alle Engel,« sagt Mama und weint. »Mama, mich friert,« sagt Marie und schaudert; aber ehe Mama sie noch mehr zudecken kann, kommt sie in die Höhe, sieht so selig aus, als ob sie schon ein Engelchen wäre, und ruft: »Ach Mama! meine Mama! sieh! – sieh! – sieh!« – Mama sieht nichts als ihr liebes Töchterchen. Marie aber macht die hellen Augen zu und ist gestorben. Sie hat wohl das Christkind und die heiligen Engel gesehen, die gekommen sind, sie ins Paradies zu tragen.
*
Papa und Mama haben nun keine Marie mehr, die bei ihnen umherläuft, und Lottchen und Karl und Elisabeth haben kein Mariechen mehr, die mit ihnen spielt. Darüber sind alle sehr traurig und weinen viel. Am Sonntag ist ein schöner, heller, warmer Wintertag. Da legen sie früh, als die Sonne aufgeht, die kleine Marie in ihr letztes Bett. Karl schneidet alle Blumen von den Gewächsen ab, die vor den Fenstern blühen, und schmückt die liebe Schwester damit. Elisabeth zieht ihrer Puppe das beste Kleid an und legt sie Marien in den Arm, daß sie immer bei ihr schlafen solle, und nun soll Marie hingetragen werden in den schönen Garten, wo Bruder Edmund auch schläft. Während der Sarg hinausgetragen wird, singen alle:
Fahr' hin, du teures Kind, fahr' hin
In Deine kühle Gruft!
Das Sterben ist Dir nur Gewinn,
Weil Dich Dein Heiland ruft.
Weil er Dich führt zum Himmel schön,
Zu ew'ger Freud und Lust.
Da werden wir uns wiedersehn,
An unsers Heilands Brust!
und folgen dann der lieben Leiche. Als der Sarg auf der Bahre steht, fliegt Mariechens weißes Täubchen herzu und setzt sich darauf, mitten in den schönen Blumenkranz, den Mama und Lottchen gewunden und darüber gehängt haben. Es wird freilich zweimal weggejagt, aber das Täubchen kommt immer wieder und läßt sich mit hintragen nach dem Kirchhof. Viele Kinder gehen mit, streuen Blumen in die Gruft und singen schöne Lieder vom Sterben und Auferstehn, als der Sarg hinabgesenkt wird. Das Täubchen fliegt nun scheu aufwärts und bleibt oben im Baum über dem Grabe sitzen. Es kommt auch nicht wieder herab, als alle Leute nach Hause gehen. Karl ruft es einige Mal, aber es kommt doch nicht.
Im Hause ist es nun recht leer – Mariechen ist ja nicht mehr da! Im übrigen ist alles, wie es früher war. Eltern und Kinder sind zusammen, sie essen, sie trinken, sie schlafen; die Kinder gehen zur Schule und kommen wieder nach Hause. Mama näht und strickt und sorgt für die Kinder, spielt viel mit ihnen und ist sehr freundlich, wenn sie auch oft Thränen in den Augen hat. Aber Mariechen ist nicht mehr da! Sie kommt nicht, wenn Elisabeth und Roland nach ihr rufen, Lottchen kann ihr keine Geschichten mehr erzählen, und Karl hat seine liebe, sanfte Spielgefährtin mit ihr verloren. Das macht die Kinder still und traurig, und mit dem Spielen will es anfangs gar nicht recht gehen. Karl sitzt oftmals allein in einer Ecke auf der Treppe oder hinter dem großen Schrank und weint, weil er so gern will, daß Mariechen wieder kommen solle. Sie ist auch immer so lieb und freundlich gewesen und hat gefällig nachgegeben, wenn der Bruder anders gewollt hat als sie. Die Mutter tröstet ihn dann und erzählt ihm, wie selig und fröhlich Marie im schönen Himmel sei, und ermahnt ihn auch, so freundlich, fleißig und folgsam zu werden, wie das selige Schwesterchen. Das verspricht Karl und hält Wort. –
*
Der kleine Karl wird von der Zeit an wirklich viel ernster und verständiger und macht seinen Eltern viel Freude durch seinen Fleiß und Gehorsam. So wird er nach und nach ein großer Karl, spielt immer weniger und lernt immer mehr. Lottchen verläßt nach zwei Jahren die Schule und hilft der guten Mama beim Nähen, Kochen, Waschen und Plätten und sorgt für Elisabeth und Roland, die auch immer größer werden und zur Schule kommen und etwas lernen.
Endlich wird Karl gar ein Förster, wohnt im Walde und sorgt dafür, daß immer die rechten Bäume umgehauen und andere wieder gepflanzt werden, daß auch ja nicht ein Jäger zu unerlaubter Zeit Tiere schieße. Lottchen wird Vetter Adolfs Frau und wohnt in der Vorstadt, nicht gar weit von den lieben Eltern. Elisabeth wird auch nach und nach ganz groß und hilft der Mama im Hausstande. Roland lernt sehr viel und reist endlich nach der Universität, weil er ein Arzt werden will.
So vieles ist nach und nach anders geworden, aber immer haben sich die Geschwister lieb behalten, und immer sind die Kinder den Eltern gehorsam gewesen, und immer haben sie dran gedacht, daß sie selig werden wollen, wie Bruder Edmund und Schwester Marie. Die Eltern haben sich auch viel über ihre lieben Kinder gefreut und haben nie vergessen, täglich mit ihnen Gott und ihrem Heilande zu danken, der sie so glücklich gemacht hat und noch viel glücklicher machen will, wenn er sie einst alle vom Tode aufweckt und lebendig macht zum ewigen Leben.
Leipzig, Druck von C. Grumbach.